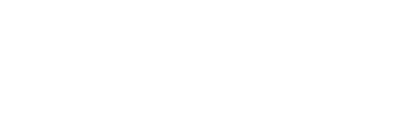Monetary Policy and the Economy Q1-Q2/20
Call for applications: Klaus Liebscher Economic Research Scholarship
The Oesterreichische Nationalbank (OeNB) invites applications for the Klaus Liebscher Economic Research Scholarship. This scholarship program gives outstanding researchers the opportunity to contribute their expertise to the research activities of the OeNB’s Economic Analysis and Research Department. This contribution will take the form of remunerated consultancy services.
The scholarship program targets Austrian and international experts with a proven research record in economics and finance, and postdoctoral research experience. Applicants need to be in active employment and should be interested in broadening their research experience and expanding their personal research networks. Given the OeNB’s strategic research focus on Central, Eastern and Southeastern Europe, the analysis of economic developments in this region will be a key field of research in this context.
The OeNB offers a stimulating and professional research environment in close proximity to the policymaking process. The selected scholarship recipients will be expected to collaborate with the OeNB’s research staff on a prespecified topic and are invited to participate actively in the department’s internal seminars and other research activities. Their research output may be published in one of the department’s publication outlets or as an OeNB Working Paper. As a rule, the consultancy services under the scholarship will be provided over a period of two to three months. As far as possible, an adequate accommodation for the stay in Vienna will be provided.
Applicants must provide the following documents and information:
- a letter of motivation, including an indication of the time period envisaged for the consultancy
- a detailed consultancy proposal
- a description of current research topics and activities
- an academic curriculum vitae
- an up-to-date list of publications (or an extract therefrom)
- the names of two references that the OeNB may contact to obtain further information about the applicant
- evidence of basic income during the term of the scholarship (employment contract with the applicant’s home institution)
- written confirmation by the home institution that the provision of consultancy services by the applicant is not in violation of the applicant’s employment contract with the home institution
Please e-mail applications to scholarship@oenb.at by the end of October 2020.
Applicants will be notified of the jury’s decision by end-November.
Editorial
25 Jahre EU-Mitgliedschaft Österreichs – Stabilität und Wachstum durch Integration
Österreich trat am 1. Jänner 1995 – zusammen mit Finnland und Schweden – der Europäischen Union (EU) bei. Der EU-Beitritt war von politischen, insbesondere aber von ökonomischen Argumenten getragen. Österreich als kleine offene Volkswirtschaft inmitten Europas hatte sich bereits als Mitglied der Europäischen Freihandelsassoziation über das Freihandelsabkommen mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1973 und durch die Teilnahme am Europäischen Wirtschaftsraum 1994 handelspolitisch an die EU angenähert. Aber erst der EU-Beitritt eröffnete den uneingeschränkten Zugang zum EU-Binnenmarkt und ermöglichte in weiterer Folge den Beitritt zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion im Jahr 1999.
Der EU-Beitritt hat in allen ökonomischen Bereichen deutliche Spuren hinterlassen und als Katalysator für notwendige Veränderungen gewirkt, insbesondere im Außenhandel, beim realen BIP-Wachstum, auf die Einkommens- und Produktivitätsentwicklung, auf dem Arbeitsmarkt und den Finanzmärkten sowie im Regulierungsbereich. Eine Vielzahl von empirischen Studien haben Österreich substanzielle positive Wachstumseffekte, einhergehend mit einer deutlichen Zunahme der Beschäftigung bescheinigt 1 , wobei die stärksten wirtschaftlichen Impulse von der Teilnahme am Binnenmarkt und den EU-Erweiterungen ausgegangen sein dürften, wie der Beitrag von Breuss in diesem Heft bestätigt. Es wäre aber zu kurz gegriffen, die EU/WWU (Wirtschafts- und Währungsunion)-Mitgliedschaft nur an den ökonomischen Effekten auf die österreichische Volkswirtschaft zu messen, da die Mitgliedschaft weitreichende und insbesondere langfristige Implikationen für das österreichische Institutionengefüge und damit für die wirtschafts-, geld- und finanzpolitischen Entscheidungsprozesse sowie -Entscheidungsträgerinnen und -träger hatte. Darüber hinaus ermöglichte der EU/WWU-Beitritt Österreich die aktive wirtschafts- und gesellschaftspolitische Mitgestaltung Europas. Das gilt nicht nur für die nach 1995 erfolgten EU-Erweiterungsrunden und die konkrete Ausgestaltung der Wirtschafts- und Währungsunion sowie die Umsetzung der Geldpolitik des Eurosystems, sondern auch für die Reformierung und Weiterentwicklung des gesamten EU-Regelwerks.
Die letzten Jahrzehnte waren zwar durch ein stetes wirtschaftliches Zusammenwachsen gekennzeichnet; die politische Konvergenz ist aufgrund der Komplexität der Interessenslagen zwischen den Mitgliedsländern aber ein vergleichsweise langsamer und fordernder Prozess, begleitet von herben Rückschlägen, wie dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Die in engem Konnex mit der Globalisierung stehenden neuen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen, wie jene der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 oder die jüngst aufgetretene, den Wohlstand und das Leben der Menschen bedrohende COVID-19-Pandemie, erfordern aber mehr denn je das gemeinsame Agieren der EU-Mitgliedstaaten. Lokale bzw. regionale Krisen und Konflikte entwickeln sich aufgrund der starken weltweiten Handels- und Produktionsverflechtungen im historischen Vergleich immer öfter und schneller zu globalen Krisen. Die Bekämpfung und Abfederung der Folgen von derartigen globalen Herausforderungen kann auf der Ebene der EU/WWU effektiver als auf nationalstaatlicher Ebene wahrgenommen werden. Ein Beispiel dafür ist die gemeinsame Geldpolitik des Eurosystems. Ausgehend von der erfolgreichen, aber im Zuge der Liberalisierung des Kapitalverkehrs nicht mehr umsetzbaren Hartwährungspolitik ist die Oesterreichische Nationalbank seit 1999 Teil des Eurosystems und nimmt damit gleichberechtigt mit den anderen europäischen Notenbanken an allen wichtigen Entscheidungsprozessen des Europäischen Systems der Zentralbanken teil.
Die OeNB nimmt die 25-jährige EU-Mitgliedschaft Österreichs zum Anlass, die vorliegende Ausgabe von „Monetary Policy and the Economy“, einer Quartalspublikation der OeNB, für eine Rückschau und Bestandsaufnahme der Mitgliedschaft aus österreichischer Perspektive zu nutzen. Diese Publikation ist Teil einer Trilogie: Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der WWU-Mitgliedschaft publizierte die OeNB im Jahr 2019 eine Sonderausgabe mit dem Titel „20 years of the euro in Austria“. Im Jahr 2018 wurde mit Bezug zur EU-Ratspräsidentschaft Österreichs eine Sonderausgabe mit dem Titel „Europe 2030: building a more resilient European monetary union“ herausgegeben, die sich mit der Frage auseinandersetzte, ob die EU ihre Mechanismen zur Krisenprävention und -absorption hinreichend verbesserte, um kommenden Krisen besser begegnen zu können.
Die EU-Mitgliedschaft und insbesondere die Nutzung des EU-Binnenmarkts sind – wie auch von der ökonomischen Theorie postuliert – von positiven Wachstumseffekten und damit von positiven Effekten auf Einkommen und Beschäftigung begleitet. Der erste Beitrag von Breuss bestätigt die erheblichen, wachstumssteigernden Effekte der 25-jährigen EU-Mitgliedschaft auf Österreichs Volkswirtschaft, die von der Nutzung des Binnenmarkts, von der verstärkten Handelsverflechtung mit den anderen Mitgliedstaaten sowie von den EU-Erweiterungsrunden und vom Beitritt zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ausgegangen sind. Er bestätigt damit die Ergebnisse einer Vielzahl von empirischen Studien zu den Wirkungen der EU-Integration auf Österreich.
Stehrer geht im darauffolgenden Beitrag der Frage nach, wie sich die EU-Osterweiterungen auf die österreichische Volkswirtschaft auswirkten. Österreich hatte nach dem Fall des Eisernen Vorhangs rasch wieder seine historischen Handelsbeziehungen mit den zentral-, ost- und südosteuropäischen Ländern aufgenommen bzw. ausgeweitet. Die EU-Erweiterungsrunden intensivierten die wirtschaftlichen Verflechtungen mit dieser Region erheblich, sodass nun bereits ein Viertel der österreichischen Exporte in diese Region gehen. Stehrer zeigt, dass die zentrale Lage Österreichs in Europa und die Nähe zu Deutschland eine wichtige Rolle dafür spielten, dass Österreich von den stark wachsenden Volkswirtschaften in Zentral- und Osteuropa, von der Integration in die europäischen Produktionsnetzwerke und dem sich daraus ergebenden Muster der europäischen Arbeitsteilung, d. h. den Agglomerations- und Spezialisierungstendenzen, vergleichsweise stark profitierte.
Der Beitritt zur EU bzw. zum EU-Binnenmarkt eröffnete für österreichische Unternehmen neue Absatzchancen, einhergehend mit erhöhter Konkurrenz und steigendem Lohndruck. Das wirkt sich stark auf die Entwicklung der Produktivität und Gewinnspannen aus. Die Produktivität je geleisteter Arbeitsstunde ist in Österreich im europäischen Vergleich überdurchschnittlich hoch. Fenz, Ragacs, Schneider, Vondra analysieren in ihrem Beitrag, welche Faktoren die Entwicklung dieser beiden zentralen Größen der Leistungsfähigkeit von Unternehmen und Volkswirtschaften seit dem EU-Beitritt 1995 in Österreich trieben. Neben Innovation, Ausbildung, Markteffizienz und Infrastruktur kommt institutionellen Rahmenbedingungen und damit auch der Mitgliedschaft Österreichs in der EU/WWU eine zentrale Rolle zu. Die Autoren untersuchen, welche Wirtschaftssektoren und welche Produktionsfaktoren für das Produktivitätswachstum in Österreich entscheidend gewesen sind und welchen Einfluss der Strukturwandel auf das Produktivitätswachstum hatte. Auf Basis einer Shift-Share-Analyse kommen sie zum Ergebnis, dass das gesamtwirtschaftliche Produktivitätswachstum durch das Wachstum innerhalb einzelner Branchen erklärt wird, während sektorale Strukturverschiebungen das gesamtwirtschaftliche Produktivitätswachstum gedämpft haben, da Branchen mit hoher Produktivität zugunsten von Branchen mit niedriger Produktivität an Bedeutung verloren haben und angebotsseitig insbesondere die Gesamtfaktorproduktivität das Produktivitätswachstum trägt. Sie zeigen auch, dass auf makroökonomischer Ebene ein sehr enger Zusammenhang zwischen dem Produktivitätswachstum je geleisteter Arbeitsstunde und der Veränderung der Gewinnquote zu beobachten ist.
Stiglbauer untersucht in seinem Beitrag den Einfluss des EU-Beitritts und damit der Arbeitnehmerfreizügigkeit auf die Arbeitsmarktentwicklung bzw. die Zusammensetzung des Arbeitskräftepotenzials in Österreich. Im Verlauf der letzten 2 ½ Dekaden hat die Beschäftigung aus den alten und vor allem aus den neuen EU-Mitgliedsländern stark zugenommen. Diese Arbeitskräftezuwanderung aus der Europäischen Union hat die demografisch bedingte Verlangsamung des Wachstums der heimischen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter abgemildert und dadurch einen beträchtlichen Beitrag zur Beschäftigung und zum Wirtschaftswachstum in Österreich geleistet. Der Autor zeigt, dass die zuwandernden Beschäftigten aus anderen EU-Ländern meist männlich, jung und gut ausgebildet sind, dass sich die Zuwanderung gut mit der Größe, der geografischen Distanz und dem durchschnittlichen Einkommen der Herkunftsländer erklären lässt, und dass Arbeitnehmerinnen und -nehmer aus den alten EU-Ländern eher im Westen Österreichs, jene aus den neuen Mitgliedstaaten vor allem in den östlichen Bundesländern beschäftigt sind. Während die Arbeitskräfte aus den alten EU-Ländern vornehmlich in akademischen und technischen Berufen arbeiten, sind jene aus den neuen EU-Mitgliedstaaten vor allem als Hilfskräfte sowie in Dienstleistungs- und Handwerksberufen tätig. Sie finden sich insbesondere im Gastgewerbe, in der Arbeitskräfteüberlassung, im Bauwesen und im Handel.
Der freie Dienstleistungsverkehr und die Niederlassungsfreiheit bilden neben dem freien Warenverkehr, dem freien Kapitalverkehr und der Personenfreizügigkeit die Eckpfeiler des EU-Binnenmarkts. Sie ermöglichen die Mobilität von Unternehmen und Arbeitskräften innerhalb der EU, ihre Umsetzung gestaltet sich allerdings schwierig. So wurde erst 2006 die EU-Dienstleistungsrichtlinie verabschiedet, um die nach wie vor bestehenden Einschränkungen der Dienstleistungsfreiheit innerhalb des Binnenmarkts zu beseitigen. Auch Österreich reagierte, wie andere Mitgliedstaaten, zögerlich und implementierte die Richtlinie erst im Jahr 2012. Kolleritsch und Walter untersuchen in ihrem Beitrag die Entwicklung der unternehmensnahen Dienstleistungsexporte nach regionalen und sektoralen Aspekten und anhand von unternehmensspezifischen Eigenschaften, wie Wirtschaftsbranche, Größe bzw. Beschäftigtenzahl oder Spezialisierung seit dem EU-Beitritt. Sie finden eine hohe Persistenz der Dienstleistungsexportbeziehungen Österreichs mit der EU, aber nur eine (relativ) beschränkte Wachstumsdynamik sowie Umschichtungen hin zu den Mitgliedstaaten des Euroraums und zu nicht an Österreich angrenzende EU-Erweiterungsländer. Der Export von unternehmensnahen Dienstleistungen in andere EU-Länder wird von Transportdienstleistungen dominiert, gefolgt von den – zunehmend an Bedeutung gewinnenden – technologieintensiven Dienstleistungen. Versicherungs- und Finanzdienstleistungsexporte haben infolge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise allerdings stark abgenommen. Interessant ist, dass der Dienstleistungsverkehr mit den EU-Mitgliedstaaten weniger wissensintensiv ist als mit Drittstaaten.
Gemäß Außenwirtschaftstheorie führen regionale Wirtschaftsintegrationsabkommen durch präferenzielle Handelsregelungen oder die Schaffung eines gemeinsamen Binnenmarkts oder einer Währungsunion sowohl für die teilnehmenden Länder als auch für Drittländer zu einer Erhöhung der ausländischen Direktinvestitionen. Christen und Falk analysieren in ihrem Beitrag anhand eines FDI-Gravitationsmodells, das Informationen über 200.000 Direktinvestitionsprojekte im Zeitraum von 2003 bis 2018 enthält, die Auswirkungen des EU-Beitritts auf Greenfield-Direktinvestitionen. Sie kommen zum Ergebnis, dass die EU-Mitgliedschaft für Bulgarien und Rumänien – anders als für Kroatien – von großen und signifikanten Effekten auf Greenfield-Direktinvestitionen begleitet war. Die Anzahl der angekündigten Greenfield-Direktinvestitionsprojekte österreichischer multinationaler Unternehmen in Bulgarien und Rumänien ist in den ersten drei Jahren nach dem Beitritt stark angestiegen gestiegen. Die größten Effekte waren aber bereits im Jahr vor dem Beitritt zu beobachten.
Ein sehr starker Stimulus ging von der EU-Mitgliedschaft bzw. bereits zuvor von der Ostöffnung und den EU-Erweiterungsrunden auf den österreichischen Bankensektor aus. Die großen österreichischen Banken erkannten, wie Kavan und Wittenberger in ihrem Beitrag zeigen, sehr schnell die Chance, den margenschwachen Heimatmarkt nach Zentral-, Ost- und Südosteuropa (CESEE) zu erweitern. Durch Bankneugründungen und -zukäufe fassten sie nach der Ostöffnung rasch Fuß in dieser Region, wobei die Aussicht auf mögliche EU-Beitritte dieser Länder eine Reform- und Aufbruchstimmung bedingte, die mit einer überaus dynamischen Kreditvergabe, die vorerst hohe Gewinne erbrachte, einherging. Das starke Kreditwachstum in diesen Ländern, das oftmals in Fremdwährungen erfolgte und durch die Mutterbank refinanziert wurde, bedeutete eine starke Zunahme des Risikos in den Bankbilanzen, das im Zuge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise schlagend wurde und zu hohen Kosten führte. Dem folgte eine Phase der Konsolidierung und der verschärften Regulierung, insbesondere die Implementierung makroprudenzieller Maßnahmen zur Hintanhaltung von Risiken für die Finanzmarktstabilität. Der wirtschaftliche Aufholprozess dieser Länder bietet aber grundsätzlich weiterhin ein beachtliches Wachstums- und Ertragspotenzial für die heimischen Banken, obgleich es mit anhaltenden Herausforderungen für die Bankenaufsicht einhergeht.
Das grenzüberschreitende Agieren von Unternehmen, Finanzinstitutionen und anderen Wirtschaftsakteuren im Binnenmarkt führt zur Notwendigkeit einheitlicher europäischer Regulierungsmaßnahmen bzw. gemeinsamer Spielregeln. Dies gilt sowohl für den realwirtschaftlichen Sektor als auch für den Finanzbereich, für den neben Wettbewerbsaspekten auch Finanzmarktstabilitätsaspekte in einer Währungsunion zu berücksichtigen sind. Zum Zeitpunkt des EU-Beitritts Österreichs war die EU-Bankenregulierung noch stark fragmentiert, eine EU-weite Harmonisierung, auch der Bankenaufsicht, noch sehr gering. Kaden, Boss und Schwaiger zeichnen in ihrem Beitrag die Harmonisierungsschritte ausgehend vom sogenannten Single Rule Book der Bankenregulierung bzw. die außerordentlich stark zunehmende Regelungsdichte infolge der Finanzkrise nach. Sie zeigen, dass im Zuge der Etablierung der Bankenunion eine zunehmende Konvergenz in der operativen Bankenaufsicht innerhalb des Euroraums erreicht wurde. Durch diese Entwicklungen, die in eine Verbesserung des Risikomanagements der Banken und der Risikotragfähigkeit des Bankensystems münden, ist der Bankensektor in der EU und damit auch in Österreich krisenresistenter als vor 25 Jahren geworden. Gleichzeitig haben sich auch die Wettbewerbsbedingungen im europäischen Bankensektor deutlich angeglichen.
Der EU-Beitritt hat auch in der Wettbewerbspolitik Österreichs seine Spuren hinterlassen. Für das reibungslose Funktionieren des EU-Binnenmarkts ist die Wettbewerbspolitik von zentraler Bedeutung und demgemäß eine Kernaufgabe der Europäischen Union. Ohne das europäische Wettbewerbsrecht, das einen unverfälschten Wettbewerb sichert, wäre der Binnenmarkt nicht vorstellbar. Es ist ein Regulativ der marktwirtschaftlichen Ordnung, das auf die Verhinderung von wohlfahrtsmindernden privaten Absprachen und Praktiken und damit auf eine funktionierende Kartell-, Fusions- und Beihilfenkontrolle setzt. Die europäische Wettbewerbspolitik hat die Aufgabe, für Chancengleichheit auf dem europäischen Binnenmarkt zu sorgen – auch für kleinere und mittlere Unternehmen sowie für Beschäftigte und Verbraucherinnen und Verbraucher. Böheim zeichnet in seinem Beitrag die wettbewerbspolitischen Entwicklungen in Österreich seit 1995 nach. Die Wettbewerbspolitik spielte hierzulande lange Zeit keine nennenswerte Rolle. Erst die Übernahme des wettbewerbsrechtlichen Acquis Communautaire und der Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts vor nationalem Recht führten mit Verzögerungen zur Angleichung des österreichischen materiellen Wettbewerbsrechts an das Gemeinschaftsrecht und somit zu einer Neugestaltung der wettbewerbspolitischen Institutionenlandschaft Österreichs. Jedoch sieht der Autor durchaus noch institutionelles Entwicklungspotenzial in Form der politischen Aufwertung einer unabhängigen, wettbewerbspolitischen Beratung durch eine gestärkte Wettbewerbskommission.
Die Inflationsentwicklung in Österreich unterlag in den letzten Jahrzehnten verschiedenen internationalen und nationalen Einflussfaktoren. Messner und Rumler untersuchen in ihrem Beitrag, inwieweit sich der Inflationsprozess in Österreich infolge der Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den letzten 25 Jahren, sei es durch den EU-Beitritt, die Gründung der WWU, die Globalisierung und die Finanz- und Wirtschaftskrise, verändert hat. Sie kommen zum Schluss, dass es über einen sehr langen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten in Österreich eine stabile Phillips-Kurve gab, d. h. einen positiven Zusammenhang zwischen Inflations- und Konjunkturentwicklung, der sich aber in den 1990er-Jahren abschwächte. Hierfür dürften externe Faktoren wie der EU-Beitritt, die Errichtung der WWU und die zunehmende Globalisierung verantwortlich zeichnen. Des Weiteren kommen sie zum Ergebnis, dass die Geldpolitik erst seit Beginn der WWU einen messbaren Einfluss auf die laufende Inflationsentwicklung in Österreich hatte.
Der EU-Beitritt brachte signifikante direkte fiskalische Effekte für Österreich mit sich, da Österreich einerseits zur Finanzierung des EU-Haushalts beitragen muss, andererseits aber auch Rückflüsse aus dem EU-Haushalt erhält. Der EU-Haushalt bildet nicht nur die finanziellen Verflechtungen der EU mit den einzelnen Mitgliedstaaten ab, sondern ist auch ein Spiegelbild der politischen Prioritäten der Europäischen Union, die sich im Lauf der Jahrzehnte immer wieder veränderten. Die Prioritätenverschiebungen lassen sich insbesondere an der Ausgestaltung der mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) der EU ablesen. Daher sind die Neuverhandlungen eines mehrjährigen Finanzrahmens – die bereits seit 2018 laufenden Diskussionen zum MFR 2021–2027 zeigen dies deutlich – politisch äußerst herausfordernd, müssen doch die unterschiedlichen Interessenslagen der Mitgliedstaaten auf einen Nenner gebracht werden, um Einstimmigkeit in der Beschlussfassung zu erzielen. Köhler-Töglhofer und Reiss evaluieren in ihrem Beitrag die Entwicklung der politischen Prioritäten auf Basis der Veränderung der Ausgabenschwerpunkte sowie der Einnahmen des EU-Haushalts. Letztere waren über die Jahrzehnte ebenfalls starken Veränderungen unterworfen und wurden insbesondere durch diverse Rabatte auf die Mitgliedsbeiträge komplex und schwer durchschaubar. Die Autoren zeigen, dass Österreich seit dem Beitritt 1995 durchgehend Nettozahler in das EU-Budget war, allerdings auch an den Vorteilen des Rabattsystems partizipierte. Österreich profitiert darüber hinaus seit jeher vergleichsweise stärker als andere EU-Staaten mit hohem Bruttonationaleinkommen pro Kopf von den Rückflüssen aus den Mitteln der Agrarpolitik. Ein zu enger Blickwinkel auf den Nettozahlerstatus in den EU-Budgetverhandlungen birgt die Gefahr in sich, die erheblichen ökonomischen Vorteile, die die Nutzung des EU-Binnenmarkts für Österreich bringt, aus den Augen zu verlieren.
Der EU- und insbesondere der WWU-Beitritt tangieren das gesamte wirtschaftspolitische Entscheidungsgefüge Österreichs. Die geld- und fiskalpolitischen Rahmenbedingungen und die sich daraus ergebenden Effekte der gemeinsamen Geldpolitik auf Österreich wurden bereits im Rahmen der Sonderpublikation zu 20 Jahren Euro im Jahr 2019 diskutiert. Auböck und Prammer erörtern in der vorliegenden Publikation die wirtschafts- und strukturpolitische Koordinierung und die sich daraus für Österreich ergebenden wirtschaftspolitischen Reformnotwendigkeiten. Mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik versucht die EU bereits seit 1993, eine koordinierte Wirtschafts- und Haushaltspolitik aller Mitgliedsländer zu erreichen – ursprünglich, um ein tragfähiges Fundament für das Funktionieren der europäischen Währungsunion zu schaffen. Die wirtschaftspolitische Koordinierung sollte das Ausbalancieren aufkommender Ungleichgewichte zwischen den wirtschaftlich unterschiedlich starken Mitgliedstaaten der WWU, denen der Korrekturmechanismus des Wechselkurses nicht mehr zur Verfügung steht, unterstützen. Stark divergierende Lohn- und Preisentwicklungen in den Mitgliedstaaten, einhergehend mit einer auseinanderklaffenden Wettbewerbsfähigkeitsentwicklung und sich dadurch aufbauenden makroökonomischen Ungleichgewichten, sollten durch die Koordinierung der Wirtschafts- und Strukturpolitiken verhindert werden. Die im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise offenkundig gewordenen internen und externen makroökonomischen Ungleichgewichte resultierten in einer Reform des gesamten Koordinierungsmechanismus bzw. des gesamten wirtschaftspolitischen Regelwerks der EU. Mit dem neu geschaffenen Instrument der makroökonomischen Überwachung werden nunmehr im Rahmen des Europäischen Semesters wirtschaftspolitische Prioritäten für die einzelnen Mitgliedstaaten abgeleitet und in Form von länderspezifischen Empfehlungen an jedes Mitgliedsland gerichtet. Das gilt auch für Österreich, wo die EU – mitunter wiederkehrende – Empfehlungen z. B. zur Senkung der Steuerlast auf Arbeit, zur Sicherung der langfristigen Tragfähigkeit des Pensionssystems, zur Verbesserung des Bildungssystems oder der Anreizsysteme am Arbeitsmarkt sowie zur Erhöhung des Wettbewerbs (insbesondere im Bereich der Dienstleistungen) aussprach. Da allerdings die Umsetzung dieser länderspezifischen Empfehlungen rechtlich nicht bindend ist, tragen die Mitgliedsländer – und Österreich ist dabei keine Ausnahme – diesen Reformvorschlägen nur in einem recht geringen Maß Rechnung.
* * *
Die durch die COVID-19-Pandemie ausgelöste weltweite, tiefe Rezession hat auch in den EU-Staaten, einschließlich Österreich, tiefe Spuren hinterlassen. Die Krise hat uns eindrucksvoll vor Augen geführt, dass derartige Schocks vor nationalen Grenzen keinen Halt machen. Geeignete gesundheits- und wirtschaftspolitische Antworten auf ein solches fundamentales Ereignis sind immer eine große Herausforderung und ein Stresstest für die Entscheidungsqualität und Robustheit staatlicher Institutionen. Antworten der Politik in derartigen Krisen erfolgen unvermeidlich mit beschränkter Information, unter hoher Unsicherheit und unter hohem Zeitdruck und werden rückblickend kaum jemals optimal erscheinen. Zählen wird, wie gut die Entscheidungen – gegeben die schwierigen realen Entscheidungsbedingungen und die große Unsicherheit – im Vergleich zu anderen Ländern oder Wirtschaftsräumen ausfallen, wie die Ergebnisse für die Gesundheits- und Wirtschaftsentwicklung im globalen Ländervergleich sind und welche Auswirkungen eine derartige Krise langfristig auf Wirtschaft und Gesellschaft sowie für die Leistungsfähigkeit der staatlichen Institutionen hat.
Die Krise ist bei weitem noch nicht überwunden und ein abschließendes Urteil zu diesen Fragen wird noch längere Zeit ausstehen. Die Zeichen stehen jedoch zu Redaktionsschluss dieser Publikation Ende Juni 2020 gut, dass die EU im Vergleich zu anderen Teilen der Welt – auch im Vergleich zu entwickelten Volkswirtschaften wie den USA oder dem Vereinigten Königreich – die Gesundheitskrise insgesamt besser bewältigt haben wird. Die Geldpolitik des Eurosystems hat rasch und entschlossen reagiert, um die Wirtschaft vor einem noch stärkeren Einbruch zu bewahren, ein Abgleiten in eine Deflation zu verhindern und die Stabilität des Finanzsystems zu gewährleisten. Die Bankensysteme sind dank der verschärften EU-weiten Regulierung und der seit der globalen Finanzkrise aufgestockten Eigenkapitalpuffer in der aktuellen Krise deutlich stabiler und – unterstützt durch staatliche Maßnahmen – in der Lage, der Wirtschaft den nötigen Kredit zur Überbrückung der Krise zur Verfügung zu stellen. Die EU-Mitgliedsländer haben zudem rasch, entschlossen und gezielt die nötigen expansiven Unterstützungsmaßnahmen für die Unternehmen, die von der Krise betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie für spezifische Sektoren gesetzt. Die EU-Fiskalregeln wurden zu diesem Zweck pragmatisch, lösungsorientiert und flexibel vorübergehend ausgesetzt.
Last but not least wurden auf EU-Ebene bedeutende gemeinsame Hilfsfonds auf den Weg gebracht, die bis Herbst 2020 fertig verhandelt sein sollten. Die neuen Hilfsfonds, die aktuell als vorübergehende Antworten auf die COVID-19-Krise konzipiert werden, sind ein bedeutendes Zeichen der Handlungskraft und des politischen Willens zur weiteren Entwicklung der EU und der Wirtschafts- und Währungsunion.
Gerade in Zeiten der Krise erweist es sich für eine kleine, offene Volkswirtschaft wie Österreich als Vorteil, Teil des großen Wirtschafts- und Währungsraumes der EU und der WWU zu sein. Denn, wie die Geschichte zeigt, hat die EU immer wieder – für manche überraschend – Resilienz und die Fähigkeit zur Weiterentwicklung und Überwindung auch sehr großer Herausforderungen und anfänglicher Interessensunterschiede bewiesen. Der Wille zum offenen Dialog und zur Lösungsfindung durch Verhandlungen ist eines der Erfolgsrezepte der EU, sowohl im wirtschaftlichen als auch im breiteren gesellschaftlichen Kontext. Österreich wird als EU-Mitglied auch in Zukunft von dem großen gemeinsamen Gewicht und der gemeinsamen Problemlösungsfähigkeit dieser Staatengemeinschaft profitieren und deren weitere Entwicklung zum gemeinsamen Wohl aktiv mitgestalten.
Ernest Gnan, Walpurga Köhler-Töglhofer, Doris Ritzberger-Grünwald
1 Siehe Beer, C., C. A. Belabed, A. Breitenfellner, C. Ragacs und B. Weber. 2017. Österreich und die europäische Integration. In: Monetary Policy & the Economy Q1/17. Wien: OeNB. 86–125.
Zusammenfassungen in Englisch
Macroeconomic effects of 25 years of EU membership for Austria
Fritz Breuss
Austria’s EU accession 25 years ago, alongside Finland and Sweden, was preceded by an extended period of convergence toward the EU. Even before joining the EU, Austria had been actively pursuing trade relations with its current peers. It first did so on the basis of a free trade agreement concluded with the European Economic Community (EEC) in 1973, more than a decade after which Austria had become a member of the European Free Trade Association (EFTA), and then through participation in the European Economic Area (EEA) in 1994. Following EU accession in 1995, Austria adopted all measures aimed at deepening EU integration (building an economic and monetary union and introducing the euro as a single currency as well as abolishing many of the EU’s internal borders via the Schengen Agreement). Austria also played an active part in all subsequent EU enlargement rounds. Implementing EU policies, Austria has modernized and Europeanized its economy, reaping corresponding economic benefits at all levels of EU integration. Economic evidence points to a real GDP growth dividend of 0.8 percentage points per year since 1995, attributable to Austria’s participation in EU’s internal market and monetary union as well as to the momentum of EU enlargement. The key growth drivers have been internal market participation (+0.4 percentage points) and EU enlargement (+0.3 percentage points), with the remaining 0.1 percentage point being related to the introduction of the euro. Even before EU accession, Austria had emerged as a social and economic gateway between Western and Eastern Europe after the fall of the Iron Curtain in 1989 and benefited from the opening-up of Eastern Europe. The EU enlargement rounds in 2004 and beyond reinforced these developments and enabled Austria to achieve, together with its neighbors, a kind of miniature globalization.
Convergence, production integration and specialization in Europe since 1995
Robert Stehrer
The development of the Austrian economy following EU accession on January 1, 1995, must be seen in the context of the European integration process that began after the opening up of Eastern Europe. This integration process was essentially characterized by (1) restructuring and catching-up processes in Central, Eastern and Southeastern European countries (CESEE), (2) the integration of the CESEE economies into European and global value chains fostered by international trade and foreign direct investment flows, and (3) the ensuing emergence of specialization and agglomeration patterns within Europe. Given Austria’s gateway position in Europe’s geographic and political landscape, EU accession created great challenges but unique opportunities alike for Austria. This paper reviews the development of the Austrian economy along these dimensions in a European context and discusses the outlook for future challenges.
Development of corporate productivity and profitability in Austria during EU membership
Gerhard Fenz, Christian Ragacs, Martin Schneider, Klaus Vondra
Austria outperforms the EU average in terms of labor productivity per hour worked while lagging behind its number one trading partner, Germany. In the period from Austria’s EU accession in 1995 until 2017, domestic labor productivity remained broadly 20% above EU-28 levels but 6% below the levels seen in Germany. Mirroring international trends, domestic productivity growth dropped when the financial and economic crisis hit in 2008, declining from 2% before the crisis to below 1% thereafter. A shift-share analysis shows that aggregate productivity growth has been driven by productivity growth within individual sectors, and that it has been dampened by structural change: Sectors with high productivity levels have been crowded out somewhat by sectors with low productivity levels. On the supply side, more than half of productivity growth is attributable to total factor productivity. From a macroeconomic perspective, productivity gains per hour worked have been closely correlated with profit share changes in Austria. Following an increase by 7 percentage points, the profit share peaked at 37% in 2007, before shrinking to 31% in 2017. Such a correlation is not evident from balance sheet data.
Assessing the impact of Austria’s EU accession and of EU enlargement on the domestic labor market
Alfred Stiglbauer
Austria’s EU accession has been a catalyst for the take-up of jobs by citizens from fellow EU Member States. Since 2004, and even more so since 2011, the increases in employment has been most pronounced for citizens from countries that joined the European Union in the EU enlargement rounds of 2004 and beyond. These employees have been making significant contributions to output growth in Austria. The immigration numbers from countries that joined the EU in 2004, 2007 or 2013 can be explained with the size of the respective home countries, their geographical proximity to Austria and their income levels. Within Austria, there is an east-west divide between citizens from the “newer” EU Member States, who tend to work in the eastern provinces, and citizens from the “older” EU Member States, who tend to work in the western provinces. In terms of socio-economic characteristics, other EU citizens working in Austria are typically male, young and well-educated. Citizens from the older EU Member States tend to hold academic or technical jobs, whereas citizens from the newer EU Member States tend to be in low-skilled jobs or in services and skilled trades jobs. Probit model estimates imply that unemployment risk has increased only moderately in Austria as a result of immigration from the newer EU Member States. However, this effect is more elevated for some occupations (people doing manual or mostly manual labor, and above all people in services and sales jobs).
Free movement of services within the EU’s Single Market: What have been the effects on Austria?
Erwin Kolleritsch, Patricia Walter
What have been the effects of EU accession and deeper EU integration on Austria’s services exports? We find that Austria’s closer integration with the EU has reinforced domestic export relations with other EU Member States but has generated only (relatively) limited growth dividends. The pattern of domestic exports has shifted toward other euro area countries and, beyond Austria’s immediate borders, toward EU accession countries. Apart from implicit trade restrictions, these developments were driven by less than full implementation of the Single Market, early efforts to build trade relations with Central, Eastern and Southeastern European economies and Austrian businesses’ propensity to take up the freedom of establishment within EU borders. While services exports within the EU are relatively more important for Austria than for comparable EU Member States, the comparative advantages Austria has gained from these exports are limited. Our results suggest that services trade within the EU is relatively more important for small businesses and Austrian-dominated companies, while trade with non-EU Member States is relatively more dominated by knowledge-based services and exports of manufacturing companies. Over time, the share of value added by Austrian services exports to the EU has been rising, but the corresponding final demand multipliers continue to be smaller for exports to other EU Member States than for exports to non-EU Member States.
Impact of EU membership on greenfield FDI
Elisabeth Christen, Martin Falk
Empirical studies agree that EU membership and the creation of the European Single Market in 1992 increased foreign direct investment (FDI) flows and stocks for the participating countries. However, it is likely that the FDI effect of economic integration will decrease over time as the number of EU Member States increases. This paper examines the impact of EU accession on greenfield investment relations between Austria and the EU, with a particular focus on the three latest additions to the EU (Bulgaria, Romania and Croatia) as well as selected non-EU Member States. We estimate the impact of EU membership for these countries using an FDI gravity model containing information on 200,000 FDI projects over the period 2003–2018 and distinguishing between sectors (services and manufacturing). The results show that the impact of EU membership on greenfield FDI is large and significant for Bulgaria and Romania, but not significant for Croatia. In particular, the number of greenfield FDI projects by Austrian multinational companies in Bulgaria and Romania increased by more than 200% in the years after accession, with the effects already occurring one year before accession. The results do not differ much between services and manufacturing..
Austrian banks’ expansion to Central, Eastern and Southeastern Europe
Milestones – review and outlook
Stefan Kavan, Tina Wittenberger
Austria’s major banks jumped at the opportunity of expanding their low-margin domestic operations by entering Central, Eastern and Southeastern European (CESEE) markets soon after the fall of the Iron Curtain. By establishing new banks and/or acquiring existing banks, they were able to rapidly gain a foothold in the region and benefit from the reform mood and growth momentum fueled by the prospect of potential EU membership for CESEE countries. Dynamic loan growth generated high profits, but the rapid expansion was not without downsides. Much of the lending occurred in foreign currencies and was refinanced by the parent banks. The underlying risks materialized when the global financial and economic crisis hit the region in 2009 and drove up (risk) costs, thus leading to a period of consolidation. Macroprudential measures designed to mitigate risks to financial stability were an important lesson learned by banking supervisors from the crisis, and Austria was no exception in this respect. With the economy recovering, the past few years have been characterized by an enhanced ability of clients to pay back their loans. However, the good profits have also been a consequence of re-accelerating credit growth, which has created new systemic challenges and necessitated macroprudential measures in several CESEE countries. The economic catching-up process in Austrian banks’ enlarged home market continues to provide the potential for significant growth and profits. At the time of writing, profitability and loan quality were good. Yet, the long recovery driven by credit growth and the recent weakening of the economy also come with numerous challenges, which banks and their supervisors will have to address.
Note: Time of writing before the COVID-19 pandemic.
Evolution of the European banking supervisory framework during Austria’s EU membership
Michael Kaden, Michael Boss, Markus Schwaiger
The European banking supervisory framework has changed fundamentally over time with regard to the objectives pursued, the legislative approaches adopted and the institutional arrangements used, and last but not least also with regard to the scope of regulation and supervision. When Austria joined the EU, the goal of establishing a single market was paramount. Policymaking was focused on removing obstacles to the freedom to provide services and the freedom of establishment, and on ensuring a level playing field across all Member States. Specific amendments to EU legislation in this regard were laid down in a range of EU directives, usually without providing for supporting institutional arrangements. At the turn of the new millennium, the focus shifted towards facilitating faster and more flexible regulation processes by setting up European regulatory agencies. This change was motivated by the urge to address emerging developments in financial markets in a timely manner and to advance financial integration to be able to gain higher benefits from monetary union. In parallel, EU legislators made an effort to stop adding to what was perceived as a flood of overly detailed legislation by putting “better regulation” principles at the heart of policymaking processes. The 2007 financial crisis, finally, significantly altered the motivation for regulation and hence the scope of the supervisory framework. Without abandoning earlier goals, EU law-making has since been dominated by efforts to address the regulatory deficiencies uncovered by the crisis and to prevent such crisis scenarios from re-emerging. Relying on directly applicable regulations as the instrument of choice, measures have been taken to strengthen the crisis resilience of individual financial institutions and the financial sector as a whole, and to establish European supervisory and regulatory mechanisms with a view to creating and eventually completing the – as yet incomplete – European banking union.
Competition policymaking in Austria: looking back and beyond after 25 years of EU membership
Michael Böheim
Competition policymaking to ensure the viability of the common market is among the priorities for policymaking by the European Union. In Austria, corporate competition remained a largely unregulated area in the post-WWII period, while in Germany academics and practitioners established a competition tradition and culture early on. Pro-competitive policymaking did not really take off in Austria until we joined the EU. The adoption of the acquis communautaire on competition law and the supremacy of Union law created sufficient external pressures for Austria to align, with some delay, the relevant material rules of domestic law with Union law and to redesign the institutional governance of competition. These changes curbed the influence of the social partners (labor, employers and the government), limiting their say in competition cases and their powers of initiative. The existing Cartel Court was retained as a decision-making body alongside a newly established Federal Competition Authority, which was given extensive investigative and enforcement powers (from 2002). The Federal Competition Authority has since come to play a pivotal institutional role, unlike the Competition Commission (also established in 2002), which has remained rather insignificant in the absence of the political will to seek independent advice for competition policymaking. However, there is a case for strengthening the role of the Competition Commission: it could serve as a catalyst or developing a grand design for Austria’s competition policy.
Long-term drivers of inflation in Austria and the effects of EU accession
Teresa Messner, Fabio Rumler
The purpose of this study is to identify if and how the inflation process has changed in Austria in recent decades in line with the changing economic framework, including Austria’s accession to the EU, participation in Europe’s Economic and Monetary Union (EMU), the globalization of the economy and the financial and economic crisis of 2008/09. To this effect, we tested numerous specifications of an extended Phillips curve model for structural breaks and then estimated these specifications for several subperiods with time-varying coefficients using kernel smoothing techniques. These tests revealed three significant structural breaks: one break in the mid-1980s, a period generally associated with the beginning of the Great Moderation; another break in 1995, the year of Austria’s EU accession; and a third break in 2000, which coincided with EMU implementation. Our estimations yield a stable Phillips curve for Austria for most of the past 40 years. In other words, we find inflation growth to have been positively correlated with economic growth, apart from a temporary weakening of this relationship during the 1990s. During that period, the impact of external factors such as Austria’s EU accession, EMU implementation and globalization is likely to have increased. Interestingly, monetary policy did not start to have a measurable impact on inflation developments in Austria until around the time of EMU participation, which implies that the transmission of the Eurosystem’s stability-oriented monetary policy has been working effectively in Austria.
EU budget adjustments and their implications for Austria
Walpurga Köhler-Töglhofer, Lukas Reiss
The EU budget is the balance of fiscal flows within the EU and a reflection of the EU’s policy priorities. These priorities have changed significantly in recent decades, as evidenced above all by the shrinking share of agricultural spending in total EU spending. At the same time, the funding pattern has shifted and increased in complexity, as numerous budget correction mechanisms were introduced over the years to adjust contributions from certain Member States to the EU budget. Austria has been a net contributor ever since it joined the EU in 1995, but since the adoption of the EU’s financial framework for the 2001–2007 period it has also been benefiting from rebates for net paying Member States. Austria has, moreover, been receiving more money back through agricultural subsidies than other EU Member States with high per capita levels of gross national income. The financial framework for the 2021–2027 period, which has yet to be agreed, is bound to bring further changes. After all, the new European Commission will set new priorities and have to address the implications of Brexit for the EU budget. Judging from the proposals submitted for discussion by the European Commission to date, the EU’s agricultural and regional funds are likely to shrink further whereas COVID-19 recovery support programs and climate change projects are likely to be new big-ticket items.
EU economic policy recommendations and Austria’s implementation score
Maria Auböck, Doris Prammer
The EU’s broad economic policy guidelines, issued annually since 1993, play a central role in the coordination of EU Member States’ economic and fiscal policies. These guidelines define macroeconomic and structural policy priorities for both the EU as a whole and individual EU Member States, and serve as the basis for country-specific recommendations for each Member State. Austria has typically received policy guidance to shift taxes away from labor, ensure the long-term sustainability of its pension system, improve its educational system, provide more effective incentives to unlock untapped labor market potential and boost competition (e.g. in the service sector). However, since Member States are not legally bound to implement the country-specific recommendations, implementation rates are often low. Among the recommendations put to Austria since the first European Semester cycle in 2011, a mere 5% of recommendations have been fully implemented (EU: 9%), while 9% of recommendations (EU: 5%) have remained unaddressed. Implementation scores are generally high for the financial sector, where market pressures exert a profound influence on corresponding political action. Similarly, larger current account and budget deficits are associated with a greater likelihood of implementation, with financial market pressures, again, driving reforms.
Zusammenfassungen in Deutsch
Makroökonomische Effekte der 25-jährigen EU-Mitgliedschaft Österreichs
Fritz Breuss
Österreich ist – zusammen mit Finnland und Schweden – vor 25 Jahren der EU beigetreten. Als Mitglied der Europäischen Freihandelsassoziation (European Free Trade Association, EFTA) hat sich Österreich über das Freihandelsabkommen mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 1973 und durch die Teilnahme am Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 1994 handelspolitisch der EU bereits zuvor stark angenähert. Österreich hat mit dem Beitritt zur EU 1995 an allen darauffolgenden vertiefenden Schritten der EU-Integration (Wirtschafts- und Währungsunion, WWU mit der Einführung des Euro; Schengener Abkommen) und an der EU-Erweiterung teilgenommen. Politisch ist Österreich durch die EU-Mitgliedschaft europäischer und moderner geworden und auch ökonomisch hat es von allen Stufen der Integration profitiert. Die Teilnahme am EU-Binnenmarkt, an der WWU mit dem Euro und an den EU-Erweiterungen hat zu einem jährlichen Anstieg des realen BIP von 0,8 Prozentpunkten beigetragen. Die größten wirtschaftlichen Impulse kamen von der Teilnahme am Binnenmarkt (+0,4 Prozentpunkte) und der EU-Erweiterung (+0,3 Prozentpunkte); die Einführung des Euro steuerte 0,1 Prozentpunkte zum jährlichen BIP-Wachstum bei. Bereits durch die Ostöffnung 1989 rückte Österreich vom Rand Europas in dessen Mitte. Die EU-Erweiterungen beginnend ab 2004 verstärkten diese Entwicklung und erlaubten Österreich eine volle Teilhabe an der „Mini-Globalisierung“ vor der Haustüre.
Konvergenz, Produktionsintegration und Spezialisierung in Europa seit 1995
Robert Stehrer
Die Entwicklung Österreichs infolge des EU-Beitritts am 1. Jänner 1995 ist im Zusammenhang mit dem beginnenden europäischen Integrationsprozess infolge der Osteuropaöffnung zu sehen. Wesentliche Aspekte dieses Integrationsprozesses waren die (i) Umstrukturierungs- und Aufholprozesse der osteuropäischen Länder, (ii) die Einbindung in europäische und globale Wertschöpfungsketten und die damit einhergehende Entwicklung der Handelsströme und ausländischen Direktinvestitionen und (iii) die sich ergebende Entwicklung der Spezialisierungs- und Agglomerationsmuster innerhalb Europas. Aufgrund der geographischen, aber auch politischen Lage Österreichs zwischen West und Ost stellte der EU-Beitritt sowohl eine große Herausforderung als auch Chance dar. Die vorliegende Studie zeichnet die Entwicklung Österreichs entlang dieser Dimensionen im europäischen Kontext nach und diskutiert die daraus folgenden zukünftigen Herausforderungen.
Entwicklung von Produktivität und Profitabilität heimischer Unternehmen während der EU-Mitgliedschaft
Gerhard Fenz, Christian Ragacs, Martin Schneider, Klaus Vondra
Österreich weist eine – im europäischen Vergleich – überdurchschnittlich hohe Produktivität je geleisteter Arbeitsstunde auf. Im Zeitraum seit dem Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 1995 bis zum Jahr 2017 liegt das Niveau rund 20% über jenem der EU-28, allerdings 6% unter dem des wichtigsten Handelspartners Deutschland. Diese Abstände haben sich im Beobachtungszeitraum von 1995 bis 2017 nicht wesentlich verändert. Das Produktivitätswachstum ist in Österreich – einem internationalen Trend folgend – von 2% vor der Wirtschafts- und Finanzkrise auf unter 1% danach zurückgegangen. Die Ergebnisse einer Shift-Share-Analyse zeigen, dass das gesamtwirtschaftliche Produktivitätswachstum durch das Wachstum innerhalb einzelner Branchen erklärt wird, während der Strukturwandel das gesamtwirtschaftliche Produktionswachstum dämpft. Branchen mit einer hohen Produktivität haben zugunsten von Branchen mit einer niedrigen Produktivität an Bedeutung verloren. Angebotsseitig wird mehr als die Hälfte des Produktivitätswachstum in Österreich von der Gesamtfaktorproduktivität getragen. Auf makroökonomischer Ebene ist ein enger Zusammenhang zwischen dem Produktivitätswachstum je geleisteter Arbeitsstunde und der Veränderung der Gewinnquote in Österreich zu beobachten. Nach einem Anstieg um 7 Prozentpunkte erreichte die Gewinnquote im Jahr 2007 mit 37% ihren Höhepunkt im Beobachtungszeitraum und ging anschließend auf 31% im Jahr 2017 zurück. Ein ähnlicher Zusammenhang ist für Profitabilitätsmaße auf Basis von Bilanzkennzahlen nicht zu erkennen.
EU-Mitgliedschaft, EU-Erweiterung und die Auswirkungen auf den österreichischen Arbeitsmarkt
Alfred Stiglbauer
Seit dem EU-Beitritt kam es in Österreich zu einem Anstieg der Beschäftigung von Personen aus den „alten“ EU-Mitgliedstaaten, seit dem Jahr 2004 und insbesondere seit 2011 zu einer deutlich stärkeren Beschäftigungszunahme aus den „neuen“ EU-Mitgliedstaaten. Diese Arbeitskräfte leisten einen bedeutenden Beitrag zum heimischen Wirtschaftswachstum. Die Zuwanderung aus den neuen EU-Mitgliedstaaten lässt sich gut durch die Größe der Herkunftsländer, ihre geografische Distanz und ihren Wohlstand relativ zu Österreich erklären. Bürgerinnen und Bürger der alten EU-Mitgliedstaaten arbeiten eher im Westen Österreichs, während jene der neuen Mitgliedstaaten vornehmlich in den östlichen Bundesländern Beschäftigung finden. Die Beschäftigten aus der EU sind überwiegend männlich, jung und gut ausgebildet. Während diejenigen aus den alten Mitgliedstaaten meist als Angestellte in akademischen und technischen Berufen tätig sind, sind die Beschäftigten aus den neuen EU-Mitgliedstaaten häufig Hilfsarbeitskräfte oder arbeiten in Dienstleistungs- und Handwerksberufen. Probit-Schätzungen ergeben, dass sich das Arbeitslosigkeitsrisiko durch die Zuwanderung aus den neuen EU-Mitgliedstaaten nur geringfügig erhöht hat. Bei einigen Gruppen von Beschäftigten (Arbeiter, Beschäftigte mit überwiegend manuellen Tätigkeiten sowie vor allem Dienstleistungs- und Verkaufsberufe) ist dieser Effekt aber höher.
Freizügigkeit des Dienstleistungsexports im EU-Binnenmarkt und Effekte auf die österreichische Wirtschaft
Erwin Kolleritsch, Patricia Walter
Wir gehen der Frage nach welche Effekte vom Beitritt Österreichs zur EU bzw. von deren Vertiefungsschritten auf die Entwicklung der Dienstleistungsexporte Österreichs ausgegangen sind. Wir finden eine hohe Persistenz der Exportbeziehungen Österreichs mit der EU, aber nur eine (relativ) beschränkte Wachstumsdynamik. Es gab relative Umschichtungen hin zu den Mitgliedsländern des Euroraums und zu den (nicht an Österreich angrenzenden) EU-Beitrittsländern. Neben impliziten Handelsbeschränkungen und einem unvollständigen Binnenmarkt prägen der frühe Aufbau von Wirtschaftsbeziehungen mit Osteuropa und die Nutzung des Niederlassungsverkehrs die Entwicklung. Wenngleich der Dienstleistungsverkehr für Österreich relativ bedeutender ist als für vergleichbare EU-Mitgliedstaaten, sind die komparativen Handelsvorteile gering. Wir finden einerseits eine relativ höhere Bedeutung des EU-Binnenmarkts für kleinbetriebliche und heimisch dominierte Unternehmen; andererseits eine relativ höhere Bedeutung von wissensbasierten und von der Sachgüterindustrie getragenen Dienstleistungsexporten in Länder außerhalb der EU. Langfristig ist der Anteil der Dienstleistungsexporte in die EU an der gesamten Wertschöpfung Österreichs gestiegen. Die abgeleiteten Endnachfragemultiplikatoren liegen jedoch unter jenen der Extra-EU-Staaten.
Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft auf ausländische Greenfield-Direktinvestitionen
Elisabeth Christen, Martin Falk
Empirische Studien zeigen, dass die EU-Mitgliedschaft und die Schaffung des Europäischen Binnenmarktes 1992 zu einer höheren Direktinvestitionstätigkeit führten. Theoretisch ist es möglich, dass die Auswirkungen der wirtschaftlichen Integration auf die ausländischen Direktinvestitionen (foreign direct investment, FDI) mit zunehmender Zahl an EU-Mitgliedstaaten im Lauf der Zeit nachlassen. In dieser Arbeit werden die Auswirkungen des EU-Beitritts auf die Greenfield-Direktinvestitionen untersucht. Dabei wird nach Sektoren (Dienstleistungen und Sachgütererzeugung) unterschieden, und es werden die unterschiedlichen Herkunftsländer berücksichtigt. Die Auswirkungen werden anhand eines FDI-Gravitationsmodells geschätzt, das Informationen über 200.000 Direktinvestitionsprojekte im Zeitraum von 2003 bis 2018 enthält. Die Ergebnisse zeigen, dass die Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft auf die Greenfield-Direktinvestitionen für Bulgarien und Rumänien groß und signifikant sind, jedoch nicht signifikant für Kroatien. Die Anzahl der angekündigten Greenfield-Direktinvestitionsprojekte österreichischer multinationaler Unternehmen in Bulgarien und Rumänien stieg in den ersten drei Jahren nach dem Beitritt um durchschnittlich 180%, die Zahl der dadurch geschaffenen Arbeitsplätze um 140%. Die größten Effekte waren bereits im Jahr vor dem Beitritt zu beobachten gewesen. Investitionen aus den Nicht-EU-Ländern sind nach dem EU-Beitritt weniger stark angestiegen. Die Ergebnisse unterscheiden sich nicht wesentlich für den Dienstleistungssektor und die Sachgütererzeugung
Die Expansion der österreichischen Banken nach Zentral-, Ost- und Südosteuropa
Meilensteine der Expansion – Rückblick und Ausblick
Stefan Kavan, Tina Wittenberger
Die großen österreichischen Banken erkannten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs früh die Chance, den margenschwachen Heimatmarkt nach Zentral-, Ost- und Südosteuropa (CESEE) zu erweitern. Bankneugründungen und -zukäufe erlaubten rasch in dieser Region fußzufassen und die Aussicht auf mögliche EU-Beitritte von CESEE-Ländern löste eine Reform- und Aufbruchstimmung aus. Die dynamische Kreditvergabe brachte hohe Gewinne mit sich, aber die schnelle Expansion hatte auch Schattenseiten. So erfolgte die Kreditvergabe oftmals in Fremdwährungen und wurde durch die Mutterbank refinanziert. Die aufgebauten Risiken wurden während der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise schlagend und führten zu hohen Kosten. Bei den Banken folgte eine Phase der Konsolidierung. Makroprudenzielle Maßnahmen zur Hintanhaltung von Risiken für die Finanzmarktstabilität waren eine wichtige Lehre aus der Krise, die auch in Österreich von der Bankenaufsicht gezogen wurde. Das in den letzten Jahren erneut einsetzende Wirtschaftswachstum verbesserte die Zahlungsfähigkeit der Kunden. Die gute Ertragslage ist aber auch dem wieder anziehenden Kreditwachstum geschuldet, das erneut systemische Herausforderungen mit sich bringt und makroprudenzielle Maßnahmen in einigen CESEE-Ländern notwendig machte. Der wirtschaftliche Aufholprozess im erweiterten Heimatmarkt österreichischer Banken bietet weiterhin ein beachtliches Wachstums- und Ertragspotenzial und die momentane Gewinnsituation und Qualität des Kreditportfolios sind gut. Allerdings bringen der vom Kreditwachstum getriebene lange Aufschwung und die einsetzende wirtschaftliche Abschwächung auch zahlreiche Herausforderungen mit sich, denen sich die betroffenen Banken und die Bankenaufsicht stellen müssen.
Anmerkung: Zeitpunkt der Erstellung vor der COVID-19-Pandemie.
Das europäische Regelwerk für Bankenaufsicht und sein institutioneller Rahmen seit dem EU-Beitritt Österreichs
Michael Kaden, Michael Boss, Markus Schwaiger
Das europäische Rahmenwerk für die Bankenaufsicht hat sich im Laufe der Zeit in Hinblick auf seine Zielsetzungen, seine legistische Herangehensweise, seine institutionelle Ausgestaltung und nicht zuletzt auch auf seine Inhalte grundlegend verändert. Zum Zeitpunkt des österreichischen EU-Beitritts stand vor allem das Ziel der Errichtung eines einheitlichen Binnenmarktes im Vordergrund. Der Fokus war auf den Abbau von Hindernissen für die Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit sowie die Herstellung einheitlicher Wettbewerbsbedingungen in den Mitgliedstaaten gerichtet. Es wurden gezielte europarechtliche Änderungen, verstreut auf mehrere Richtlinien und weitgehend ohne eine komplementäre institutionelle Komponente, normiert. Um rascher auf aktuelle Entwicklungen am Finanzmarkt reagieren zu können und die Vorteile der Euro-Einführung durch eine Integration der Finanzmärkte besser nutzen zu können, wurde zu Beginn dieses Jahrtausends mit der Schaffung spezialisierter europäischer Regulierungsgremien verstärktes Augenmerk auf einen schnelleren und flexibleren Regulierungsprozess gelegt. Gleichzeitig wurde auf Ebene des europäischen Gesetzgebers der empfundenen Normenflut und -vielfalt durch den Ansatz der Better Regulation entgegengetreten. Die Finanzkrise 2007 brachte schließlich eine bedeutende Neufokussierung der gesetzgeberischen Motive und Reichweite mit sich. Die Behebung der durch die Krise aufgedeckten Mängel in der Regulierung und das Ziel, künftig derartige Krisenszenarien möglichst zu vermeiden, dominieren seither die gesetzgeberische Tätigkeit, ohne jedoch den bisher verfolgten Zielen eine völlige Absage zu erteilen. Neben der Stärkung der Krisenfestigkeit von Instituten und des Finanzsektors als Ganzes wurde auch die Vergemeinschaftung behördlicher Tätigkeiten – gestützt auf direkt anwendbare Verordnungen – vorangetrieben und mündete in der (noch unvollendeten) Bankenunion.
Wettbewerbspolitik in Österreich im europäischen Kontext – Rückblick und Ausblick 25 Jahre nach dem EU-Beitritt
Michael Böheim
Wettbewerbspolitik stellt eine der wichtigsten Kernaufgaben der Europäischen Union dar, um die Funktionsfähigkeit des gemeinsamen Marktes nachhaltig zu gewährleisten. Im Gegensatz zu Deutschland, wo sich schon früh eine wettbewerbspolitische Tradition in Wissenschaft und Praxis entwickelte, spielte in Österreich Wettbewerbspolitik lange Zeit keine nennenswerte Rolle. Erst der Beitritt zur Europäischen Union brachte für Österreich wichtige Impulse zur Wettbewerbsbelebung. Die Übernahme des wettbewerbsrechtlichen Acquis Communautaire und der Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts erzeugten den notwendigen Druck von außen, der mit einiger Verzögerung zur Angleichung des österreichischen materiellen Wettbewerbsrechts an das Gemeinschaftsrecht und zu einer Neugestaltung der wettbewerbspolitischen Institutionenlandschaft führte. Der vormals große Einfluss der Sozialpartner wurde deutlich reduziert, ihre Mitwirkungs- und Antragsrechte in Wettbewerbsfällen beschränkt. Das Kartellgericht blieb als Entscheidungsinstanz erhalten und mit der Bundeswettbewerbsbehörde wurde 2002 eine neue Verwaltungsbehörde mit umfassenden Ermittlungs- und Aufgriffskompetenzen geschaffen. Während sich diese in der Zwischenzeit als zentrale Drehscheibe im Institutionengefüge positionieren konnte, blieb die zeitgleich etablierte Wettbewerbskommission mangels Interesses der Politik an unabhängiger wettbewerbspolitischer Beratung bisher weitgehend bedeutungslos. Gerade durch eine Stärkung der Wettbewerbskommission könnten sich allerdings wichtige Impulse zur Entwicklung einer eigenständigen wettbewerbspolitischen Gesamtstrategie („Grand Design“) in Österreich ergeben.
Langfristige Determinanten der österreichischen Inflation – die Rolle des EU-Beitritts
Teresa Messner, Fabio Rumler
In dieser Studie beschäftigen wir uns mit der Frage, ob und wie sich der Inflationsprozess in Österreich durch die Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den letzten Jahrzehnten, wie etwa aufgrund des EU-Beitritts, der Bildung der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU), der Globalisierung sowie der Finanz- und Wirtschaftskrise, verändert hat. Zu diesem Zweck werden verschiedene Spezifikationen einer erweiterten Phillips-Kurve zuerst auf Strukturbrüche getestet und anschließend für verschiedene Subperioden sowie mit zeitvariablen Koeffizienten unter Verwendung von statistischen Glättungstechniken geschätzt. Dabei werden drei signifikante Strukturbrüche gefunden: einer Mitte der 1980er-Jahre, den wir mit dem Beginn der Great Moderation – einer Phase geringer makroökonomischer Volatilität – in Verbindung bringen, ein weiterer im Jahr 1995, der mit dem EU-Beitritt Österreichs zusammenfällt und ein dritter im Jahr 2000, der den Beginn der WWU markiert. Die Subperioden- und zeitvariablen Koeffizientenschätzungen ergeben, dass es in Österreich die meiste Zeit in den vergangenen 40 Jahren eine stabile Phillips-Kurve gab. Es bestand somit ein positiver Zusammenhang zwischen Inflations- und Konjunkturentwicklung, der aber in den 1990er-Jahren vorübergehend schwächer wurde. In dieser Phase dürften externe Faktoren, wie der EU-Beitritt, die Errichtung der WWU und die Globalisierung einen stärkeren Einfluss auf die österreichische Inflation bekommen haben. Interessanterweise hatte die Geldpolitik erst ab dem Beginn der WWU einen messbaren Einfluss auf die laufende Inflationsentwicklung, was darauf hindeutet, dass die Transmission der stabilitätsorientierten Geldpolitik des Eurosystems in Österreich gut funktioniert.
Die Entwicklung des EU-Haushalts und die Auswirkungen auf Österreich
Walpurga Köhler-Töglhofer, Lukas Reiss
Der EU-Haushalt bildet die finanziellen Verflechtungen der EU mit den einzelnen EU-Mitgliedstaaten und die politischen Prioritäten der EU ab. Die Prioritäten haben sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Dies zeigt sich vor allem im sinkenden Anteil der Ausgaben für die Agrarpolitik an den Gesamtausgaben der EU. Auch die Einnahmenstruktur hat sich im Laufe der Zeit verschoben und ist aufgrund diverser Rabatte auf die Mitgliedsbeiträge komplex. Österreich ist seit seinem Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 1995 durchgehend ein Nettozahler ins EU-Budget. Als einer der größten Nettozahler profitiert Österreich allerdings seit dem Finanzrahmen 2001–2007 von einem Rabatt auf seine Mitgliedsbeiträge. Gleichzeitig erhält Österreich vergleichsweise mehr Rückflüsse aus Mitteln der Agrarpolitik als zahlreiche andere EU-Mitgliedstaaten mit hohem Bruttonationaleinkommen pro Kopf. Der – politisch noch nicht ausverhandelte – mehrjährige Finanzrahmen der EU für die Periode 2021–2027 bringt ebenfalls eine durch die neue EU-Kommission veränderte Prioritätensetzung mit sich und wird darüber hinaus stark vom Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU beeinflusst. Die bislang von der Europäischen Kommission zur Diskussion gestellten Vorschläge signalisieren insbesondere einen zunehmenden Druck auf die EU-Agrar- und Regionalpolitik zugunsten anderer Politikbereiche wie dem Wiederaufbau der EU-Volkswirtschaften nach der COVID-19-Krise und dem Klimawandel.
Wirtschaftspolitische Empfehlungen in der EU und deren Umsetzungsbilanz in Österreich
Maria Auböck, Doris Prammer
Die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Europäischen Union sind seit dem Jahr 1993 ein konstanter Parameter zur Koordinierung der Wirtschafts- und Haushaltspolitik der EU-Mitgliedstaaten. Aus ihnen werden wirtschaftspolitische Prioritäten für die einzelnen Mitgliedstaaten abgeleitet und in Form länderspezifischer Empfehlungen an jedes EU-Mitglied gerichtet. An Österreich werden vor allem Empfehlungen zur Senkung der Steuerlast auf Arbeit, zur Sicherstellung der langfristigen Tragfähigkeit des Pensionssystems, zur Verbesserung des Bildungssystems und der Anreizsysteme am Arbeitsmarkt sowie zur Erhöhung des Wettbewerbs (z. B. im Dienstleistungsbereich) gerichtet. Da die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen durch die EU-Mitgliedstaaten rechtlich nicht bindend ist, erfolgt deren Umsetzung oftmals nur in geringem Maße. Seit Beginn des Europäischen Semesters 2011 wurden in Österreich nur 5% (EU 9%) der Empfehlungen vollständig umgesetzt, während bei 9% noch keine Umsetzungsfortschritte gemacht wurden (EU 5%). Generell hoch ist die Umsetzung im Finanzsektor, wo der Marktdruck stark auf das politische Handeln Einfluss nimmt. Ähnliches gilt auch bei hohen Leistungsbilanz- und Budgetdefiziten, wo der resultierende Druck am Finanzmarkt ein Treiber für Reformen ist.
Makroökonomische Effekte der 25-jährigen EU-Mitgliedschaft Österreichs
Fritz Breuss 2
Wissenschaftliche Begutachtung: Gerhard Fenz, OeNB; Martin Schneider, OeNB
Österreich ist – zusammen mit Finnland und Schweden – vor 25 Jahren der EU beigetreten. Als Mitglied der Europäischen Freihandelsassoziation (European Free Trade Association, EFTA) hat sich Österreich über das Freihandelsabkommen mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 1973 und durch die Teilnahme am Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 1994 handelspolitisch der EU bereits zuvor stark angenähert. Österreich hat mit dem Beitritt zur EU 1995 an allen darauffolgenden vertiefenden Schritten der EU-Integration (Wirtschafts- und Währungsunion, WWU mit der Einführung des Euro; Schengener Abkommen) und an der EU-Erweiterung teilgenommen. Politisch ist Österreich durch die EU-Mitgliedschaft europäischer und moderner geworden und auch ökonomisch hat es von allen Stufen der Integration profitiert. Die Teilnahme am EU-Binnenmarkt, an der WWU mit dem Euro und an den EU-Erweiterungen hat zu einem jährlichen Anstieg des realen BIP von 0,8 Prozentpunkten beigetragen. Die größten wirtschaftlichen Impulse kamen von der Teilnahme am Binnenmarkt (+0,4 Prozentpunkte) und der EU-Erweiterung (+0,3 Prozentpunkte); die Einführung des Euro steuerte 0,1 Prozentpunkte zum jährlichen BIP-Wachstum bei. Bereits durch die Ostöffnung 1989 rückte Österreich vom Rand Europas in dessen Mitte. Die EU-Erweiterungen beginnend ab 2004 verstärkten diese Entwicklung und erlaubten Österreich eine volle Teilhabe an der „Mini-Globalisierung“ vor der Haustüre.
JEL classification: F15; C51; O52
Keywords: Europäische Integration; Modellsimulationen; Länderstudien
Österreich war – zusammen mit Finnland und Schweden – vor 25 Jahren einer EU mit zwölf Mitgliedstaaten beigetreten, die bis 2013 auf 28 Mitgliedstaaten anwuchs. Mit dem Brexit schrumpfte sie auf 27 Länder. Als EFTA-Mitglied hat sich Österreich über das Freihandelsabkommen mit der EWG 1973 und durch die Teilnahme am EWR 1994 handelspolitisch der EU bereits zuvor stark angenähert. Österreich hat mit dem Beitritt zur EU 1995 an allen darauffolgenden vertiefenden Schritten der EU-Integration (WWU mit dem Euro; Schengener Abkommen) und an der EU-Erweiterung teilgenommen. Politisch ist Österreich durch die EU-Mitgliedschaft europäischer und offener geworden und auch ökonomisch hat es von allen Stufen der Integration profitiert.
Jedes EU-Mitglied muss am Kernelement der EU-Integration, dem Binnenmarkt teilnehmen 3 . Daraus resultieren die wichtigsten ökonomischen Effekte auf den Handel und das Wirtschaftswachstum 4 . In jenen Ländern, die den Euro einführten, verstärkten sich die Binnenmarkt-Effekte zusätzlich. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 und der folgenden Ostöffnung – ein Geschenk für Österreichs Wirtschaft – und durch die schrittweise EU-Mitgliedschaft der ehemaligen Ostblockstaaten im Zuge der großen EU-Erweiterung 2004 rückte Österreich vom Rand in die Mitte Europas. Österreichs Wirtschaft erfuhr als EU-Mitglied der erweiterten Union zusätzliche Impulse in Form einer raschen Ausweitung von Handel und Direktinvestitionen.
Im vorliegenden Beitrag werden die makroökonomischen Auswirkungen der 25-jährigen EU-Mitgliedschaft Österreichs mit einem Integrationsmodell insgesamt und für die einzelnen Integrationsstufen (Binnenmarkt, WWU mit dem Euro, EU-Erweiterung) geschätzt. Als Vorstufe zur österreichischen EU-Integration werden auch die ökonomischen Folgen des historisch wichtigen Jahres 1989 beleuchtet.
1 Österreichs Weg nach Europa
Österreich war seit 1960 Mitglied der EFTA gewesen, seit 1994 im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und trat gemeinsam mit Finnland und Schweden vor 25 Jahren der EU bei. Dem EU-Beitritt ging eine intensive politische Diskussion in Österreich voraus; vor allem gab es zunächst Bedenken wegen des Status der immerwährenden Neutralität (Breuss, 1996; Gehler, 2002; Griller et al., 2015). Diese fielen mit dem Zusammenbruch des Kommunismus und dem Zerfall der Sowjetunion weg, sodass sich die österreichische Bundesregierung im Juli 1989 entschloss, einen Antrag auf den EU-Beitritt zu stellen.
Die Zweigleisigkeit der europäischen Integration in den 1960er-Jahren (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG versus EFTA) wurde durch die Freihandelsabkommen zwischen den EFTA-Mitgliedsländern und der EWG 1973 überwunden. Diese schufen bis Mitte des Jahres 1977 einen großen Freihandelsraum in Europa (zumindest für industriell-gewerbliche Waren). Der nächste Schritt zur EU-Annäherung Österreichs erfolgte mit der Teilnahme am EWR, der bereits eine Zweidrittel-Teilnahme am EU-Binnenmarkt ermöglichte. Die vollständige Liberalisierung erfolgte dann am 1. Jänner 1995 durch die Teilnahme an den vier Freiheiten des EU-Binnenmarktes (Breuss, 2020c).
Vor Beginn eines jeden Integrationsschritts wurden in der EU 5 und auch in Österreich (vor allem vom Wifo) mehrere Studien durchgeführt, um die möglichen Integrationseffekte im Voraus abzuschätzen 6 . Darin wurde eine Steigerung des Wohlstandes in Österreich von jährlich rund ½ Prozentpunkt des realen BIP prognostiziert.
Die stetige Vertiefung der EU-Integration hat die Komplexität der möglichen Integrationseffekte erhöht. Die 1968 errichtete Zollunion der EWG konnte noch mit den einfachen von Viner (1950) entwickelten theoretischen Effekten – Handelsschaffung und Handelsumlenkung – bewertet werden. Mit dem Fortschreiten der EU-Integration – Binnenmarkt (mit den vier Freiheiten) sowie die WWU und die Einführung des Euro – mussten neben reinen Handelseffekten auch andere makroökonomische Wirkungen berücksichtigt werden.
2 Eine immer engere Union?
Mit dem Beitritt zur EU kam es zur Einschränkung der nationalstaatlichen Autonomie und der Abgabe von Kompetenzen an die EU zu Gunsten einer verstärkten Mitgestaltung in der Gemeinschaft 7 . Die Teilnahme an der supranationalen Organisation Europäische Union (sie ist ein Zwitter zwischen Staatenbund und Bundesstaat, nämlich ein Staatenverbund) hatte erhebliche Änderungen der österreichischen Verfassung zur Folge (Öhlinger, 2015). Der Versuch, mittels eines Vertrags über eine Verfassung für Europa allmählich die „Vereinigten Staaten von Europa“ – ein alter Traum – zu schaffen, scheiterte an den negativen Referenden in Frankreich und den Niederlanden im Jahr 2005. Letztlich wurden aber wesentliche Bestandteile in den derzeit gültigen Vertrag von Lissabon – in Kraft seit 1. Dezember 2009 – in Form von zwei Teilverträgen (EUV und AEUV) übernommen. In der Präambel des Vertrags über die Europäische Union (EUV) wird die Finalität der EU „… Schaffung einer immer engeren Union der Völker Europas, in der die Entscheidungen entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip möglichst bürgernah getroffen werden …“ relativ vage, aber doch entschieden angesprochen. Für die Briten war diese Zielsetzung ein Schritt zu viel. Sie schätzten bei Ihrem Brexit-Referendum 2016 offensichtlich den Nutzen dieser immer stärkeren Kompetenzverschiebung nach Brüssel geringer ein als die Wiedererlangung staatlicher Autonomie („taking back control“).
Seit dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags sind die Kompetenzen zwischen der EU und den Mitgliedstaaten in drei Kategorien aufgeteilt (Artikel 3–6 AEUV):
- Ausschließliche Zuständigkeit der EU: Zollunion (Gemeinsamer Zolltarif, GZT), gemeinsame Handelspolitik (GHP), Wettbewerbspolitik für einen fairen Wettbewerb im Binnenmarkt, gemeinsame Währungs- bzw. Geldpolitik für die Euro-Länder, Abschluss internationaler Abkommen.
- Mit den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit: Binnenmarkt, Sozialpolitik, Regionalpolitik, gemeinsame Agrarpolitik (GAP), Umwelt, Energie, Verbraucherschutz, Verkehr, transeuropäische Netze (Trans-European Networks, TEN), Raum der Freiheit, Sicherheit und des Rechts, Forschungsprogramme, Entwicklungszusammenarbeit.
- Unterstützende, koordinierende oder ergänzende Zuständigkeiten der EU: Schutz und Verbesserung der menschlichen Gesundheit, Industrie, Kultur, Tourismus, Bildung, Jugend und Sport, Katastrophenschutz, Verwaltungszusammenarbeit.
Darüber hinaus koordinieren die Mitgliedstaaten ihre Wirtschaftspolitik innerhalb der Union (Art. 5 AEUV):
- Für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, gelten besondere Regelungen. Auf Grund der asymmetrischen Konstruktion der WWU (zentrale Geld- und dezentrale Fiskalpolitik) steht als Gegenpol zur zentralisierten Geldpolitik ein ganzes Arsenal (das nach der großen Rezession 2009 und der anschließenden Eurokrise noch ausgeweitet wurde) von Verfahren (u. a. das Europäische Semester) und Instrumenten (Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts, Fiskalpakt mit Pflicht zur Schuldenbremse etc.) zur Koordinierung der unterschiedlichen Fiskalpolitiken der EU- und Euro-Mitgliedstaaten zur Verfügung. Diese notwendige Koordinierung gelingt relativ gut in „Schönwetterperioden“, aber kaum in Zeiten von Krisen (große Rezession und während der Eurokrise).
- Die Union trifft Maßnahmen zur Koordinierung der Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten, insbesondere durch die Festlegung von Leitlinien für diese Politik.
- Die Union kann Initiativen zur Koordinierung der Sozialpolitik der Mitgliedstaaten ergreifen.
Besonders einschneidend ist für die Euro-Länder die Zentralisierung der Geldpolitik im Europäischen System der Zentralbanken (ESZB) und für alle EU-Mitgliedstaaten die Vergemeinschaftung der Außenhandelspolitik (GHP, GZT) und die gemeinsame Agrarpolitik (GAP). Aber auch die notwendige Koordination der Wirtschaftspolitik (vor allem der Fiskalpolitik) nötigt den Mitgliedstaaten viel politischen Goodwill ab.
Österreich hat sich nach dem EU–Beitritt an allen Schritten der Vertiefung der Union beteiligt: ein Muss ist für jedes neue Mitglied der Eintritt in den Binnenmarkt. Er gewährt die vier Freiheiten für Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeit. Österreich war auch unter den ersten elf Ländern, die 1999 die WWU gründeten und 2002 den Euro als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführten. Zwischenzeitlich sind 19 EU-Mitgliedstaaten Euro-Länder. Auch dem Schengener Abkommen trat Österreich am 28. April 1995 bei, das zum Wegfall der Grenzkontrollen mit 1. April 1998 führte. Damit ist Österreich (im Gegensatz zu Schweden, das den Euro noch nicht eingeführt hat) rein formal zu einem EU-Musterschüler avanciert. Dass es in der Praxis nicht ganz so ist, zeigt die mangelnde Umsetzung von EU-Recht (Wolfmayr, 2019; Europäische Kommission, 2018). Im Großen und Ganzen ist Österreich und seine seit 1995 wechselnden Regierungen aber recht gut mit den geänderten politischen Rahmenbedingungen als EU-Mitglied umgegangen und hat der Union viele wichtige Impulse gegeben. Nicht zuletzt hat sich Österreich mit der „Wiener Initiative“ mit den durch die Finanzkrise in Not geratenen neuen Mitgliedstaaten solidarisch gezeigt (Selmayr, 2019). Gelegentliche Ausreißer (Volksbegehren zum EU-Austritt 2015; das Andenken eines Öxit von H.-C. Strache nach dem Brexit-Referendum) sind seit dem Ringen um den Brexit aus der politischen Debatte verschwunden und werden von der Bevölkerung auch mehrheitlich abgelehnt (Schmidt, 2019).
3 Vergleich von Österreich mit Finnland und Schweden
Volkswirtschaften entwickeln sich mit und ohne EU-Mitgliedschaft. Bevor analysiert wird, wieviel von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung auf die EU-Mitgliedschaft zurückzuführen ist, lohnt ein vergleichender Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung der drei 1995 der EU beigetretenen Mitgliedstaaten Finnland, Österreich und Schweden (Tabelle 1).
| Indikator | Einheit | Österreich | Finnland | Schweden | EU-15 | Deutschland | USA | Schweiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIP real | in % | 1,60 | 1,95 | 2,23 | 1,20 | 1,11 | 2,14 | 1,57 |
| BIP real pro Kopf | in % | 1,14 | 1,62 | 1,58 | 0,93 | 1,01 | 1,25 | 0,76 |
| BIP nominell 2020 | in Mrd KKS | 344 | 184 | 371 | 13.073 | 3.029 | 14.054 | 404 |
| BIP nominell pro Kopf 20201 | in KKS | 38.602 | 33.224 | 35.804 | 31.777 | 36.380 | 42.470 | 46.485 |
| Inflation2 | in % | 1,78 | 1,37 | 1,16 | 1,74 | 1,39 | 2,14 | 0,54 |
| Arbeitslosenquote | in % | 4,82 | 9,13 | 7,60 | 8,88 | 7,24 | 5,84 | 4,13 |
| Budgetsaldo | in % des BIP | –2,51 | 0,05 | –0,21 | –2,98 | –1,87 | –5,86 | –0,34 |
| Staatsverschuldung 2020 | in % des BIP | 78,8 | 69,4 | 42,6 | 100,3 | 75,6 | 136,2 | 42,0 |
| Intra-EU-Exporte | in % | 5,99 | 3,87 | 4,05 | 4,34 | 4,97 | . | . |
| Intra-EU-Exporte 2020 | Anteil in % | 70,8 | 58,8 | 57,9 | 61,1 | 58,4 | . | . |
| Leistungsbilanz | in % des BIP | 1,19 | 2,33 | 4,82 | 1,10 | 4,15 | –3,16 | 9,61 |
| Netto-Beitrag zum EU-Haushalt3 | in % des BNE4 | –0,25 | –0,14 | –0,34 | . | –0,38 | . | . |
| Quellen: Europäische Kommission: Frühjahrsprognose 2020 (AMECO Datenbank), IMF: World Economic Outlook April 2020. | ||||||||
| 1 KKS = Kaufkraftstandard. | ||||||||
| 2 Nationaler Verbraucherpreisindex. | ||||||||
| 3 Europäische Kommission: Operating budgetary balance, Durchschnitte 1995–2108. | ||||||||
| 4 BNE= Brutto-Nationaleinkommen. | ||||||||
- Das durchschnittliche jährliche Wachstum des realen BIP zwischen 1995 und 2020 war in Österreich mit 1,6% niedriger als jenes in Finnland (2,0%) und Schweden (2,2%). In Österreich (–1,4 Prozentpunkte) und Finnland (–1,0 Prozentpunkte) war das Wirtschaftswachstum in den 25 Jahren nach dem EU-Beitritt schwächer als in den 25 Jahren zuvor. Nur Schweden (+0,3 Prozentpunkte) verbesserte sich. Während die drei 1995 beigetretenen Länder rascher als Deutschland wuchsen (Österreich +0,5%, Finnland +0,8%, Schweden +1,1%), war die BIP-Entwicklung mit Ausnahme Schwedens schwächer als in den USA.
- Österreich, Finnland und Schweden gehören (gemessen am realen BIP pro Kopf) zu den reichsten EU-Mitgliedstaaten. Gemessen am BIP pro Kopf war Österreich unter den 15 EU-Mitgliedern 1995 das zweitreichste Land der EU, Finnland lag an zehnter und Schweden an fünfter Stelle. Im Jahr 2020 liegt Österreich in der EU-27 am dritten Platz, Finnland am siebten und Schweden am sechsten Platz.
- Die Inflationsrate lag im letzten Vierteljahrhundert in Österreich mit 1,8% höher als in Finnland (1,4%) und Schweden (1,2%). In allen diesen drei Ländern ist sie gegenüber den 25 Jahren zuvor gesunken – in Finnland (–6,2%) und Schweden (–6,0%) stärker als in Österreich (–2,1%).
- Im Hinblick auf die Arbeitslosigkeit hat Österreich die beste Position. Die Arbeitslosenrate lag hier mit 4,8% im Durchschnitt wesentlich niedriger als in Finnland (9,1%) und Schweden (7,6%).
- Fiskalpolitisch fiel Österreich gegenüber Finnland und Schweden sowohl bei der Entwicklung des Budgetsaldos als auch der Staatsverschuldung zurück.
- Österreich hat bereits von der Ostöffnung 1989 stark profitiert und konnte seinen Außenhandel nach der EU-Erweiterung 2004 weiter steigern. Insgesamt hat Österreich daher seinen Intra-EU-Handel viel stärker ausgeweitet als Finnland und Schweden. Dies zeigt sich im durchschnittlichen jährlichen Zuwachs der Intra-EU-Exporte (Österreich +6,0%, Finnland +3,9%, Schweden +4,1%). Damit liegt Österreich mit einem Intra-Export-Anteil von 70,8% deutlich vor Finnland (58,8%) und Schweden (57,9%).
- Die Leistungsbilanz insgesamt hat sich in allen drei Ländern im letzten Vierteljahrhundert verbessert, am deutlichsten in Schweden (4,8% des BIP), aber auch in Finnland (2,3%) und Österreich (1,2%).
Österreich konnte – nicht zuletzt wegen der immer stärkeren Teilnahme an EU-Forschungsprogrammen – seine F&E-Quote (Forschungs- und Entwicklungsquote) bis an jene von Schweden (rund 3 ½% des BIP) anheben. Finnland ist von 3,9% im Jahr 2009 auf unter 3% zurückgefallen. Während Österreich und Finnland ab 1999 den Euro einführten, konnte Schweden durch Abwertungen der Schwedischen Krone (seit 1995 um 0,7% pro Jahr) seine internationale Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Allerdings führte gerade in Österreich die Euro-Einführung dazu, dass der zuvor starke Aufwertungstrend des Schilling gestoppt wurde.
Im Hinblick auf den Kampf gegen den Klimawandel sind die skandinavischen Länder erheblich weiter fortgeschritten als Österreich. Der CO2-Ausstoß (pro Kopf) ist von 1995 bis 2017 in Finnland um 27%, in Schweden um 38% und in Österreich nur um 0,4% gesunken. Nicht zuletzt trug die frühe Einführung einer CO2-Steuer in Finnland 1990 und in Schweden 1991 dazu bei.
Angesichts der besseren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Finnland und Schweden im Vergleich zu Österreich (Tabelle 1) verwundert es, dass fast alle Studien, die die Effekte der EU-Mitgliedschaft der drei Länder mit unterschiedlichen Schätzmethoden bewerten, für die skandinavischen Länder schlechter ausfallen als für Österreich (Tabelle 2). Ein Hauptgrund dafür dürfte sein, dass die meisten Studien die EU-Effekte ausschließlich mit Handelszuwächsen begründen. Österreich hatte – weil sein Intra-EU-Handel dynamischer verlaufen ist – in dieser Hinsicht einen Vorteil.
| Autoren | Methode | Maßstab | Zeitraum | Österreich | Finnland | Schweden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Economics (2017) | Ökonometrische Schätzungen mit 5 Indikatoren | BM BIP pro Kopf % | 1995–2015 | 2,58 | 1,71 | 1,50 |
| Felbermayr et al. (2018) | ifo-Handelsmodell | BM Wohlfahrt kum. % | 2000–2014 | 6,17 | 3,78 | 4,22 |
| Mion-Ponattu (2019) | CGE-Modell | BM Wohlfahrt kum. % | 2010–2016 | 3,92 | 2,52 | 2,80 |
| in ’t Veld (2019) | QUEST-DSGE- Modell | BM BIP, real kum %langfristig | 11,80 | 7,70 | 7,70 | |
| Oberhofer (2019) | Gravitäts- und I-O-Modell | BIP real in % pro Jahr | 1995–2014 | 0,70 | 0,30 | 0,20 |
| Breuss (2020 | Integrations- Makromodell | BIP, real % pro Jahr | 1995–2020 | 0.461(0.81)2 | 0.441 | 0.411 |
| Breuss | CGE-Modell GTAP103 | Wohlfahrt kum. % BIP | 1995–2014 | 7,9 | 3,8 | 5,3 |
| Quelle: Eigene Darstellung. | ||||||
| 1 Ergebnis des auf Handel und FDI reduzierten EU-Integrationsmodells von Kapitel 5; | ||||||
| 2 Ergebnis des vollständigen EU-Integrationsmodells von Kapitel 5; | ||||||
| 3 In den GTAP10-Simulationen (ein 10x10 Modell mit 10 Ländern und 10 Sektoren) wird unterstellt, dass der EU-Beitritt den Abbau von 20% der nichttarifären Handelshemmnisse impliziert. | ||||||
| Anmerkungen: BM = Binnenmarkt; kum = kumuliert; | ||||||
4 Integrationsmodell für Österreich
Eine Schätzung der makroökonomischen Integrationseffekte nach 25 Jahren EU-Mitgliedschaft muss die wichtigsten eingetretenen Effekte (Außenhandel, Direktinvestitionen, Wachstumsvorsprung, Beschäftigung, Preisentwicklung) erklären. Dazu wird ein kleines makroökonomisches Integrationsmodell basierend auf den aktuellen Zahlen der Europäischen Kommission (AMECO-Datenbank) mit EViews für die Periode 1995–2020 geschätzt.
Die größten Effekte des österreichischen EU-Beitritts ergeben sich aus der vollen Teilnahme am EU-Binnenmarkt 8 mit den vier Freiheiten und schlagen sich in mehr Außenhandel und Direktinvestitionen (foreign direct investment, FDI) nieder. Daneben sichert das EU-einheitliche Wettbewerbsrecht einen fairen Wettbewerb auf dem Binnenmarkt. Verschärfter Wettbewerb senkt die Preise. Als relativ reiches Land ist Österreich ein Nettozahler in den EU-Haushalt. Die Freizügigkeit der Arbeitskräfte hat auch die Netto-Migration in Österreich beeinflusst. Abbildung 1 stellt schematisch die Hauptelemente des Integrationsmodell für Österreich dar 9 . Im Anhang A finden sich die Gleichungen des vollständigen Modells.
- Handel und FDI stimulieren das BIP: Nach einer einjährigen Mitgliedschaft im EWR ab 1994 nahm Österreich ab 1995 voll am EU-Binnenmarkt teil. Damit trat Österreich seine Autonomie in der Handelspolitik an die EU ab und musste seine Außenzölle an das Niveau des gemeinsamen Zolls der EU (GZT) anpassen. Das bedeutete eine Senkung von den in der Uruguay-Runde akkordierten 10,5% auf den GZT der EU von 5,7% . Da durch das Freihandelsabkommen von 1973 und die Teilnahme am EWR zwischen Österreich und der EU (außer den Sonderregelungen im Agrarbereich) keine Zölle mehr existierten, zog die Binnenmarktteilnahme nur noch den Abbau der (restlichen) nichttarifären Handelshemmnisse (non-tariff barriers, NTB) nach sich: Wegfall der Grenzkontrollen, Vereinheitlichung der grenzüberschreitenden Warenabwicklung und Anerkennung von Standards.
Die Abschaffung aller NTB werden im Modell in den Export- und Importgleichungen (Waren und Dienstleistungen, gemessen real zu Preisen 2010) sowie in den Gleichungen für die FDI im Ausland und in Österreich durch eine Variable NTB berücksichtigt. Für die Teilnahme am EU-Binnenmarkt gilt NTBEU. Sie hatte den Wert 30 vor dem EU-Beitritt und sank ab 1995 in sechs Fünferschritten auf 0 10 . Das gilt auch für den Beitritt zur WWU und die Einführung des Euro (NTB€) ab 1999 und ab 2004 für die EU-Erweiterung (NTBERW). Damit können die Handels- und FDI-Effekte separat erfasst werden 11 . Neben den NTB-Variablen bestimmen auch Einkommens- (Y, YEU) und Wechselkurseffekte (REER) die gesamten österreichischen Exporte (X) und Importe (M) von Waren und Dienstleistungen.
Eine stärkere Teilnahme an der europäischen Integration (EU-Binnenmarkt, WWU/Euro und EU-Erweiterung) steigert durch mehr Außenhandel (Nettoexporte) und mehr Direktinvestitionen (Netto-FDI) die totale Faktorproduktivität (TFP). Diese wird zusätzlich durch die Arbeitsproduktivität (Y/E) und Forschungs- und Entwicklungsausgaben (F&E, in % des BIP) stimuliert. Neben den Produktionsfaktoren Kapital (K) und Arbeit (E), die ihrerseits von den relativen Faktorpreisen (Zinssatz R zu Löhnen W) abhängen, steigert die TFP wesentlich das reale Bruttoinlandsprodukt (Y) zu Preisen von 2010.
Österreich hat (zusammen mit Deutschland) vor der Teilnahme an der WWU (1999) und der Einführung des Euro (2002) stetig real aufgewertet, d. h. an internationaler Wettbewerbsfähigkeit verloren, da die Weichwährungsländer (in der Peripherie der EU) bei jeder Verschlechterung ihrer Leistungsbilanzen gegenüber dem Deutsche-Mark-Block abgewertet hatten. Diese Abwertungswettläufe waren eine permanente Bedrohung für den Binnenmarkt. Seit dem WWU-Beitritt hat sich dieser Nachteil gegenüber anderen EU-Mitgliedstaaten in einen Vorteil verkehrt. Die Verbesserung der relativen Wettbewerbsfähigkeit Österreichs schlug sich in einer geringeren Aufwertung des realen effektiven Wechselkurses gegenüber 37 Industriestaaten (REER) nieder. Mit einer leichten Korrektur in der Variablen REER von rund 3% zwischen 1999–2020 wird dieser positive Effekt der Einführung des Euro auf den österreichischen Außenhandel in den Simulationen der Export- und Importgleichungen berücksichtigt.
- Produktivitätsstimulierende F&E-Ausgaben: Die EU-Mitgliedschaft und auch die WWU-Teilnahme hat zu Anpassungs- bzw. Produktivitätsschocks geführt. Dieser kurzfristige Impuls wird über eine Anhebung der F&E-Ausgaben 1995 und 1999 in der F&E-Gleichung berücksichtigt. Dadurch wird die gesamte Faktorproduktivität (TFP) und damit das reale BIP-Wachstum kurzfristig gesteigert. Generell hat der EU-Beitritt dazu geführt, dass Österreich voll an allen EU-Forschungsprogrammen teilnehmen konnte. Die F&E-Ausgaben legten seit 1995 trendmäßig stark zu: von 1,5% des BIP auf 3,4% im Jahr 2020.
- Mehr Preiswettbewerb senkt Preise und dämpft das BIP-Wachstum: Der Eintritt in den Binnenmarkt erhöhte die preisliche Wettbewerbsfähigkeit, was durch einen Abschlag auf die Lohnstückkosten (Markup) in der Preisgleichung von 10% seit dem EU-Beitritt berücksichtigt wird 12 . Dadurch sinken die Verbraucherpreise; die Auswirkungen auf das BIP sind leicht negativ.
- Die Kosten des EU-Beitritts: Dem ökonomischen Gewinn stehen die Kosten des EU-Beitritts gegenüber. Sie sind allerdings wesentlich geringer als die ökonomischen Vorteile. Österreich ist als derzeit drittreichstes Land der EU (gemessen am Pro-Kopf-BIP in Kaufkraftstandards) ein Nettozahler in den EU-Haushalt. Im Durchschnitt von 1995 bis 2018 betrug der österreichische Nettobeitrag pro Jahr 0,25% des BIP 13 . Das belastet den österreichischen Staatshaushalt und die Leistungsbilanz entsprechend.
- Nettomigration: Dieser Effekt war seit dem EU-Beitritt 1995 eher bescheiden. Nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 zog es immer mehr Arbeitnehmer aus Deutschland auf den österreichischen Arbeitsmarkt. In der Simulation wird die Nettomigration von 1995 bis zur EU-Erweiterung 2004 berücksichtigt, die über dem normalen Trend lag. Einen stärkeren Zustrom gab es bei der Ostöffnung 1989 aus den Balkanstaaten. Der Befürchtung einer neuen Welle von Arbeitsmigration aus Osteuropa in Folge der EU-Erweiterung 2004 wurde mit siebenjährigen Übergangsfristen begegnet. In den Simulationen wurden bereits ab 2004 Nettomigrationszuflüsse oberhalb des normalen Trends berücksichtigt.
Als Vorläufer der europäischen Integration kann – insbesondere für Österreich – die historische Ostöffnung im Jahr 1989 angesehen werden. Die Grenzöffnung 1989 (Brait und Gehler, 2014) und die damit verbundene Ostöffnung haben Österreich bereits starke Impulse auf den Außenhandel und die Direktinvestitionen beschert. Ihre Effekte werden mit einer separaten Simulation berücksichtigt. Die Ostöffnung führte zu einer Liberalisierung im Außenhandel und bei den Direktinvestitionen und kann als Regimewechsel bezeichnet werden, weil sie die Rahmenbedingungen für die österreichischen Exporteure und Investoren änderte. Die Handelseffekte werden durch einen Term (OST) in den separaten Export- und Importgleichung berücksichtigt, der den Abbau von Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen erfasst. OST erhält den Wert 0,2 von 1989 bis 2004 und nach der ersten EU-Erweiterung bis 2012 den Wert 0,1.
Die Effekte auf die Direktinvestitionen werden mit einer Zeit-Dummy-Variable (von 1989 bis vor dem EU-Beitritt 1994) erfasst, die in die separaten Gleichungen für FDI-Ex- und Importe eingeht. Neben Handels- und Direktinvestitionseffekten führte die Öffnung Osteuropas 1989 auch zu Nettomigrationseffekten. Kurz nach dem Zusammenbruch des ehemaligen Jugoslawiens in den frühen 1990er-Jahren kam es zum größten Nettozustrom von Migranten nach Österreich. Im Integrationsmodell fließen die Nettozuwanderungsströme exogen über die Arbeitslosengleichung in das Arbeitskräfteangebot ein. Die Migration beeinflusst das Pro-Kopf-BIP, weil dadurch die Bevölkerung zunimmt.
5 Ergebnisse des Integrationsmodells
Österreich hat sich bereits im Rahmen der EFTA-Mitgliedschaft über die Liberalisierung des Handels durch das Freihandelsabkommen von 1973 stark der EU angenähert. Diese Annäherung wurde durch die einjährige Mitgliedschaft im EWR noch weiter ausgebaut. Durch die EU-Mitgliedschaft und die Teilnahme am Binnenmarkt, der Einführung des Euro und durch die EU-Erweiterung kam Österreich aber erst in den vollen Genuss des Freihandels mit den wichtigsten Handelspartnern. Vorgelagert war dieser Entwicklung das welthistorische Ereignis des Jahres 1989, als der Kommunismus zerbrach, die ehemaligen Planwirtschaften in Osteuropa zu Marktwirtschaften transformierten und sich von der Sowjetunion, die sich 1991 auflöste, emanzipierten und die Nähe zur NATO und EU suchten.
-
25 Jahre EU-Mitgliedschaft und volle Teilnahme am Binnenmarkt: Die vollständige Nutzung der Integrationseffekte durch die Beteiligung am Binnenmarkt führte zu einem Anstieg des realen BIP um 0,4 Prozentpunkte pro Jahr. Aufgrund des verschärften Wettbewerbs ging die Inflation zurück. Pro Jahr konnten 8.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, die Arbeitslosigkeit ging erheblich zurück. Die volle Teilnahme an den vier Freiheiten des EU-Binnenmarktes stimulierte den gegenseitigen Handel und die Direktinvestitionen. Die realen Exporte von Waren und Dienstleistungen stiegen kumuliert von 1995 bis 2020 um 12%; infolge der starken Wettbewerber aus den alten EU-Mitgliedstaaten nahmen die Importe aber um 23% zu. Zehn Jahre lang verbesserte sich die Leistungsbilanz, danach schwenkte sie ins Defizit (Grafik 1
14
und Tabelle 3).
Grafik 1 zeigt die Wachstumseffekte der 25-jähren EU-Mitgliedschaft Österreichs als Liniendiagramm. Es werden in die Effekte für die Ostöffnung, die Teilnahme am EU/Binnenmarkt, die Teilnahme an der WWU und dem Euro, der EU-Erweiterung sowie die Summe all dieser Effekte für den Zeitraum 1989 bis 2020 dargestellt. -
Teilnahme an der WWU und Einführung des Euro: Zusätzlich zur EU-Mitgliedschaft trugen die Teilnahme an der WWU und die Einführung des Euro nur 0,1 Prozentpunkte zum jährlichen realen BIP-Wachstum bei (Grafik 1 und Tabelle 3). Diese Ergebnisse liegen unter den Schätzungen mit der synthetischen Kontrollmethode (SKM) von Breuss (2019). Demnach führte die Einführung des Euro zu einem jährlichen BIP-Zuwachs von 0,3Prozentpunkte. McKinsey Deutschland (2012) errechnete wesentlich stärkere Effekte des Euro für die ersten zehn Jahre nach seiner Einführung: Österreich kumuliert +7,8% mehr reales BIP (ein Wachstum von 0,8% pro Jahr), gefolgt von Finnland (6,7%) und Deutschland (6,4%) und den Niederlanden (6,2%). Der Euroraum hat demnach in zehn Jahren um 3,6% zugelegt
15
.
Tabelle 3: Integrationseffekte der 25-jährigen EU-Mitgliedschaft Österreichs Reales BIP VPI Beschäftigung Arbeitslosigkeit Leistungsbilanz Budgetsaldo (Inflation) gesamt Arbeitslosenquote Anzahl in % in Mrd EUR 2010 Preise in % in % in Tsd. in Prozentpunkten in Tsd. in % des BIP in % des BIP EU-Mitgliedschaft 1995 - 25 Jahre 1995–2020 kumuliert 10,94 37,46 –1,98 5,49 237,90 –1,14 –43,21 –4,27 0,37 pro Jahr 0,44 1,50 –0,08 0,18 7,53 –0,64 –1,27 –0,97 0,44 WWU-Teilnahme 1999 - 21 Jahre 1999–2020 kumuliert 2,26 8,39 0,17 1,11 49,92 –0,24 –9,62 –1,06 0,10 pro Jahr 0,11 0,40 0,01 0,04 1,74 –0,13 –0,31 –0,15 0,11 EU-Erweiterung 2004 und 2007 - 16 Jahre 2004–2020 kumuliert 5,27 19,02 0,25 2,68 119,33 –0,53 –20,44 –1,89 0,23 pro Jahr 0,33 1,19 0,02 0,13 5,61 –0,31 –0,79 –0,55 0,32 Integrationseffekte gesamt seit 1995 - 25 Jahre 1995–2020 kumuliert 20,36 64,24 –1,78 10,09 418,45 –1,99 –72,37 –7,02 0,79 pro Jahr 0,81 2,57 –0,07 0,40 16,74 –0,96 –2,89 –1,36 0,77 Ostöffnung 1989 - 31 Jahre 1989–2020 kumuliert 2,41 8,93 0,17 1,19 53,56 –0,26 –10,28 –0,22 0,10 pro Jahr 0,08 0,29 0,01 0,03 1,34 –0,10 –0,23 0,41 0,08 Quelle: Eigene Berechnungen.
Nach hier vorliegenden Berechnungen sind durch die Teilnahme an der WWU und der Einführung des Euro die realen Exporte seit 1999 kumuliert um 6%, die Importe um 9% gestiegen. Die Leistungsbilanz hat sich in den ersten zehn Jahren verbessert, seither leicht verschlechtert.
- EU-Erweiterung 2004: Die EU-Erweiterung ergänzte den bereits bestehenden Vorteil durch die Ostöffnung für Österreich 16 . Das reale BIP konnte zusätzlich um 0,3 Prozentpunkte pro Jahr gesteigert werden. Die meisten Studien zur EU-Erweiterung finden eine 1:10-Regel. Das bedeutet, dass die Wohlfahrtsgewinne der neuen EU-Mitgliedstaaten zehnmal höher sind als die der alten EU-Mitgliedstaaten (Breuss, 2002; ähnlich Levchenko und Zhang, 2012 17 ). Die österreichischen Exporte stiegen durch die EU-Erweiterung seit 2004 real kumuliert um 10%, die Importe um 14%. Der anfänglichen Verbesserung der Leistungsbilanz folgte im Zuge der zunehmenden Konkurrenz aus den neuen Mitgliedstaaten eine Verschlechterung.
- Gesamteffekte von 25 Jahren EU-Mitgliedschaft: Eine Bewertung von 25 Jahren EU-Mitgliedschaft umfasst für Österreich drei Stufen der EU-Integration: Teilnahme am Binnenmarkt, an der WWU/Euro und an der EU-Erweiterung. Eine separate Berechnung dieses Gesamtpakets ergibt folgende Effekte für Österreich: das reale BIP stieg kumuliert seit 1995 um rund 20%, jährlich um 0,8%. Pro Kopf und Jahr ist die österreichische Bevölkerung um 7.100 EUR (zu Preisen von 2010) reicher geworden. Es konnten kumuliert rund 420.000 Arbeitsplätze geschaffen werden 18 . Die Inflation sank jährlich um rund 1∕₁₀ Prozentpunkt. Die Leistungsbilanz verbesserte sich durch die EU-Integration anfänglich stark. In den letzten Jahren schwächte sich diese Tendenz ab. Trotz seiner Position als EU-Nettozahler konnte Österreich seinen Staatshaushalt verbessern. Die realen Exporte stiegen kumuliert um 31%, die Importe um 55%, was im Durchschnitt (Ex- und Importe) einem zusätzlichen Handelsvolumen von 43% entspricht 19 . Die FDI-Bestände Österreichs im Ausland verbesserten sich kumuliert um 48% des BIP, jene der Ausländer im Inland um 36% des BIP. Die Wohlfahrt (BIP pro Kopf und Jahr) verbesserte sich in Österreich kumuliert um 7.100 EUR (zu Preisen von 2010) bzw. um 14.600 USD pro Kopf (zu Preisen und Kaufkraftstandards von 2011).
Von allen drei Stufen der europäischen Integration hat die Teilnahme am Binnenmarkt (inklusive WWU/Euro) Österreichs Wirtschaft am nachhaltigsten stimuliert 20 .
Der Verlauf der Wachstumseffekte in Grafik 1 zeigt, dass jeweils nach einem Integrationsschritt die Effekte zunehmen und anschließend abklingen (sinkende Grenzerträge der Integration). Zu einer Dämpfung hat die große Rezession 2009 und die folgende Krise des Euroraums beigetragen. Der Wachstumsimpuls der Ostöffnung wurde durch jenen der EU-Erweiterung abgelöst. Insgesamt haben sich die Wachstumsimpulse durch die EU-Integration nach der Lösung der Eurokrise wieder stabilisiert.
Die Plausibilität der hier vorgelegten Modellergebnisse wird bestätigt, wenn man die Wirtschaftsleistung Österreichs mit jener anderer Länder innerhalb oder außerhalb der EU vergleicht (Tabelle 1). Diese Wachstumsdividende ist, wenn überhaupt, schwer zu erklären, wenn man von den Integrationseffekten der Beteiligung Österreichs an allen politischen Schritten der EU abstrahiert.
- Ostöffnung: Die Grenzöffnung 1989 war ein Glücksfall für die österreichische Wirtschaft. Dieses historische Ereignis rückte Österreich politisch und ökonomisch vom Rand ins Zentrum Europas. Österreichs hat diese neuen Chancen für Handel und ausländische Direktinvestitionen schnell genutzt. Dabei half sicherlich auch der Effekt der vergangenen Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Die Ostöffnung führte zu einem jährlichen Anstieg des realen BIP um rund 0,1% , schuf zusätzliche Arbeitsplätze und verringerte die Arbeitslosigkeit. Die Leistungsbilanzposition verbesserte sich (Grafik 1 und Tabelle 3). Die realen Exporte und Importe stiegen seit 1989 jeweils kumuliert um 8% 21 .
6 Schlussfolgerungen und Ausblick
Mit dem EU-Beitritt hat Österreich nicht nur seinen Wohlstand gesteigert, es war auch von allen Krisen der EU betroffen. Die „Schönwetterperiode“ in der EU und im Euroraum endete mit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise und der folgenden großen Rezession 2009. Interessanterweise hat dies die EU und ihre Mitgliedstaaten viel schwerer getroffen als das Verursacherland, die USA (Breuss, 2017). Insgesamt gibt es auch ein sogenanntes EU-Integrationsrätsel (Breuss, 2014). Es besteht darin, dass schwer zu erklären ist, warum die EU, die nach Schaffung der Zollunion 1968 sich integrationspolitisch stetig vertiefte (Binnenmarkt, Euro) und erweiterte, im Durchschnitt kein höheres Wirtschaftswachstum erzielen konnte als die USA, die seit dem Zweiten Weltkrieg unverändert organisiert waren. Das widerspricht allen Voraussagen der diversen Integrationstheorien.
Während die EU im Durchschnitt also insgesamt keine (Andersen et al., 2019) oder nur geringe (Breuss, 2018b) Wachstumsimpulse erzielen konnte, trifft dies auf einzelne Länder, die der EU beitraten, nicht zu. Das gilt sowohl für Österreich (+0,8 Prozentpunkte) als auch für Finnland und Schweden (Tabelle 2).
Trotz des positiven Urteils über die letzten 25 Jahre, muss man davon ausgehen, dass die besten Jahre der österreichischen EU-Mitgliedschaft bereits hinter uns liegen (Breuss, 2020a, 2020b). Selbst wenn man in Betracht zieht, dass durch eine volle Ausschöpfung des Binnenmarktpotenzials (Wolfmayr, 2019) das Realeinkommen noch rund ½ Prozentpunkt höher liegen könnte, geben vier Entwicklungen Anlass zur Annahme, dass für Österreichs Wirtschaft in naher Zukunft kaum wesentliche neue Integrationsimpulse zu erwarten sind:
Erstens der Ausfall der Ostdynamik: Bisher sind die neuen EU-Mitgliedstaaten in Zentral-und Osteuropa immer rascher gewachsen als die alten. Das war auch im Sinne des notwendigen Aufholprozesses an die reichen Weststaaten notwendig. Mit Ausnahme Polens, das die große Rezession 2009 ohne Wachstumseinbruch überstanden hatte, mussten alle neuen EU-Mitgliedstaaten 2009 (ganz besonders dramatisch in den baltischen Staaten) einen viel stärkeren Rückgang des Wirtschaftswachstums hinnehmen als die alten Mitgliedstaaten. Die jüngsten Prognosen deuten allerdings darauf hin, dass sich die Wachstumsraten der neuen EU-Mitgliedstaaten langsam an jene der alten anpassen. Die Ostdynamik, die vor allem der österreichischen Außenwirtschaft starken Auftrieb gab, wird sich deutlich verlangsamen. Betrug der Wachstumsvorsprung der 13 neuen EU-Mitgliedstaaten gegenüber den alten von 2004 bis 2019 noch 2,2 Prozentpunkte, so wird er in den kommenden Jahren auf 1,8 schrumpfen.
Die Verlangsamung der Ostdynamik spiegelt sich auch in einer Abflachung der Außenhandelsdynamik wider. Die Exporte steigen langsamer als die Importe. Der österreichische Handelsbilanzüberschuss mit den neuen EU-Mitgliedstaaten ist seit 2009 rückläufig. Ähnliches gilt für die Entwicklung der Direktinvestitionen. Österreichs Unternehmen waren nach der Ostöffnung rasch in den neuen Märkten Zentral- und Osteuropas mit Direktinvestitionen aktiv. Nach der großen Rezession 2009 nahm die Zunahme an aktiven FDI in den neuen EU-Mitgliedstaaten ab, mit Ausnahme von Polen. Dort steigen die österreichischen FDI absolut und relativ zu den gesamten Beständen an FDI-Importen. Auch eine EU-Erweiterung um die restlichen Balkanstaaten wird den Ausfall Großbritanniens nicht kompensieren können (Breuss, 2018a).
Zweitens kann man kaum neue Impulse für den Außenhandel und das Wirtschaftswachstum bei einer allfälligen Ausdehnung des Euroraums erwarten. Selbst wenn in naher Zukunft der Euro in allen EU-Mitgliedstaaten eingeführt werden würde (Breuss, 2019), würde der Euroraum nur um – mit Ausnahme Polens – eher kleine Länder (Bulgarien, Dänemark, Kroatien, Polen, Tschechien, Rumänien, Schweden und Ungarn) erweitert werden, sodass nur unwesentliche Wachstumseffekte ausgelöst werden könnten.
Drittens sind die möglichen Kosten, die mit dem endgültigen Brexit – hart oder weich – verbunden sein können, nicht zu unterschätzen. Selbst bei einem weichen Brexit mit einem umfassenden Handelsabkommen mit der EU kommt es – zwar zu einer minimalen, aber immerhin – zu einer Dämpfung der Wirtschaftsentwicklung in den restlichen 27 EU-Mitgliedstaaten. Zudem dürfte dies Einschränkungen im EU-Haushalt mit sich bringen. Die Lücke, die der Nettozahler Großbritannien hinterlässt, muss entweder durch Einsparungen oder Mehrzahlungen im mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021–2027 der EU kompensiert werden. Insbesondere wenn man an das ehrgeizige Programm des Green Deals der neuen EU-Kommission (Von der Leyen, 2019) denkt, das 1 Billion EUR für die Umgestaltung (Dekarbonisierung) der europäischen Wirtschaft bis zum Jahr 2050 vorsieht.
Viertens dürfte die Corona-Krise nicht nur eine schwere Rezession im Jahr 2020 zur Folge haben, sondern auch den europäischen Integrationsprozess maßgeblich bremsen.
Anhang A: Geschätztes Integrationsmodell für Österreich 1995–2020
BIP, real (Cobb-Douglas-Produktionsfunktion; Mrd. EUR zu Preisen von 2010)
GDPR = (TFP) * ( (K^0.26) * (EE^0.74) )
Gesamte Faktorproduktivität (TFP)
DLOG(TFP) = - 0.0115513602064 + 0.00343489045653 * RAD + 0.980468755002 * DLOG(AP) + 0.000205561263848 * D(XGSR - MGSR) + 0.000191728249692 * D(FDISOUT - FDISIN)
F&E (in % des BIP)
RAD = 0.00543703513179 * LOG(GDPR) + 0.948217360421 * RAD(-1) + 0.06309481172 * T_RAD_1960_2021
Privater Konsumdeflator (2010=100)
DLOG(PCN) = 0.973345280023 * DLOG(CPI) - 0.00710155715314 * D_2002
VPI (nationale Definition; 2010=100)
DLOG(CPI) = 0.00559135702408 + 0.205883461631 * MARKUP * DLOG(ULC) + 0.237529163211 * MARKUP * DLOG(PM) + 0.43120071218 * DLOG(CPI(-1)) + 0.0154653606767 * D_1984
HVPI (2015=100)
DLOG(HICP) = 0.988146178238 * DLOG(CPI)
BIP-Deflator (2010=100)
DLOG(PGDP) = 0.921837196067 * DLOG(CPI) + 0.401225862217 * DLOG(PX) - 0.288713045394 * DLOG(PM)
Löhne und Gehälter pro Beschäftigte (Phillips curve)
DLOG(WE) = - 0.00144743531813 + 0.60314981739 * DLOG(CPI) + 0.231489831239 * DLOG(AP(-1)) + 0.0665357832197 * 1 / U - 0.0239259147163 * D_1980
Löhne und Gehälter (Mrd. EUR)
WN = (WE * E) / 1000
Zinssätze, kurzfristige für Eurozone in % (Taylor-Regel)
RSH_EA19 = 2 + @pc(HICP_EA19) + 0.5 * (@pc(HICP_EA19) - 2.0) + 0.5 * (@pc(GDPR_EA19) - 1.5)
Zinssätze, kurzfristig für Österreich (%)
RSH = 0.2813195042 + 0.909901586304 * RSH_EA19 - 4.45121787297 * D_1973 + 2.76474757889 * D_1978
Zinssätze, langfristig kurzfristig für Österreich in %
RLH = 0.225015979932 * RSH + 0.143006702322 * DLOG(CPI) * 100 + 0.743335335312 * RLH(-1)
Nachfrage nach Kapital, real (Mrd. EURl zu Preisen von 2010)
DLOG(K) = 0.000335532315786 + 0.000521308221411 * D(BUD) - 0.000363147344055 * PRDEF + 0.116291490499 * DLOG(GDPR) + 0.0002415867123 * D(DLOG(WE) * 100 - (RLH - DLOG(PGDP) * 100)) + 0.874359058305 * DLOG(K(-1))
Kapitalkoeffizient (K/Y)
KY = (K / GDPR)
Nachfrage nach Arbeit (Gesamtbeschäftigung in 1.000 Personen)
DLOG(EE) = 0.174282710432 * DLOG(GDPR) - 0.0648226270585 * DLOG(WE) + 0.00181138757852 * D(BUD) + 0.712691222869 * DLOG(EE(-1))
Unselbständig Beschäftigte (in 1.000 Personen)
DLOG(E) = - 0.00172975608038 + 0.792494447278 * DLOG(EE) + 0.167695322004 * DLOG(GDPR) + 0.260455670288 * DLOG(E(-1))
Arbeitsangebot (in 1.000 Personen)
LS = EE + US
Arbeitsproduktivität (Gesamtwirtschaft)
AP = (GDPR / EE)
Lohnstückkosten
ULC = (WN / GDPR)
Arbeitslosenquote in % (Okuns Gesetz)
D(U) = 0.0899290856351 - 6.57851403943 * DLOG(GDPR) + 0.00137828071958 * D(POP - MIGR_OST89 - MIGR_EU95 - MIGR_EUEW04) - 0.0396818448546 * BUD + 0.690466863733 * D_1981
Arbeitslosigkeit (in 1000 Personen)
US = ( (U * LS) / 100 )
Exporte von Gütern und Dienstleistungen gesamt, real (zu Preisen von 2010)
LOG(XGSR) = - 14.4504818744 + 1.9915543252 * LOG(GDPR_EU28) - 0.390799429609 * NTBEU / 100 - 0.19513552264 * NTBEUR / 100 - 0.307095611781 * NTBERW / 100 - 0.112788237886 * LOG(REER_IC37)
Exporte von Gütern und Dienstleistungen gesamt, nominell (Mrd. EUR)
XGSN = XGSR * (PX / 100)
Exportquote (in % des BIP)
XQUOTA = (XGSN / GDPN) * 100
Importe von Gütern und Dienstleistungen gesamt, real (zu Preisen von 2010)
LOG(MGSR) = - 5.21774023861 + 1.80352291311 * LOG(GDPR) - 0.0665619172878 * NTBEU / 100 - 0.150426467896 * NTBEUR / 100 - 0.134041596563 * NTBERW / 100 + 0.0449696756976 * LOG(REER_IC37)
Importe von Gütern und Dienstleistungen gesamt, nominell (Mrd. EUR)
MGSN = MGSR * (PM / 100)
Importquote (in % des BIP)
MQUOTA = (MGSN / GDPN) * 100
Leistungsbilanz, nominell (Mrd. EUR; AMECO)
CA = XGSN - MGSN
Leistungsbilanz in % des BIP (AMECO)
CAGDPN = ( ( XGSN - MGSN ) / GDPN) * 100
Leistungsbilanz, nominell (Mrd. EUR; OeNB)
CA_OeNB = CA - CA_Diff_to_OeNB
Leistungsbilanz in % des BIP (OeNB)
CA_OeNBGDPN = ( ( CA_OeNB) / GDPN ) * 100
Leistungsbilanz in % des BIP (OeNB) ohne Nettozahlungen an den EU-Haushalt
CA_OeNBGDPNNET = CA_OENBGDPN - NETEU
FDI-Exportströme in % des BIP
FDIEX = 0.703968274259 + 0.741382771715 * D(FDISOUT)
FDI-Exportbestände in % des BIP
FDISOUT = 14.304433363 + 0.00014808669276 * GDPR_EU28 - 11.7312176306 * NTBEU / 100 - 9.21771473506 * NTBEUR / 100 - 28.7059040904 * NTBERW / 100 + 0.688135856646 * FDISOUT(-1)
@ADD FDISOUT FDISOUT_A
'
FDI-Importströme in % des BIP
FDIIN = 0.725996441314 + 0.439090477198 * D(FDISIN)
FDI-Importbestände in % des BIP
FDISIN = 11.6701989236 + 0.0117185993352 * GDPR - 6.10296354243 * NTBEU / 100 - 13.7055564787 * NTBEUR / 100 - 19.4658892546 * NTBERW / 100 + 0.653910055198 * FDISIN(-1)
Verfügbares persönliches Einkommen der Privathaushalte, nominell (Mrd. EUR)
YDN = 2.35636745533 + 0.0759779943024 * GDPN + 0.881837747918 * YDN(-1) + 4.96323529651 * D_2005
Verfügbares persönliches Einkommen der Privathaushalte, real (Mrd. EUR)
YDR = (YDN / (PCN / 100))
BIP, nominell (Mrd. EUR)
GDPN = (GDPR * (PGDP / 100))
BIP, real pro Kopf (in 1.000 EUR zu Preisen von 2010; AMECO) – Wohlfahrtsmaß 1
GDPRPC = ( (GDPR * 1000) / (POP - MIGR_OST89 - MIGR_EU95 - MIGR_EUEW04) )
BIP, real pro Kopf (in 1000 KKP zu USD-Preisen von 2011; Penn World Table 9.1) – Wohlfahrtsmaß 2
LOG(GDPPCPPP$) = - 2.58963785105 + 1.74146931255 * LOG(GDPRPC) - 0.0825262148723 * D_2007
Budgetsaldo Gesamtstaat (Net-Lending in % des BIP)
BUD = - 1.08904308859 + 0.308961287997 * DLOG(GDPR) * 100 - 0.473192047278 * ELEC + 0.742733243961 * BUD(-1) - 3.22284182454 * D_2004
Budgetsaldo Gesamtstaat in % des BIP inkl. Nettozahlungen an den EU-Haushalt
BUDNET = BUD - NETEU
Österreichische Nettozahlungen an den EU-Haushalt (Mrd. EUR)
NETEUABS = (NETEU * GDPN) / 100
Staatsschuldendynamik: Brutto-Staatsschuld in % des BIP
DEBT = DEBT(-1) - PRDEF + SNOW + SF
Primärsaldo des Staatshaushalts in % des BIP
PRDEF = BUD + INTEREST
Zinszahlungen des Staates in % des BIP
INTEREST = - 0.0632261236689 + 9.19806662511 * (RLH / 100) * ((DEBT(-1)) / GDPN(-1)) + 0.956786618317 * INTEREST(-1)
Schneeball-Effekt in % des BIP
SNOW = 0.464617030002 + 0.00694800310066 * (RLH - DLOG(GDPN) * 100) * DEBT(-1)
Lohnquote in % des BIP
LQ = 12.6049410926 - 0.0268023693165 * (XQUOTA + MQUOTA) - 0.0434597223178 * D(FDISOUT + FDISIN) + 0.818198250529 * LQ(-1) + 3.73678321626 * D_1975
DLOG(Variable) = %-Veränderung. D_Jahr = Dummy-Variable. Schätzungen mit EViews 9.0 für die Period 1960-2020. Datenquelle: AMECO-Datenbasis der Europäischen Kommission (Leistungsbilanz- und FDI-Daten: OeNB). NTBEU (NTBEUR, NTBERW) = nicht-tarifarische Handelshemmnisse im EU-Binnenmarkt (WWU/Euro, EU-Erweiterung).
Anhang B: Modellinputs für 3 Integrationsszenarien: EU/Binnenmarkt, WWU/Euro und EU-Erweiterung
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/Binnenmarkt 1995 | WWU/Euro 1999 | EU-Erweiterung 2004 | |||||||
| NTBEU | MARKUP | RAD | NETEU | MIGR_EU95 | NTBEUR | REER_IC37 | NTBERW | MIGR_EUEW04 | |
| 1989 | 30 | 1 | 1,55 | 0,00 | 0 | 30 | 103,41 | 30 | 0 |
| 1990 | 30 | 1 | 1,60 | 0,00 | 0 | 30 | 102,57 | 30 | 0 |
| 1991 | 30 | 1 | 1,65 | 0,00 | 0 | 30 | 102,08 | 30 | 0 |
| 1992 | 30 | 1 | 1,70 | 0,00 | 0 | 30 | 103,25 | 30 | 0 |
| 1993 | 30 | 1 | 1,75 | 0,00 | 0 | 30 | 109,49 | 30 | 0 |
| 1994 | 30 | 1 | 1,80 | 0,00 | 0 | 30 | 111,96 | 30 | 0 |
| 1995 | 25 | 1 | 1,86 | –0,44 | –2 | 30 | 113,88 | 30 | 0 |
| 1996 | 20 | 1 | 1,91 | –0,15 | 0 | 30 | 109,19 | 30 | 0 |
| 1997 | 15 | 1 | 1,96 | –0,44 | –2 | 30 | 103,98 | 30 | 0 |
| 1998 | 10 | 1 | 2,01 | –0,34 | 4 | 30 | 103,31 | 30 | 0 |
| 1999 | 5 | 1 | 2,06 | –0,33 | 15 | 25 | 101,59 | 30 | 0 |
| 2000 | 0 | 1 | 2,11 | –0,20 | 13 | 20 | 97,35 | 30 | 0 |
| 2001 | 0 | 1 | 2,16 | –0,25 | 33 | 15 | 97,48 | 30 | 0 |
| 2002 | 0 | 1 | 2,22 | –0,09 | 29 | 10 | 97,68 | 30 | 0 |
| 2003 | 0 | 1 | 2,27 | –0,14 | 36 | 5 | 100,25 | 30 | 0 |
| 2004 | 0 | 1 | 2,32 | –0,15 | 0 | 0 | 100,35 | 25 | 33 |
| 2005 | 0 | 1 | 2,37 | –0,11 | 0 | 0 | 99,42 | 20 | 26 |
| 2006 | 0 | 1 | 2,42 | –0,11 | 0 | 0 | 100,21 | 15 | 6 |
| 2007 | 0 | 1 | 2,47 | –0,20 | 0 | 0 | 101,38 | 10 | 7 |
| 2008 | 0 | 1 | 2,52 | –0,12 | 0 | 0 | 101,94 | 5 | 7 |
| 2009 | 0 | 1 | 2,58 | –0,14 | 0 | 0 | 104,11 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 1 | 2,63 | –0,23 | 0 | 0 | 101,80 | 0 | 3 |
| 2011 | 0 | 1 | 2,68 | –0,26 | 0 | 0 | 101,73 | 0 | 13 |
| 2012 | 0 | 1 | 2,73 | –0,34 | 0 | 0 | 101,16 | 0 | 26 |
| 2013 | 0 | 1 | 2,78 | –0,39 | 0 | 0 | 104,28 | 0 | 20 |
| 2014 | 0 | 1 | 2,83 | –0,38 | 0 | 0 | 105,16 | 0 | 30 |
| 2015 | 0 | 1 | 2,89 | –0,25 | 0 | 0 | 103,80 | 0 | 30 |
| 2016 | 0 | 1 | 2,94 | –0,28 | 0 | 0 | 103,88 | 0 | 30 |
| 2017 | 0 | 1 | 2,99 | –0,25 | 0 | 0 | 104,19 | 0 | 26 |
| 2018 | 0 | 1 | 3,04 | –0,35 | 0 | 0 | 105,10 | 0 | 17 |
| 2019 | 0 | 1 | 3,09 | –0,40 | 0 | 0 | 103,68 | 0 | 17 |
| 2020 | 0 | 1 | 3,14 | –0,50 | 0 | 0 | 102,20 | 0 | 17 |
| Ohne Effekte: | immer 30 | ab 1995 1,1 | 1995 1,36 | 0,00 | 0 | immer 30 | immer 30 | 0 | |
| EU/Euro/EU-Erweiterung | 1999 1,39 | ab 1999 1–4% weniger | |||||||
| Quelle: Eigene Berechnungen. | |||||||||
| Anmerkung: NTBEU (NTBEUR, NTBERW) = nichttarifäre Handelshemmnisse im EU-Binnenmarkt (WWU/Euro, EU-Erweiterung) in den Handels- und FDI-Gleichungen; MARKUP = Preisaufschlag in Preisgleichungen; NETEU = Nettobeitrag Österreichs zum EU-Haushalt in % des BIP; MIGR_EU95 = Netto-Immigration nach dem österreichischem EU-Beitritt 1995; REER_IC37 = Index des realen effektiven Wechselkurs (Euro vis á vis 37 Industriestaaten; 2015=100); MIGR_EUEW04 = Netto-Immigration nach den EU-Erweiterungen ab 2004. | |||||||||
Literaturverzeichnis
Andersen, T.B., M. Barslund and P. Vanhuysse. 2019. Join to Prosper? An Empirical Analysis of EU Membership and Economic Growth. In: KYKLOS 72 (2), May 2019. 211–238.
Badinger, H. and F. Breuss 2005. Has Austria’s Accession to the EU Triggered an Increase in Competition? A Sectoral Markup Study. In: Empirica 32 (2). June 2005. 145–180.
Badinger, H. and F. Breuss. 2011. The Quantitative Effects of European Post-War Economic Integration. In: Jovanovic, M. N. (Ed.). International Handbook on the Economics of Integration. Volume III: Factor Mobility, Agriculture, Environment and Quantitative Studies. Cheltenham UK and Northampton MA, USA. Edward Elgar. 285–315.
Beer, C., C.A. Belabed, A. Breitenfellner, C. Ragacs und B. Weber. 2017. Österreich und die europäische Integration. In: Monetary Policy & the Economy Q1/2017. 86–125.
Brait, A. und M. Gehler (Hg). 2014. Grenzöffnung 1989. Innen- und außenperspektiven und die Folgen für Österreich. Böhlau-Verlag. Wien-Köln-Weimar.
Breuss, F. 1996. Austria's Approach towards the European Union. IEF Working Paper 18. April 1996.
Breuss, F. 2002. Benefits and Dangers of EU Enlargement. In: Empirica 29 (3).245274.
Breuss, F. 2010. Globalisation, EU Enlargement and Income Distribution. In: International Journal of Public Policy 6 (1-2). 16–34.
Breuss, F. 2012. EU-Mitgliedschaft Österreichs. Eine Evaluierung in Zeiten der Krise. WIFO, Wien. http://www.wifo.ac.at/wwa/pubid/45578.
Breuss, F. 2014. Das „EU-Integrationspuzzle“. In: Ökonomenstimme. 20. August 2014.
Breuss, F. 2016. A Prototype Model of European Integration: The Case of Austria. In: Birgit Bednar-Friedl, B. and J. Kleinert (Eds.). Dynamic Approaches to Global Economic Challenges, Festschrift in Honor of Karl Farmer. Springer-Verlag, Heidelberg-New York-Dordrecht-London. 9–30.
Breuss, F. 2017. The United States-Euro Area Growth Gap Puzzle. WIFO Working Papers 541. September 2017.
Breuss, F. 2018a. Die Globalisierungs- und Erweiterungsstrategie der EU. In: Wirtschaftspolitische Blätter 65 (3). 343–358.
Breuss, F. 2018b. 25 Years Single Market: Which Trade and Growth Effects? WIFO Working Papers 572. November 2018.
Breuss, F. 2019. 20 Jahre Euro: eine Währung für alle? ÖGfE Policy Brief 6/2019, 27. März 2019.
Breuss, F. 2020a. 25 Jahre EU-Mitgliedschaft Österreichs – eine makroökonomische Bewertung. ÖGfE Policy Brief 1/2020. 8. Jänner 2020.
Breuss, F. 2020b. Was kann Österreich nach 25 Jahren erfolgreicher EU-Mitgliedschaft noch erwarten? In: Europäische Rundschau 1/2020, 2732.
Breuss, F. 2020c. Die Europäische Union als Prosperitätsgemeinschaft. In: Müller-Graff P.-C. (Hrsg.) Kernelemente europäischer Integration, Schriftenreihe des Arbeitskreises Europäische Integration e.V. Band 100. Berlin.
Breuss, F., G. Fink and S. Griller (Eds.). 2008. Services Liberalisation in the Internal Market. Springer. Wien-New York.
Breuss, F., K. Kratena und F. Schebeck. 1994. Effekte eines EU-Beitritts für die Gesamtwirtschaft und für die einzelnen Sektoren. WIFO-Monatsberichte Sonderheft: Österreich in der Europäischen Union: Anforderungen und Chancen für die Wirtschaft. Wien. Juni 1994.18–33.
Breuss, F. and F. Schebeck. 1989. Die Vollendung des EG-Binnenmarktes. Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen für Österreich. Makroökonomische Modellsimulationen. WIFO-Gutachten. Wien. März 1989.
Cecchini-Bericht 1988. Europa '92. Der Vorteil des Binnenmarkts. Autoren: Catinat, M., P. Cecchinia und A. Jacquemin. Nomos-Verlag. Baden-Baden. 1988.
Europäische Kommission. 1990. One market, one Money: An evaluation of the potential benefits and costs of forming an economic and monetary. European Economy. Brussels 44, October 1990.
Europäische Kommission. 2018. Commission report and factsheets on monitoring the application of EU law: https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-report-and-factsheets-monitoring-application-eu-law_en.
Felbermayr, G., J. Gröschl and I. Heiland. 2018. Undoing Europe in a New Quantitative Trade Model. ifo Working Papers 250. January 2018.
Gehler, M. 2002. Der lange Weg nach Europa. Österreich vom Ende der Monarchie bis zur EU. Studien-Verlag. Innsbruck.
Griller, S., A. Kahl, B. Kneihs und W. Obwexer (Hrsg.). 2015. 20 Jahre EU-Mitgliedschaft Österreichs. Verlag Österreich. 2015.
in ’t Veld, J. (2019). The economic benefits of the EU Single Market in goods and services. In: Journal of Policy Modeling, 41 (5). 803-818.
Levchenko, A.A and Zhang, J. 2012. Comparative Advantage and the Welfare Impact of European Integration. NBER Working Paper 18061. May 2012.
London Economics. 2017. The EU Single Market: Impact on Member States. Study commissioned by the American Chamber of Commerce to the EU (AmCham), London.
McKinsey Germany. 2012. The Future of the Euro: An economic perspective on the eurozone crisis. McKinsey & Company. Frankfurt. 2012.
Mion, G. and D. Ponattu. 2019. Estimating economic benefits of the Single Market for European countries and regions. Policy Paper Bertelsmann Stiftung. Gütersloh. May 2019.
Oberhofer, H. 2019. Die Handelseffekte von Österreichs EU-Mitgliedschaft und des Europäischen Binnenmarktes. WIFO-Monatsberichte 92 (12), 883–890.
Öhlinger, T. 2015. Staatlichkeit zwischen Integration und Souveränität. In: Griller et al. 2015. 111–147.
Schmidt, P. 2019. 25 Jahre EU-Beitritt – der ‚Öxit‘ ist ein Fremdwort. In: Der Standard, 31. Dezember/1. Jänner 2020, 35.
Selmayr, M. 2019. Österreich in der EU – ein Gewinn für Europa. In: Der Standard, 31. Dezember/1. Jänner 2020, 35.
Viner, J. 1950. The customs union issue, Carnegie Endowment for International Peace. New York. 1950.
Von der Leyen, U. 2019. Eine Union, die mehr erreichen will. Meine Agenda für Europa. Politische Leitlinien für die künftige Europäische Kommission 2019–2024. Brüssel, November 2019.
Wolfmayr, Y. 2019. Ungenutzte Handels- und Wohlfahrtspotentiale des Europäischen Binnenmarktes für Waren. WIFO-Monatsberichte 92 (12). 890–906.
2 WIFO, Fritz.Breuss@wu.ac.at; Fritz.Breuss@wifo.ac.at. Dieser Beitrag wurde noch vor dem Ausbruch der COVID-19-Krise verfasst.
3 Die Vollendung des EU-Binnenmarktes ist auch nach 27 Jahren noch nicht vollständig abgeschlossen. Er soll noch um zahlreiche Elemente ausgebaut werden: Kapitalmarktunion, Energie-Binnenmarkt, digitaler Binnenmarkt, etc. Allerdings bestehen weiterhin Hindernisse, insbesondere ein Mangel an Harmonisierung auf dem Binnenmarkt: uneinheitliche nationale Steuersysteme, isolierte nationale Märkte für Finanzdienstleistungen sowie im Energie- und Verkehrsbereich, unterschiedliche nationale Regeln, Standards und Verfahren für den elektronischen Handel, komplexe Regeln für die Anerkennung von Berufsqualifikationen (https://europa.eu/european-union/topics/single-market_de). Beispielsweise ist die Richtlinie über Dienstleistungen im Europäischen Binnenmarkt erst nach mehrjährigen Verhandlungen im Europäischen Rat und Europäischen Parlament Ende des Jahres 2006 in Kraft getreten. Die Mitgliedstaaten hatten bis Ende 2009 Zeit, die Richtlinie in ihre Rechtsordnung zu übernehmen (Breuss et al., 2008). Zur Reform und Verbesserung des Binnenmarktes wurden 2011 und 2012 zwei Binnenmarktakte vorgelegt (Binnenmarktakte II, 2012: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_12_1054).
4 Während die Mehrzahl der Studien zur europäischen Integration positive Wachstumseffekte findet (Badinger und Breuss, 2011), postulieren Andersen et. al. (2019), dass keine Wachstumseffekte nachweisbar seien. Obgleich die EU-Mitgliedschaft keine dauerhaften Wachstumseffekte mit sich bringt, führt die immer stärkere Vertiefung zu zahlreichen Regimewechseln und damit zu wachstumsförderlichen Schocks. In Breuss (2018b) wird das anlässlich von 25 Jahren EU-Binnenmarkt gezeigt.
5 Cecchini-Bericht (1988) für den Binnenmarkt; Europäische Kommission (1990) für den Euro.
6 Eine Übersicht über solche Studien findet sich in Breuss (2012) und Beer et al. (2017).
7 Zu den Auswirkungen des Unionsrechts auf die nationale Rechtsordnung aus rechtswissenschaftlicher Sicht siehe Griller et al. (2015).
8 Das im Maastricht-Vertrag geplante Binnenmarktprogramm ist auch nach einem Vierteljahrhundert noch immer nicht vollständig umgesetzt. Wolfmayr (2019) zeigt, dass bei einer vollständigen Umsetzung noch erhebliche Handels- und Wohlfahrtspotenziale auszuschöpfen wären. Der Intra-EU-Handel könnte um 0,5% bis 7,6%, die Realeinkommen in der EU und in Österreich um zusätzlich 0,5% steigen.
9 Einen Vorläufer des hier verwendeten Modells findet man in Breuss (2016).
10 Die detaillierten Modellinputs sind in Anhang B ausgewiesen.
11 In den Schätzungen der Handelseffekte des EU-Beitritts mit einem strukturellen Gravitationsmodell erfasst Oberhofer (2019) den EU-Effekt nur mit einer Dummy-Variable . Von 1995–2014 ist demnach der österreichische Intra-EU-Handel um 46% gestiegen. Die Dummy-Variable für den Euro liefert bei Oberhofer aber ein negatives Vorzeichen.
12 Badinger und Breuss (2005) analysierten die sektorale Veränderung der Aufschlagspreise nach dem EU-Beitritt in Österreich. Das Ergebnis war gemischt. Einige Sektoren verzeichneten deutliche Senkungen der Markups (Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, Groß- und Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Immobilien), in anderen Sektoren wurden kaum Senkungen festgestellt.
13 Finnland zahlte im Durchschnitt von 1995 bis 2018 pro Jahr 0,14% des BIP netto in den EU-Haushalt ein, Schweden 0,34% (Tabelle 2).
14 Der Verlauf der Wachstumseffekte der einzelnen Integrationsschritte in Grafik 1 erscheint zeitlich stark verzögert. Dies ist auf die verwendete Glättung (12-Jahre gleitende Durchschnitte) zurückzuführen. Tatsächlich weisen die unbereinigten simulierten Integrationseffekte eine starke Volatilität auf; sie steigen aber beim jeweiligen Integrationsschritt an. Andere Glättungsmethoden, wie z. B. ein Hodrick-Prescott-Filter bringen schlechtere Ergebnisse.
15 Die McKinsey-Studie bewertet vier Kategorien von Euro-Effekten: i) Reduzierung der Transaktionskosten: geringe Auswirkungen auf das BIP; ii) Handelseffekte innerhalb des Euro-Währungsgebiets; iii) Wettbewerbsfähigkeit: dieser Effekt ist für Deutschland und (wie im vorliegenden Modell) auch für Österreich hoch; er ist für die Länder mit weichen Währungen (wie Italien) negativ, und iv) Zinseffekt: dieser Effekt ist für Deutschland und Österreich niedrig, weil der gemeinsame Zinssatz des Euro-Währungsgebiets auf jenem Deutschlands beruhte; er war hoch für die Länder mit hohen Zinssätzen vor der WWU, wie Italien und andere Länder in der Peripherie des Euro-Währungsgebiets.
16 Vor dem EU-Beitritt der EU-Beitrittskandidaten von 2004 und 2007 startete die EU bereits im Rahmen der Europa-Abkommen einen asymmetrischen Liberalisierungsprozess. Die EU hat die Zölle und NTB für Einfuhren aus den EU-Beitrittskandidaten bereits ab 1997 stufenweise abgeschafft; die zentral- und osteuropäischen Länder folgten 2002. Nach dem EU-Beitritt traten die neuen Mitgliedstaaten der Zollunion der EU bei und nahmen am EU-Binnenmarktprogramm teil. Dies bedeutete zum einen die Anpassung der nationalen Zollsätze an den GZT der EU und die Abschaffung der Grenzkontrollen, womit die verbleibenden Handelskosten eliminiert wurden.
17 Levchenko und Zhang (2012) schätzen die Wohlfahrtsgewinne aufgrund der europäischen Handelsintegration seit 2000 im Westen jährlich auf 0,14% (im Osten auf 7,94%). Im Westen ist Österreich mit +0,39% der größte Gewinner. Im Osten sind Estland mit +17,25%, Lettland +11,93% und Bulgarien +10,57% die größten Gewinner; die Wohlfahrtsgewinne der anderen zentral- und osteuropäischen Länder liegen unter 10%.
18 Die hier nach 25 Jahren dargestellten Schätzungen der makroökonomischen Effekte der EU-Integration decken sich größtenteils mit jenen, die vor dem EU-Beitritt vom Wifo mit einem Makromodell und Input-Output-Modell vorgenommen wurden (Breuss und Schebeck, 1989; Breuss et al. 1994).
19 Oberhofer (2019) schätzt mit einem strukturellen Gravitationsmodell den Zuwachs des österreichischen Intra-EU-Handels für die ersten 10 Jahr EU-Mitgliedschaft (1995–2014) auf 46%. Eingefügt in das ADAGIO-Input-Output-Modell des Wifo ergibt sich daraus ein jährlicher Anstieg des realen BIP von 0,7%.
20 Das deckt sich mit den Berechnungen von Felbermayr et al. (2018), die den hypothetischen Fall einer vollständigen Auflösung der EU untersuchen. Den größten negative Effekt (gemessen am Pro-Kopf-Einkommen) hätte die Beseitigung des Binnenmarktes: Deutschland –3.9%, Österreich –6.2%. Neben der Aufgabe des Schengener Abkommens hätte der Verlust des Euro auch Einkommensverluste zur Folge: Deutschland –0.4%, Österreich –0,7%. Für Berechnungen der Binnenmarkteffekte siehe auch Mion und Ponattu (2019). Ihnen zufolge profitierte Österreich vom Binnenmarkt mit einem Anstieg des realen Einkommens (Wohlfahrt) um 3,9%, Finnland +2,5%, Schweden +2,8%. Nach London Economics (2017) profitierte Österreich seit 1995 vom Binnenmarkt mit einem Anstieg des BIP pro Kopf von 2,6% (EU28 +1,7%), Finnland +1,7%, Schweden +1,5%.
21 Mit der Ostöffnung ging aber offensichtlich (neben dem technischen Fortschritt) auch ein starker Druck auf die Lohnquote einher (siehe Breuss, 2010).
Konvergenz, Produktionsintegration und Spezialisierung in Europa seit 1995
Robert Stehrer 22
Wissenschaftliche Begutachtung: Christian Ragacs, OeNB; Klaus Vondra, OeNB
Die Entwicklung Österreichs infolge des EU-Beitritts am 1. Jänner 1995 ist im Zusammenhang mit dem beginnenden europäischen Integrationsprozess infolge der Osteuropaöffnung zu sehen. Wesentliche Aspekte dieses Integrationsprozesses waren die (i) Umstrukturierungs- und Aufholprozesse der osteuropäischen Länder (ii) die Einbindung in europäische und globale Wertschöpfungsketten und die damit einhergehende Entwicklung der Handelsströme und ausländischen Direktinvestitionen und (iii) die sich ergebende Entwicklung der Spezialisierungs- und Agglomerationsmuster innerhalb Europas. Aufgrund der geographischen, aber auch politischen Lage Österreichs zwischen West und Ost stellte der EU-Beitritt sowohl eine große Herausforderung als auch Chance dar. Die vorliegende Studie zeichnet die Entwicklung Österreichs entlang dieser Dimensionen im europäischen Kontext nach und diskutiert die daraus folgenden zukünftigen Herausforderungen.
JEL Klassifikation: F02, F14, F62, O47, O52
Keywords: EU Integration, Osteuropaöffnung, Aufholprozess, Wertschöpfungsketten
“… liegst dem Erdteil Du inmitten …” (Österreichische Bundeshymne)
Die österreichische wirtschaftliche Entwicklung nach dem Beitritt zur Europäischen Union vor 25 Jahren ist stark mit anderen wichtigen europäischen Ereignissen verflochten, die große Herausforderungen, aber auch Chancen mit sich brachten. Der vorliegende Beitrag stellt in Kapitel 1 selektiv einige wichtige Fakten dieses europäischen Integrationsprozesses dar und beleuchtet die Entwicklung und Position Österreichs in dieser Hinsicht. In Kapitel 2 wird die Konvergenzdynamik des Bruttoinlandsproduktes pro Kopf und der Produktivität in den letzten 25 Jahren dargestellt. Anschließend wird in Kapitel 3 die Entwicklung der Einbindung Österreichs in europäische und globale Wertschöpfungsketten durch Handelsverflechtungen (die auch stark mit Strömen von Auslandsinvestitionen verbunden sind) seit dem EU-Beitritt gezeigt. Aufgrund der Produktionsintegration und Ausbildung von Wertschöpfungsketten in Europa kam es zu Agglomerations- und Spezialisierungsmustern und der Entstehung des "EU manufacturing core", zu dem – neben Deutschland und einigen mittel-und osteuropäischen Ländern – auch Österreich gezählt wird (Stehrer und Stöllinger, 2015), wie in Kapitel 4 gezeigt wird. Im vorliegenden Beitrag wird ein besonderes Augenmerk auf den Vergleich mit Deutschland und Italien, die ebenso wie Österreich Nachbarländer der mittel- und osteuropäischen Länder sind, gelegt. Weiters steht der Vergleich mit Finnland und Schweden im Fokus, die beide ebenfalls 1995 EU-Mitglieder geworden sind und sich auch in geographischer Nähe zu den osteuropäischen Ländern befinden.
1 Der EU-Beitritt im Lichte des europäischen Integrationsprozesses
Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union am 1. Jänner 1995 erfolgte zur Zeit eines beginnenden starken Aufholprozesses der (bis 1989 kommunistischen) osteuropäischen Länder und ihrer Integration in die europäische Wirtschaft, der schließlich 2004 zum EU-Beitritt von zehn Ländern (Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern) und 2007 von zwei weiteren Ländern (Bulgarien und Rumänien) führte; Kroatien trat 2013 bei. Aus ökonomischer Sicht hatten diese Länder nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 einen starken Aufholprozess und eine Ausrichtung der Handelsströme in Richtung der westeuropäischen Länder – insbesondere der Nachbarländer Österreich, Deutschland und Italien – eingeleitet. Dieser Prozess verlief jedoch keineswegs reibungslos: Er begann mit einer starken und schweren Rezession zu Beginn der 1990er-Jahre (der sogenannten Transformationsrezession), der die meisten Länder Mitte der 1990er-Jahre entkamen. Ende der 1990er-Jahre durchliefen einige Ländern eine Finanzkrise (z. B. die Tschechische Republik). Danach, ungefähr bis zum Ausbruch der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008, verlief der wirtschaftliche Integrations- und Konvergenzprozess eher reibungslos.
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 1989 | Fall des Eisernen Vorhangs |
| Beginn der 1990er-Jahre | Deutsche Wiedervereinigung, ökonomische Abschwächung und Tranformationsrezession in Zentral- und Osteuropa |
| 1995 | EU-Beitritt von Österreich, Finnland und Schweden |
| 1997/1998 | Finanz- und Wirtschaftskrise in einigen osteuropäischen Ländern |
| 1991–1995, 1998–1999 | Balkankriege (Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo) |
| 1999 | Euro-Einführung |
| 2001/2002 | China wird WTO-Mitglied |
| 2004 | Osterweiterung der EU: Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern |
| 2007 | EU-Beitritt von Bulgarien und Rumänien |
| 2008–2009 | Globale Finanz- und Wirtschaftskrise |
| 2010–2012 | Staatsschuldenkrisen in verschiedenen Euroländern |
| 2015/2016 | Flüchtlingskrise |
| 2020 | Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU (Brexit), Covid-19-Pandemie |
| Quelle: Eigene Darstellung. | |
In die Zeit nach 1989 fielen einige weitere wichtige politische und wirtschaftliche Ereignisse, die selektiv in Tabelle 1 dargestellt sind. Sie reichen von der wirtschaftlichen Dynamik in den europäischen Ländern über politische Krisen und Kriege in der Nachbarschaft der EU bis hin zu globalen Entwicklungen, wie dem Aufstieg der Schwellenländer der z. B. zum WTO-Beitritt Chinas im Dezember 2001 führte. In den letzten Jahren haben populistische Bewegungen und Desintegrationstendenzen – bis hin zum schmerzhaften Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU im Januar 2020 – an Dynamik gewonnen. Hinzu kommen weitere allgemeine Trends, die aus Sicht der internationalen Integration wichtig sind: Beispiele dafür sind die Entwicklung globaler Produktionsnetzwerke und Wertschöpfungsketten, Digitalisierung, demographische Entwicklungen (inklusive der Migrationsbewegungen) und die sich verschärfenden ökologischen Herausforderungen. Die Auswirkungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie und deren Dauer sind derzeit noch nicht absehbar.
Die österreichische Entwicklung nach dem EU-Beitritt war mit allen diesen Entwicklungen, insbesondere mit jenen in den östlichen Nachbarländern aufgrund der geografischen Nähe, stark verbunden. Daraus ergaben sich einerseits eine Reihe von Chancen für die österreichischen Unternehmen, wie z. B. relativ stark wachsende Exportmärkte und durch groß angelegte Privatisierungsprogramme getriebene Investitionsmöglichkeiten in einigen der mittel- und osteuropäischen Länder, die zu grenzüberschreitenden Produktionsnetzwerken und der Auslagerung verschiedener Produktionsschritte (getrieben u. a. durch die dort ansässigen qualifizierten und relativ billigen Arbeitskräfte) führten. Andererseits bedeutete dies auch Herausforderungen, wie z. B. die Konkurrenz durch Billiganbieter und Migrationsströme, die aus verschiedenen Gründen Anlass zur Besorgnis gaben.
Zum Zeitpunkt des EU-Beitritts bestanden starke Wirtschaftsbeziehungen zu den westeuropäischen Ländern, insb. zu Deutschland, das Österreichs wichtigster Partner im Handel und bei ausländischen Direktinvestitionen war und bis heute ist. Auch die übrigen EU-Länder waren von den oben beschriebenen Entwicklungen betroffen, insbesondere auch jene, mit denen Österreich bereits starke Wirtschaftsbeziehungen unterhielt, wie z. B. Italien. In den folgenden Kapiteln werden selektiv Indikatoren dargestellt, die diese Entwicklungen hinsichtlich der österreichischen Performance zeigen.
2 Österreichs Position im europäischen Konvergenzprozess
Der Zeitpunkt des EU-Beitritts Österreichs war durch einen starken, wenn auch teilweise holprigen Konvergenzprozess der osteuropäischen Länder gekennzeichnet. Die Wachstumsdynamik vom EU-Beitritt 1995 bis zum Jahr 2018 ist in Grafik 1 dargestellt, die den Zusammenhang zwischen dem Ausgangsniveau des BIP pro Kopf (in Kaufkraftparitäten) im Jahr 1995 und den BIP-Wachstumsraten zeigt. In Übereinstimmung mit der Literatur zum Wirtschaftswachstum sieht man eine starke negative Korrelation, d. h. Länder, die in den ersten Jahren weiter zurücklagen, weisen langfristig höhere Wachstumsraten auf. 23
Im Jahr 1995 erreichten die mittel- und osteuropäischen Länder beim Pro-Kopf-Einkommen (BIP pro Kopf) zwischen einem Viertel und einem Drittel des Niveaus der reichsten europäischen Länder (ohne Luxemburg). Nur Tschechien und Slowenien erreichten fast zwei Drittel dieses Einkommensniveaus. Die osteuropäischen Länder verzeichneten durchschnittlich sehr hohe Wachstumsraten zwischen 4 und 8 Prozent, die auf einen starken Konvergenzprozess hindeuten.
Betrachtet man die westeuropäischen Länder, so ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Wie Grafik 1 zeigt, gibt es in dieser Ländergruppe keine Konvergenz – die Wachstumsraten von zwei Ländern, Griechenland und Italien, liegen weit unter dem Durchschnitt (hauptsächlich bedingt durch die Auswirkungen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise). Die Gruppe der reichsten Länder – einschließlich Österreich – erzielte Wachstumsraten leicht über dem der Durchschnitt der EU-15. Die Wachstumsraten dieser Gruppe der reichsten Länder liegen – ähnlich wie die der Länder im mittleren Bereich des Pro-Kopf-Einkommensniveaus, wie Spanien und Portugal – auch leicht über denen Frankreichs und des Vereinigten Königreichs.
Die Persistenz der relativen Pro-Kopf-Einkommensniveaus wird noch deutlicher, wenn man diese im Verhältnis zu den gesamten EU-28 betrachtet. Grafik 2 vergleicht die Position Österreichs mit den EU-15, Deutschland und Italien sowie Finnland und Schweden, die beide ebenfalls 1995 der EU beigetreten sind.
Während Österreich seine relative Position zum BIP pro Kopf der EU-28 mehr oder weniger halten konnte (die relative Einkommensposition veränderte sich von 31 Prozentpunkten über dem EU-28-Durchschnitt auf 28 Prozentpunkte), ist die Position der EU-15 (relativ zur EU-28) um etwa 10 Prozentpunkte (von etwa 117 auf 107) zurückgegangen. Im Vergleich zu den beiden Nachbarländern Deutschland und Italien schnitt Österreich sogar besser ab. Während das deutsche Pro-Kopf-BIP relativ zur EU-28 anfänglich leicht zurückgegangen war, sich aber in den späteren Jahren erholte, verzeichnete Italien einen sehr starken Rückgang von etwa 23 Prozentpunkten über dem EU-28-Durchschnitt im Jahr 1995 auf 4 Prozentpunkte unter diesem Durchschnitt im Jahr 2018. Auch im Vergleich zu den beiden anderen Beitrittsländern von 1995, Finnland und Schweden, schnitt Österreich besser ab: Finnland lag im Jahr 2018 nach einem starken anfänglichen Anstieg seiner relativen Position nur leicht über dem relativen Niveau von 1995. Schweden hatte mit 27 Prozentpunkten über dem EU-28-Durchschnitt in einer ähnlichen, wenn auch etwas niedrigeren Position als Österreich gestartet, verzeichnete jedoch einen etwas stärkeren Rückgang auf etwa 21 Prozentpunkte im Jahr 2018.
Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Österreich seit dem EU-Beitritt in der Phase der starken europäischen Integration zwischen West und Ost überdurchschnittlich gut abschnitt und sogar die ausgewählten Peer-Ländern Deutschland, Italien, Finnland und Schweden überholte.
3 Österreichs Integration in europäische und globale Wertschöpfungsketten
Ein Grund für das gute Abschneiden Österreichs war die starke Integration in europäische und globale Wertschöpfungsketten, die unter anderem durch die zentrale geographische Lage im Zentrum Europas und eine solide ökonomischen Ausgangssituation bedingt war. Dieser Integrationsprozess stellt sich im Detail folgendermaßen dar: Der Anteil der österreichischen Exporte am BIP (Exportquote) stieg von etwas über 30 % im Jahr 1995 auf rund 55 % im Jahr 2019 und damit um rund 25 Prozentpunkte. Da in den Bruttoexporten aber auch die importierten Vorleistungen enthalten sind, überschätzt diese Zahl den Effekt auf das gesamtwirtschaftliche Einkommen. Die Verwendung von sogenannten globalen-Input-Output-Tabellen“ ermöglicht dies zu berücksichtigen und die Exporte in Wertschöpfungseinheiten zu berechnen (Wertschöpfungsexporte, d. h. die Wertschöpfung, die tatsächlich in Österreich erstellt und anschließend exportiert wird). Gemäß diesen Berechnungen lag der Anteil der Wertschöpfungsexporte am BIP im Jahr 1995 bei 24% und stieg im Jahr 2014auf 33 %, womit er um 9 Prozentpunkte gestiegen ist. 24
Die wachsende Differenz zwischen dem Verhältnis der Bruttoexporte und der Wertschöpfungsexporte zum BIP resultiert aus dem zunehmenden Einsatz von importierten Vorleistungen in der Produktion. Tabelle 2 zeigt, wo die in Österreich geschaffene Wertschöpfung letztendlich als Endnachfrage (Konsum der Haushalte, Investitionen, Nachfrage des Staates) absorbiert wird. Der Anteil der Absorption in Österreich selbst ist von 71,5 % im Jahr 2000 auf 67 % im Jahr 2014 zurückgegangen, was umgekehrt dem Anteil der Wertschöpfungsexporte am BIP entspricht, die sich demgemäß im Jahr 2014 auf 33 % beliefen.
| Wertschöpfungsexporte | Anteil der Wertschöpfungexporte nach Länder(gruppen) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | |
| in % des BIP | in % | |||||||
| Deutschland | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 23,8 | 20,8 | 20,3 | 19,9 |
| EU-CEESE | 2,8 | 3,5 | 3,7 | 3,3 | 9,8 | 11,2 | 11,4 | 10,0 |
| Andere EU-Mitgliedstaaten | 8,4 | 9,0 | 7,8 | 7,2 | 29,4 | 28,8 | 24,3 | 21,8 |
| China | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 2,3 | 4,5 | 5,2 |
| Rest der Welt | 10,2 | 11,6 | 12,6 | 14,2 | 35,7 | 36,9 | 39,4 | 43,1 |
| Wertschöpfungsexporte gesamt | 28,5 | 31,3 | 32,0 | 33,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Quelle: WIOD Release 2016; eigene Berechnungen. | ||||||||
Der Anteil der österreichischen Wertschöpfung (linke Seite Tabelle 2), der von den Ländern der EU-CEESE, China und dem Rest der Welt absorbiert wurde, nahm in diesem Zeitraum zu, während er für Deutschland stagnierte und in den anderen EU-Mitgliedstaaten sogar zurückging. Diese Muster zeigen sich noch ausgeprägter, wenn man die geographische Struktur der österreichischen Wertschöpfungsexporte betrachtet (rechts Seite Tabelle 2). Demnach ist die Bedeutung Deutschlands und der anderen EU-Mitgliedstaaten für die Wertschöpfungsexporte zurückgegangen, die Anteile der EU-CESEE blieben in etwa konstant und die Bedeutung Chinas und der übrigen Welt stieg, was den wachsenden Anteil dieser Länder an der Weltwirtschaft widerspiegelt. Umgekehrt hat Österreich die Produktion auch durch die zunehmende Produktionsverlagerung in andere Länder internationalisiert, sodass ein größerer Teil des Wertes der österreichischen Endprodukte bzw. Exporte auf importierte Vorleistungsgüter – und damit ausländische Wertschöpfung – zurückgeht.
| Endgüterproduktion | Bruttoexporte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | |
| in % des Wertes der Endgüterproduktion | in % der Exporte1 | |||||||
| Anteil der ausländischen Wertschöpfung | 15,5 | 17,7 | 17,8 | 19,1 | 28,5 | 32,3 | 34,5 | 35,8 |
| davon | in % | in % | ||||||
| Deutschland | 33,0 | 33,0 | 30,0 | 29,6 | 35,1 | 35,2 | 31,8 | 30,8 |
| EU-CEESE | 7,9 | 12,4 | 13,2 | 13,5 | 7,7 | 11,8 | 12,3 | 12,6 |
| Andere EU-Mitgliedstaaten | 28,2 | 26,4 | 22,0 | 21,7 | 28,4 | 26,5 | 23,1 | 22,6 |
| China | 0,9 | 1,6 | 2,7 | 3,4 | 0,9 | 1,5 | 2,5 | 3,3 |
| Rest der Welt | 30,0 | 26,6 | 32,2 | 31,8 | 27,9 | 25,1 | 30,4 | 30,7 |
| Quelle: WIOD Release 2016; eigene Berechnungen. | ||||||||
| 1 Inklusive Dienstleistungsexporte. | ||||||||
Tabelle 3 zeigt diese Anteile der ausländischen Wertschöpfung an der österreichischen End- und Bruttoexportproduktion. Der Anteil der ausländischen Wertschöpfung an der österreichischen Produktion von Endprodukten (von 15,5 % im Jahr 2000 auf 19,1 % im Jahr 2014) und an den Exporten (von 28,5 % auf 35,8 % im Jahr 2014) ist deutlich gestiegen. 25 In der geographischen Struktur der Auslandsbeschaffung findet man wieder eine zunehmende Bedeutung der EU-CEESE-Länder und Chinas (und teilweise der restlichen Welt), während die Rolle Deutschlands und der anderen EU-Mitgliedstaaten relativ kleiner wird. Umgekehrt führt die internationale Produktionsintegration auch dazu, dass Österreich Güter produziert, die als Vorleistungen in die Exporte anderer Länder eingehen (Stöllinger und Stehrer, 2015).
Zusammenfassend lässt sich somit feststellen, dass sich Österreich seit dem EU-Beitritt international stärker integriert hat, was sich sowohl in einem steigenden Anteil der Wertschöpfungsexporte am BIP als auch durch eine stärkere Vorwärts- und Rückwärtsverflechtung in Wertschöpfungsketten, insbesondere europäische, zeigt. Im Speziellen gewannen die Vorwärtsverflechtungen zu Deutschland und den EU-CEE-Ländern an Bedeutung, wohingegen die Rückwärtsverflechtungen vor allem mit den EU-CEE-Ländern aufgrund von Importen von Vorleistungen und Produktionsauslagerungen zugenommen haben. 26
4 Österreichs Position in der europäischen Arbeitsteilung
Das österreichische Muster der Produktionsintegration und Ausbildung von Wertschöpfungsketten innerhalb Europas – insbesondere im verarbeitenden Gewerbe und bei den Ausfuhren –ist auch als allgemeines Phänomen in Europa festzustellen. Es ist als die Entstehung des „EU manufacturing core" bekannt, d. h. die Agglomeration und Clusterbildung des verarbeitenden Gewerbes im Zentrum Europas. Das ist aus der sich entwickelnden Spezialisierungsdynamik in den europäischen Ländern zu erkennen, die in den letzten 25 Jahren als Folge des Aufholprozesses, der zunehmenden Produktionsintegration entstanden ist. Hierbei ist besonders die Bedeutung des verarbeitenden Gewerbes hervorzuheben, die sich in verschiedenen Indikatoren, wie etwa der Forschung- und Entwicklungsintensität und dem Anteil am Produktivitätswachstum, zeigt und woraus sich industriepolitische Implikationen ergeben. 27 Es gibt es einen engen Konnex vom verarbeitenden Gewerbe zum Dienstleistungssektor, insbesondere zu den unternehmensbezogenen Dienstleistungen, die eine wichtige Rolle im Produktionsprozess spielen (Stehrer et al., 2015). Dieser Zusammenhang zwischen dem verarbeitenden Gewerbe (NACE Rev. 2 C) und den Unternehmensdienstleistungen (NACE Rev. 2 J, K, L und M_N) 28 lässt sich durch Anteile dieser Branchen am BIP in den EU-Mitgliedstaaten im Jahr 1995 und 2017 darstellen. 29
Grafik 3 zeigt, dass die Anteile dieser beiden Branchen im Bereich um den EU-28-Durchschnitts mit Bandbreiten von etwa 10-15 Prozentpunkten liegen. Österreich liegt im südöstlichen Quadranten mit einem Anteil des verarbeitenden Gewerbes über dem EU-28-Durchschnitt von rund 18 % und einem Anteil der Unternehmensdienstleistungen von rund 22 % unter dem EU-28-Durchschnitt. Im Jahr 2017 zeigt sich ein klares Spezialisierungsmuster, wobei einige Länder ihren Anteil am verarbeitenden Gewerbe stark erhöht oder zumindest gehalten haben. Diese Länder umfassen hauptsächlich die mittel- und osteuropäischen Länder sowie Österreich, Deutschland (und eventuell Finnland), die den sogenannten „EU manufacturing core" bilden (Stöllinger und Stehrer, 2015). 30 Bemerkenswert ist, dass der Anteil des verarbeitenden Gewerbes für die EU-28 insgesamt mehr oder weniger gleich groß ist wie im Jahr 1995 ist (gemessen in verketteten Volumen, Referenzpreise 2010).
Obwohl der Anteil der Unternehmensdienstleistungen in den meisten Länder des „EU manufacturing core“ gestiegen ist, liegt er immer noch unter dem Durchschnitt der EU-28. Eine Gruppe anderer Länder, insbesondere Frankreich, die Niederlande und das Vereinigte Königreich, hat sich stärker auf Unternehmensdienstleistungen spezialisiert, wobei die Anteile des verarbeitenden Gewerbes in diesen teilweise gesunken sind. Schließlich hat eine weitere Gruppe von Ländern (z. B. Belgien, Dänemark, Schweden) ihre relative Position zwischen diesen beiden stärker spezialisierten Ländergruppen mehr oder weniger gehalten. Insgesamt zeigt sich jedoch die angesprochene Agglomeration des industriellen Gewerbes im Zentrum Europas deutlich.
| Verarbeitendes Gewerbe | Unternehmensbezogene Dienstleistungen | Verarbeitendes Gewerbe | Unternehmensbezogene Dienstleistungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2017 | 1995 | 2017 | 1995 | 2017 | 1995 | 2017 | |
| in % der Wertschöpfung zu laufenden Preisen | in % der Wertschöpfung zu realen Werten1 | |||||||
| Österreich | 19,9 | 18,6 | 22,3 | 27,2 | 17,8 | 20,6 | 21,3 | 26,6 |
| EU-15 | 19,6 | 16,0 | 28,2 | 33,0 | 16,4 | 15,8 | 27,7 | 33,6 |
| Deutschland | 22,8 | 23,4 | 29,1 | 30,0 | 22,0 | 24,1 | 29,7 | 30,8 |
| Finnland | 25,4 | 17,6 | 21,6 | 30,2 | 15,8 | 18,4 | 25,4 | 29,3 |
| Italien | 20,9 | 16,6 | 26,0 | 32,2 | 18,4 | 16,8 | 28,9 | 32,6 |
| Schweden | 22,8 | 15,4 | 24,8 | 31,1 | 14,4 | 15,3 | 25,9 | 33,1 |
| Quelle: EU-KLEMS Release 2019, eigene Berechnungen. | ||||||||
| 1 verkettete Volumina, Referenzpreise 2010. | ||||||||
In Tabelle 4 sind die Zahlen für Österreich und die Peer-Länder dargestellt, sodass eine noch detailliertere Beurteilung der österreichischen Leistung seit dem EU-Beitritt 1995 möglich ist. Die österreichische Wirtschaftsstruktur hat sich – hinsichtlich des Anteils des verarbeitenden Gewerbes und der damit verbundenen unternehmensbezogenen Dienstleistungen – im Vergleich zu den Peer-Ländern gut entwickelt, was insbesondere die realen Anteile (rechter Teil Tabelle 4) zeigen. Bei den unternehmensbezogenen Dienstleistungen blieb der Abstand zu den Peer-Ländern mit Ausnahme Deutschlands mehr oder weniger konstant, was teilweise auf den stärkeren Anstieg (zu realen Preisen) des verarbeitenden Gewerbes zurückgeführt werden kann. 31
Angesichts der relativen Bedeutung des österreichischen verarbeitenden Gewerbes als Teil des „EU manufacturing core" sind auch die dortigen Spezialisierungsmuster wichtig. Grafik 4 zeigt die Veränderung der Anteile der Hochtechnologiesektoren (NACE Rev. 2 C21, C26, C27, C28, C29_C30) 32 an der gesamten Wertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes. Es zeigt sich, dass die Länder des „EU manufacturing core" durch relativ große Anteile oder starke Zuwächse der technologieintensiven Industrien am verarbeitenden Gewerbe gekennzeichnet sind, was auf eine erfolgreiche Spezialisierung in diesen hinweist. Dies mag nicht überraschen, da die in Kapitel 3 hervorgehobene internationale Integration der Produktion und die damit verbundenen ausländischen Direktinvestitionen in diesen Branchen besonders dynamisch verliefen. Für Österreich stieg der Anteil der technologieintensiven Branchen an der Wertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes von fast 30 auf 40%. Österreichs Strukturentwicklung lag damit eher am unteren Ende der Länder des „EU manufacturing core". Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die höheren Anteile in den EU-CEE-Ländern zu einem großen Teil durch Assembly-Aktivitäten und entsprechende Muster der funktionalen Spezialisierung erklärt werden (Stöllinger, 2019).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Österreich seit dem EU-Beitritt 1995 von der Integration in europäische Wertschöpfungsketten und dem daraus resultierenden größeren Anteil der verarbeitenden Industrie sowie der Aufwertung der Produktionsstrukturen zu höherwertigen Industrien und Unternehmensdienstleistungen profitierte.
5 Schlussfolgerungen
Die obigen Ausführungen zeigen, dass sich Österreich im Großen und Ganzen gut im – nicht immer harmonischen – Konzert der europäischen Entwicklung seit dem EU-Beitritt 1995 behaupten konnte; sowohl im Allgemeinen als auch im direkten Vergleich mit Peer-Ländern wie den Nachbarstaaten Deutschland und Italien, aber auch wie Schweden und Finnland, die ebenfalls 1995 der EU beitraten. Es wurde gezeigt, dass die langfristige Wachstumsrate des Pro-Kopf-Einkommens in Österreich über dem Durchschnitt ähnlich reicher Länder liegt und sich die Unternehmen gut in die entstehenden europäischen Produktionsnetzwerke einbinden konnten. Der Anteil der verarbeitenden Industrie an der Wertschöpfung blieb im Vergleich zu anderen Ländern hoch und auch der Anteil der unternehmensbezogenen Dienstleistungen stieg, liegt jedoch noch immer unter dem Durchschnitt vergleichbarer Länder. Die zentrale Lage Österreichs in Europa und die geographische Nähe zu Deutschland spielte eine wichtige Rolle, um von den stark wachsenden Volkswirtschaften in Zentral- und Osteuropa, der Integration in die europäischen Produktionsnetzwerke und den sich daraus ergebenden Muster der europäischen Arbeitsteilung, d. h. den Agglomerations- und Spezialisierungstendenzen, zu profitieren. Die EU-Mitgliedschaft war in diesem sich rasch wandelnden Umfeld sicherlich ein wichtiger Katalysator. Die Mitgliedschaft in einer funktionierenden Europäischen Union ist auch in Zukunft wichtig, um sich gegen die abzeichnenden mittel- und langfristigen Herausforderungen zu wappnen, die von verschiedenen Szenarien für das Europäischen Projekt als solches, technologischen Herausforderungen (z. B. Digitalisierung), demographischen Entwicklungen (z. B. Bevölkerungsschwund in verschiedenen Ländern Europas, Alterung, Migration) 33 , den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und ihren wirtschaftlichen Folgen, den potenziellen geopolitischen Trends (z. B. Handelsdesintegration, Aufstieg Chinas zur Weltmacht, Konflikte in der europäischen Nachbarschaft) bis hin zu ökologischen Herausforderungen reichen.
Literaturverzeichnis
Adarov, A. und R. Stehrer. 2019a. Tangible and intangible Assets in the Growth Performance of the EU, Japan, and the US. wiiw Working Research Report No. 442, The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw).
Adarov, A. und R. Stehrer. 2019b. Implications of Foreign Direct Investment, Capital Formation and its Structure for Global Value Chains. wiiw Working Paper No. 170, The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw).
Landesmann, M. und R. Stöllinger. 2020. The European Union’s Industrial Policy: What are the Main Challenges? wiiw Policy Note/Policy Report Nr. 36, The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw).
Leitner, S. M. und R. Stehrer. 2019. The Automatisation Challenge Meets the Demographic Challenge: In Need of Higher Productivity Growth. wiiw Working Paper No. 171, The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw).
Leitner, S. M., R. Stehrer und R. Grieveson. 2019. EU faces a Tough Demographic Reckoning. wiiw Policy Notes and Reports 30, The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw).
Stehrer, R., P. Baker, N. Foster-McGregor, J. Koenen, S. M. Leitner, J. Schricker, T. Strobel, J. Vermeulen, H.-G. Vieweg und A. Yagafarova. 2015. The Relation between Industry and Services in Terms of Productivity and Value Creation. wiiw Research Report No. 404, The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw).
Stehrer, R., A. Bykova, K. Jäger, O. Reiter und M. Schwarzhappel. 2019. Industry Level Growth and Productivity Data with Special Focus on Intangible Assets, Report on methodologies and data construction for the EU KLEMS Release 2019, The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw).
Stöllinger, R. 2019. Testing the Smile Curve: Functional Specialisation in GVCs and Value Creation. wiiw Working Paper No. 163, The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw).
Stöllinger R., N. Foster-McGregor, M. Holzner, M. Landesmann, J. Pöschl und R. Stehrer. 2013. A ‘Manufacturing Imperative’ in the EU – Europe’s Position in Global Manufacturing and the Role of Industrial Policy, wiiw Research Report 391, The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw).
Stöllinger, R. und R. Stehrer. 2015. The Central European Manufacturing Core: What is Driving Regional Production Sharing, FIW Research Report, 2014/15 No 2.
Timmer, M., E. Dietzenbacher, B. Los, R. Stehrer und G. de Vries. 2015. An Illustrated User Guide to the World Input-Output Database: The Case of Global Automative Production. In: Review of International Economics 23(2). 99–120.
22 Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), Robert.Stehrer@wiiw.ac.at. Der Autor dankt Christian Ragacs und Klaus Vondra für wertvolle Kommentare und Vorschläge.
23 Ein ähnlich starker Zusammenhang besteht, wenn man die Produktivitätsentwicklung nach beschäftigten Personen oder geleisteten Arbeitsstunden betrachtet. Für eine detailliertere Darstellung der Produktivitätsentwicklungen seit 1995 siehe Adarov und Stehrer (2019a).
24 Diese Zahlen wurden mit Hilfe der World Input-Output Database (WIOD) Release 2016 berechnet (www.wiod.org); siehe Timmer et al. (2015).
25 Die Differenz ist hauptsächlich auf die unterschiedlichen Anteile von Dienstleistungen im Endgüterkonsum und den Exporten zurückzuführen.
26 Hier gibt es eine starke Korrelation mit den ausländischen Direktinvestitionen (Adarov und Stehrer, 2019).
27 Für eine Diskussion im europäischen Kontext siehe Stöllinger et al. (2013) und Landesmann und Stöllinger (2020).
28 Diese sind definiert als Informations- und (J); Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (K), Grundstücks- und Wohnungswesen (L); und Freiberufliche und technische Dienstleistungen, Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung, Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (M_N).
29 Diese Daten basieren auf den EU KLEMS Daten www.euklems.eu (Stehrer et al. 2019).
30 Stöllinger und Stehrer (2015) inkludieren darin die Länder Deutschland, Österreich, Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn.
31 Jedoch zeigt sich, dass in diesem Bereich noch Aufholpotenzial vorhanden ist, was aber einer genaueren Untersuchung des Dienstleistungssektors bedarf (siehe z.B. Stehrer, et al., 2015).
32 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (C21); Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (C26), Herstellung von elektronischen Ausrüstungen (C27), Maschinenbau (C28), Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen; Sonstiger Fahrzeugbau (C29_C30).
33 Siehe beispielsweise Leitner et al. (2019) und Leitner und Stehrer (2019).
Entwicklung von Produktivität und Profitabilität heimischer Unternehmen während der EU-Mitgliedschaft
Gerhard Fenz, Christian Ragacs, Martin Schneider, Klaus Vondra 34
Wissenschaftliche Begutachtung: Fritz Breuss, WIFO
Österreich weist eine – im europäischen Vergleich – überdurchschnittlich hohe Produktivität je geleisteter Arbeitsstunde auf. Im Zeitraum seit dem Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 1995 bis zum Jahr 2017 liegt das Niveau rund 20% über jenem der EU-28, allerdings 6% unter dem des wichtigsten Handelspartners Deutschland. Diese Abstände haben sich im Beobachtungszeitraum von 1995 bis 2017 nicht wesentlich verändert. Das Produktivitätswachstum ist in Österreich – einem internationalen Trend folgend – von 2% vor der Wirtschafts- und Finanzkrise auf unter 1% danach zurückgegangen. Die Ergebnisse einer Shift-Share-Analyse zeigen, dass das gesamtwirtschaftliche Produktivitätswachstum durch das Wachstum innerhalb einzelner Branchen erklärt wird, während der Strukturwandel das gesamtwirtschaftliche Produktionswachstum dämpft. Branchen mit einer hohen Produktivität haben zugunsten von Branchen mit einer niedrigen Produktivität an Bedeutung verloren. Angebotsseitig wird mehr als die Hälfte des Produktivitätswachstum in Österreich von der Gesamtfaktorproduktivität getragen. Auf makroökonomischer Ebene ist ein enger Zusammenhang zwischen dem Produktivitätswachstum je geleisteter Arbeitsstunde und der Veränderung der Gewinnquote in Österreich zu beobachten. Nach einem Anstieg um 7 Prozentpunkte erreichte die Gewinnquote im Jahr 2008 mit 37% ihren Höhepunkt im Beobachtungszeitraum und ging anschließend auf 31% im Jahr 2017 zurück. Ein ähnlicher Zusammenhang ist für Profitabilitätsmaße auf Basis von Bilanzkennzahlen nicht zu erkennen.
JEL classification: E23, E24
Keywords: Productivity, Profit-Share, Austria, European Union
Produktivität und Profitabilität sind zentrale Größen der Leistungsfähigkeit von Unternehmen und Volkswirtschaften. Sie werden von einer Reihe von Faktoren bestimmt. Die Literatur zur Produktivitätsentwicklung einer Volkswirtschaft ist umfassend (siehe beispielsweise Schneider, 2014 für Österreich und Sachverständigenrat, 2019 für Deutschland). Ein wichtiger Zweig dieser Literatur ist die Diskussion der Bestimmungsgründe für den Rückgang der Produktivitätsdynamik („productivity slowdown“), der in vielen Ländern empirisch belegbar ist (siehe z. B. OECD, 2019).
Empirisch wurden zahlreiche Bestimmungsfaktoren für das Produktivitätswachstum identifiziert (Kim und Loayza, 2019). Neben Innovation, Ausbildung, Markteffizienz und Infrastruktur spielen institutionelle Rahmenbedingungen eine zentrale Rolle, dazu zählt auch der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union vor 25 Jahren und in weiterer Folge zur WWU. Die Teilnahme Österreichs an der europäischen Integration ging zeitlich mit dem weltweiten Trend einer zunehmenden Globalisierung einher.
Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union führte zu einem höheren Wirtschaftswachstum, als dies ohne Beitritt der Fall gewesen wäre (Beer et al., 2017). Neuen Absatzchancen für österreichische Unternehmen standen erhöhte Konkurrenz und steigender Lohndruck entgegen. All diese Faktoren wirken sich auf die Entwicklung der Produktivität und der Gewinnspannen aus. Breuss (2020) schätzt in seinem Beitrag in dieser Publikation die makroökonomischen Auswirkungen des EU-Beitritts und der weiteren europäischen Integrationsschritte Österreichs. Im Zeitraum von 1995 bis 2017 war demnach das Produktivitätswachstum (gemessen als BIP pro Beschäftigten) kumuliert um über 5 Prozentpunkte höher, als dies ohne Österreichs EU-Mitgliedschaft der Fall gewesen wäre.
In diesem Beitrag wird die Entwicklung der Produktivität und der Gewinnquoten in Österreich seit 1995 diskutiert. Insbesondere gehen wir der Frage nach, welche Wirtschaftssektoren und welche Produktionsfaktoren für das Produktivitätswachstum entscheidend waren und welchen Einfluss der Strukturwandel auf das Produktivitätswachstum gehabt hat. In Kapitel 1 wird zunächst die Entwicklung der Arbeitsproduktivität in Österreich mit jener in ausgewählten Ländern verglichen. Im Anschluss wird im Rahmen einer Shift-Share-Analyse untersucht, in welchem Ausmaß die Produktivitätsentwicklung auf das Produktivitätswachstum innerhalb einzelner Branchen oder auf Strukturverschiebungen zwischen den Branchen zurückzuführen ist. Schließlich diskutieren wir die angebotsseitigen Bestimmungsfaktoren der Arbeitsproduktivität. In Kapitel 2 wird die Profitabilität anhand von zwei Datenquellen, der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und den Unternehmensbilanzen laut BACH-Datenbasis, dargestellt. In Kapitel 3 werden die Ergebnisse zusammengefasst.
1 Entwicklung und Bestimmungsfaktoren der Arbeitsproduktivität
In diesem Kapitel diskutieren wir die Entwicklung und die Bestimmungsfaktoren der Arbeitsproduktivität. Nach einer kurzen Darstellung der Entwicklung der Arbeitsproduktivität im internationalen Vergleich analysieren wir die Bedeutung der einzelnen Wirtschaftssektoren und des Strukturwandels für das gesamtwirtschaftliche Produktivitätswachstum. Anschließend diskutieren wir die Beiträge der Produktionsfaktoren zum Wachstum der Arbeitsproduktivität.
1.1 Entwicklung der Arbeitsproduktivität
Die Arbeitsproduktivität in Österreich lag im Jahr 2017 mit 37,6 EUR je geleisteter Arbeitsstunde unter dem Wert für Deutschland (40,5 EUR), jedoch deutlich über dem EU-Durchschnitt von 31,7 EUR. 35 Im langfristigen Vergleich liegt die Arbeitsproduktivität pro Stunde in Österreich um knapp 6% unter dem Wert von Deutschland. Lediglich im Krisenjahr 2009 führte der stärkere Konjunktureinbruch in Deutschland dazu, dass sich die Produktivitätsniveaus kurzfristig anglichen.
Vergleich man die Arbeitsproduktivität pro Kopf, so liegt diese in Österreich um durchschnittlich 12% über dem deutschen Wert. Dies ist auf die in Österreich deutlich höhere Zahl der geleisteten Arbeitsstunden je Beschäftigten (2017: 1.617 Arbeitsstunden je Beschäftigten) im Vergleich zu Deutschland (1.360 Arbeitsstunden je Beschäftigten) zurückzuführen.
Im Zeitraum 1995 bis 2017 stieg die Arbeitsproduktivität je geleisteter Arbeitsstunde in Österreich um 32,5% und damit gleich stark wie in Deutschland (32,8%) und im Euroraum (32,1%). Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 1,3%. Das Produktivitätswachstum war in Österreich in den Jahren unmittelbar nach dem EU-Beitritt bis 2007 (also vor der Wirtschafts- und Finanzkrise) mit 2% deutlich stärker als in den Jahren danach, aber höher als in Deutschland (1,5%) und im Euroraum (1,4%). Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise schwächte sich das Produktivitätswachstum in Österreich auf durchschnittlich 0,5% ab und war damit niedriger als in Deutschland (0,8%) und als im Euroraum (0,9%).
Das Wachstum der Arbeitsproduktivität pro Kopf blieb in den Jahren 1995 bis 2017 mit einem Plus von 23,8% oder 1% pro Jahr deutlich hinter jenem je geleisteter Arbeitsstunde zurück. Der starke Anstieg der Teilzeitquote in Österreich führt dazu, dass das Wachstum der Arbeitsproduktivität pro Kopf niedriger ausfällt. Diese Entwicklung muss bei der Interpretation dieses Maßes berücksichtigt werden. Im Weiteren verwenden wir daher ausschließlich die Arbeitsproduktivität je geleisteter Arbeitsstunde als Maßzahl für die Produktivitätsanalyse.
1.2 Die sektorale Dimension der Arbeitsproduktivität
In diesem Abschnitt widmen wir uns der Bedeutung einzelner Wirtschaftssektoren für die gesamtwirtschaftliche Produktivität. Eingangs stellen wir die Frage, welche Branchen in welchem Ausmaß zur gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung seit dem Jahr 1995 beigetragen haben. Danach analysieren wir für den gleichen Zeitraum die Auswirkungen des Strukturwandels (Veränderungen der relativen Bedeutung einzelner Branchen) auf die Produktivitätsentwicklung. Hierzu präsentieren wir die Ergebnisse einer Shift-Share-Analyse. Im Rahmen dieser Analyse kann die Produktivitätsentwicklung auf drei Effekte zurückgeführt werden: Erstens auf einen „Intra-Industrie-Effekt“ 36 , der jenen Teil des Produktivitätswachstums beschreibt, wenn es zu keinen Verschiebungen zwischen den Wirtschaftssektoren kommt; zweitens auf einen strukturellen „Shift-Effekt“, der die Auswirkungen von Änderungen der sektoralen Beschäftigungsanteile auf das gesamtwirtschaftliche Produktivitätswachstum beschreibt; und drittens auf einen strukturellen „Interaktions-Effekt“, der die Wechselbeziehung zwischen dem sektoralen Produktivitätswachstum und den Änderungen der sektoralen Beschäftigungsanteile erfasst. Der „Shift-Effekt“ und der „Interaktions-Effekt“ messen zusammen die Auswirkungen von sektoralen Strukturveränderungen auf das gesamtwirtschaftliche Produktivitätswachstum. Zu Details betreffend die Shift-Share-Analyse siehe Kasten 1.
In einer Reihe von Branchen stellt die Messung der Produktivität ein großes Problem dar. Im öffentlichen Sektor stellt sich das Problem der Output-Messung (die oft kostenseitig erfolgt). Im Realitätenwesen ist die Produktivität durch ein ungewöhnlich hohes Verhältnis von Wertschöpfung zu Beschäftigung verzerrt (u .a. durch imputierte Mieten, auf die mehr als die Hälfte der Wertschöpfung im Realitätenwesen entfällt). In der Landwirtschaft ist die Produktivitätsentwicklung durch einen hohen Grad an Nebenerwerbstätigkeit bestimmt, der jedoch im Zeitablauf deutlich zurückgeht. Aus diesen Gründen erfolgt unsere weitere Analyse unter Ausschluss der genannten drei Sektoren. Die Daten sind daher nicht unmittelbar mit den Ergebnissen anderer Studien vergleichbar, die die gesamtwirtschaftliche Produktivitätsentwicklung analysieren (siehe z. B. Schneider, 2014). Die Datenbasis unserer Analyse ist die KLEMS-Datenbank (Stehrer et al., 2019), die wiederum in vielen Bereichen auf Daten von Eurostat basiert. 37 Die Branchenaufgliederung erfolgt auf Ebene der NACE-Einsteller. Die Produktivität wird immer auf Basis der geleisteten Arbeitsstunden gemessen.
Tabelle 1 zeigt die Bedeutung der für die weitere Analyse verwendeten Wirtschaftssektoren für die Gesamtwirtschaft. 38 Die Beschäftigung aller betrachteten Branchen deckt im langfristigen Durchschnitt 1995 bis 2017 rund 70% der Gesamtbeschäftigung ab, die Wertschöpfung rund 72%. Die bezüglich der Wertschöpfung wichtigste Branche ist die Sachgütererzeugung (C) mit einem Anteil von 18%, gefolgt von den Dienstleistungsbranchen Handel (G) mit 12% und Wissenschaftliche und sonstige Dienstleistungen (M-N) und dem Bausektor mit jeweils 8%. Zusätzlich zeigt die Tabelle die Bedeutung aller privater Dienstleistungssektoren für die Gesamtwirtschaft (G-K, M, N und R-T, siehe Fußnote 5). In Summe decken alle Dienstleistungssektoren im langfristigen Durchschnitt 46% der Gesamtbeschäftigung und knapp 42% der realen gesamten – nach unserer eingeschränkten Version – Wertschöpfung Österreichs ab.
Die linke Abbildung in Grafik 2 zeigt das Wachstum der Arbeitsproduktivität und die Hauptergebnisse der Shift-Share-Analyse für Österreich für unterschiedliche Zeiträume. Der in der Literatur oft beschriebene langfristige Rückgang der Produktivitätsdynamik ist auch für Österreich feststellbar. Während die durchschnittliche Wachstumsrate der Stundenproduktivität in den Jahren 1995 bis 2007 noch bei 2,0% lag, erreichte sie im Zeitraum 2014 bis 2017 nur rund 1,0%. Im Jahr 2017 betrug sie zwar 1,5%, lag aber immer noch deutlich unter dem Höchstwert von 3,5% im Jahr 1998. Der deutliche Einbruch der Produktivitätsdynamik aufgrund der Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009 konnte in den Folgejahren nicht mehr vollständig aufgeholt werden.
| Sektoren | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sektorale Beschäftigungsanteile | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M–N | R | S | T | Dienstleistungen1 (G–T) | Gesamt |
| in % der geleisteten Arbeitsstunden in der Gesamtwirtschaft – NACE A bis U | |||||||||||||||
| 1995–2001 | 17,0 | 0,8 | 0,5 | 7,2 | 14,8 | 6,0 | 6,7 | 2,2 | 3,1 | 7,0 | 1,1 | 2,3 | 0,3 | 43,6 | 69,0 |
| 2002–2007 | 15,7 | 0,7 | 0,5 | 6,6 | 14,8 | 6,0 | 6,9 | 2,6 | 3,1 | 9,2 | 1,3 | 2,4 | 0,2 | 46,4 | 69,9 |
| 2008–2013 | 14,9 | 0,7 | 0,6 | 6,9 | 14,5 | 5,5 | 7,1 | 2,5 | 3,2 | 11,0 | 1,4 | 2,5 | 0,2 | 47,8 | 70,8 |
| 2014–2017 | 14,7 | 0,6 | 0,6 | 6,8 | 14,2 | 5,4 | 7,2 | 2,9 | 2,9 | 11,9 | 1,4 | 2,6 | 0,1 | 48,6 | 71,3 |
| 1995–2017 | 15,7 | 0,7 | 0,5 | 6,9 | 14,6 | 5,8 | 6,9 | 2,5 | 3,1 | 9,4 | 1,3 | 2,4 | 0,2 | 46,2 | 70,1 |
| Sektorale Wertschöpfungsanteile | in % der gesamtwirtschaftlichen realen Wertschöpfung – NACE A bis U | ||||||||||||||
| 1995–2001 | 16,9 | 2,7 | 1,3 | 9,5 | 12,6 | 6,5 | 5,3 | 2,8 | 3,4 | 6,6 | 1,4 | 1,8 | 0,2 | 40,4 | 70,9 |
| 2002–2007 | 17,4 | 2,9 | 1,1 | 8,6 | 12,5 | 6,2 | 5,1 | 3,4 | 4,0 | 7,8 | 1,3 | 1,6 | 0,1 | 42,0 | 72,0 |
| 2008–2013 | 17,9 | 2,2 | 0,9 | 7,1 | 12,2 | 5,8 | 5,2 | 3,4 | 4,5 | 8,9 | 1,3 | 1,5 | 0,1 | 43,0 | 71,1 |
| 2014–2017 | 19,0 | 1,9 | 1,0 | 6,3 | 12,0 | 5,7 | 5,1 | 3,5 | 4,3 | 9,6 | 1,3 | 1,5 | 0,1 | 43,0 | 71,3 |
| 1995–2017 | 17,7 | 2,5 | 1,1 | 8,1 | 12,4 | 6,1 | 5,2 | 3,2 | 4,0 | 8,0 | 1,3 | 1,6 | 0,1 | 41,9 | 71,3 |
| Sektorales Produktivitätswachstum | Durchschnittliche Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||||||||||
| 1995–2001 | 3,7 | 7,9 | 1,0 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | –0,1 | –0,1 | 5,9 | –1,0 | –1,4 | –0,3 | –3,1 | 1,1 | 1,8 |
| 2002–2007 | 4,3 | 0,3 | –1,2 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 0,8 | 5,2 | 4,7 | 1,3 | 0,1 | 0,8 | –1,6 | 2,0 | 2,0 |
| 2008–2013 | 1,5 | –1,6 | –1,1 | –3,2 | 0,4 | 1,1 | 1,0 | –1,2 | 1,3 | 0,4 | –0,5 | –0,5 | –1,9 | 0,4 | 0,5 |
| 2014–2017 | 2,9 | 1,3 | 1,9 | –0,6 | 1,4 | 1,0 | –0,8 | –0,2 | 2,9 | 0,5 | 0,4 | –1,5 | 4,1 | 0,7 | 1,0 |
| 1995–2017 | 3,1 | 2,0 | –0,0 | –0,5 | 1,3 | 1,5 | 0,3 | 1,0 | 3,8 | 0,3 | –0,4 | –0,3 | –1,1 | 1,0 | 1,3 |
| Quelle: Eurostat, eigene Berechnungen. | |||||||||||||||
| 1 Nach unserer Brachendefinition sind die Dienstleistungssektoren L („Realitätenwesen“) und O-Q („Öffentliche Verwaltung, Bildung und Gesundheit“) hier nicht enthalten. | |||||||||||||||
| Anmerkung: Für die Sektorbezeichnungen siehe Fußnote 5 im Text. | |||||||||||||||
Die Shift-Share-Analyse zerlegt das gesamtwirtschaftliche Produktivitätswachstum in ein intrasektorales Produktivitätswachstum (der „Intra-Industrie-Effekt“) und in die Effekte sektoraler Strukturverschiebungen. Generell würden wir erwarten, dass im Lauf der Zeit aufgrund des permanenten Wettbewerbsdrucks eine laufende Strukturverschiebung hin zu produktiveren Branchen stattfindet. Dies würden wir besonders für die Zeit nach der Krise erwarten. In unserer Analyse entspräche dies einem positiven Wachstumsbeitrag des Strukturveränderungseffekts (Shift-Effekt plus Interaktions-Effekt) zum gesamten Wachstum der Arbeitsproduktivität. 39 Wir kommen allerdings zum gegenteiligen Ergebnis: Der Strukturveränderungseffekt trägt negativ zum gesamtwirtschaftlichen Produktivitätswachstum bei, auch wenn die Beiträge insgesamt vergleichsweise gering sind. Im Zeitablauf ist dieser dämpfende Effekt weitgehend stabil. Das bedeutet, dass Branchen mit hoher Produktivität zugunsten von Branchen mit niedriger Produktivität an Bedeutung verloren haben. So gehen beispielsweise die Beschäftigungsanteile in der überdurchschnittlich produktiven Industrie (Sektoren C–E) zurück (siehe Tabelle 1), während unterdurchschnittlich produktive Dienstleistungssektoren (insbesondere „freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen sowie sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen“; Sektoren M–N) Beschäftigungsanteile gewinnen. Diese Strukturveränderungen dämpfen das gesamtwirtschaftliche Produktivitätswachstum. Dies ist auch aus Tabelle 1 ersichtlich. Der Anteil der Beschäftigung im Dienstleistungssektor insgesamt stieg von 43,6% (Durchschnitt der Jahre 1995 bis 2001) um 5 Prozentpunkte auf 48,6% (Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2017). Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil an der realen Wertschöpfung um 2,6 Prozentpunkte. Im dem exponierteren aber aufgrund der sehr guten Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit sehr kompetitiven Sektor der Herstellung von Waren (C) ist der Wertschöpfungsanteil im gleichen Zeitraum mit 2,1 Prozentpunkten ähnlich zum Dienstleistungssektor angestiegen. Dieser Anstieg war aufgrund des höheren Produktivitätswachstums aber von einem Rückgang des Beschäftigungsanteils von 2,3 Prozentpunkten begleitet. Der durchschnittliche jährliche Produktivitätsanstieg lag im Zeitraum 1996 bis 2017 bei der Herstellung von Waren bei 3,0% und bei den Dienstleistungen bei 1,0%.
Das gesamtwirtschaftliche Produktivitätswachstum wird vom Produktivitätswachstum innerhalb der Sektoren getragen. Dieser Intra-Industrie-Effekt ist als hellgrüner Balken in der linken Abbildung von Grafik 2 aufgetragen. Die rechte Abbildung in Grafik 2 zeigt die Wachstumsbeiträge der Wirtschaftssektoren gemäß NACE-Einstellern zum Intra-Industrie-Effekt. Die Wirtschaftsbranchen trugen in einem sehr unterschiedlichen Ausmaß zum Intra-Industrie-Effekt bei. Herausragend ist die Bedeutung der Sachgütererzeugung (Sektor C) für das Produktivitätswachstum. Im Zeitraum von 1995 bis 2017 zeichnet dieser Sektor für knapp über 50% des gesamtwirtschaftlichen Produktivitätswachstum verantwortlich; das ist deutlich mehr als der Wertschöpfungsanteil von 25% (gemessen an unserer Branchendefinition) erwarten ließe. Besonders hoch ist die relative Bedeutung im Zeitraum während und nach der Krise (2008–2013), der auch die krisenbedingten Nachholeffekte in den Folgejahren des Wirtschaftseinbruchs umfasst. Obwohl das Produktivitätswachstum der Sachgüterindustrie in diesem Zeitraum mit 1,5% pro Jahr auf die Hälfte des langjährigen Durchschnitts zurückging, erklärt es 90% des gesamtwirtschaftlichen Produktivitätswachstums. Hintergrund ist die sehr schwache Entwicklung in zahlreichen anderen Sektoren, insbesondere in der Bauwirtschaft, die stark negativ zum gesamtwirtschaftlichen Produktivitätswachstum beitrug. Die Bauwirtschaft (Sektor F) ist neben den öffentlichen Dienstleistungen (Sektoren R–T) auch der einzige Sektor, der über den gesamten Beobachtungszeitraum von 1995 bis 2017 im Durchschnitt keinen positiven Beitrag zum Produktivitätswachstum leistete. Die privaten Dienstleistungen erklären rund 45% des Produktivitätswachstums und damit weniger, als ihrem Wertschöpfungsanteil von 55% entspräche.
Die Shift-Share-Analyse
Die hier durchgeführte Shift-Share-Analyse der Produktivität pro geleisteter Arbeitsstunde basiert auf European Commission (2003, 110 ff) 40 . Die Produktivität pro geleisteter Arbeitsstunde (Pt) ist wie folgt definiert:
(1)
wobei Yi,t für die reale Wertschöpfung im Sektor i zum Zeitpunkt t steht und Li,t für die geleisteten Arbeitsstunden. Nach Bildung erster Differenzen und einigen Umformungen erhält man folgende in drei Terme untergliederte Gleichung für die Shift-Share-Analyse:
(2)
wobei Variablen in Kleinbuchstaben die jeweiligen Industrieanteile an den gesamtwirtschaftlichen Werten bezeichnen. Das Wachstum der Produktivität pro geleisteter Arbeitsstunde untergliedert sich in einen Intra-Industrie-Effekt (erster Term auf der rechten Seite von Gleichung 2), einen Shift-Effekt (zweiter Term) und einen Interaktions-Effekt (dritter Term).
Der Intra-Industrie-Effekt ist als die Summe der sektoralen Produktivitätswachstumsraten, gewichtet mit dem Anteil des jeweiligen Wirtschaftssektors an der gesamtwirtschaftlichen realen Wertschöpfung, definiert. Er bestimmt jenen Teil des Produktivitätswachstums, der sich ergibt, wenn es zu keinen Verschiebungen zwischen den Wirtschaftssektoren kommt (d. h. die relative Größe der Wirtschaftssektoren, gemessen an ihren Output-Anteilen, unverändert bleibt). In empirischen Untersuchungen ist der Intra-Industrie-Effekt typischerweise der wichtigste Bestimmungsfaktor des Produktivitätswachstums.
Effekte von sektoralen Verschiebungen der Beschäftigungsstruktur auf das Produktivitätswachstum werden durch den Shift-Effekt gemessen. Er ist definiert als Summe der Änderungen der sektoralen Beschäftigungsanteile, gewichtet mit den relativen Produktivitätsniveaus. Eine Verschiebung des Anteils an den gesamtwirtschaftlichen geleisteten Arbeitsstunden hin zu Sektoren mit einer überdurchschnittlichen Produktivität trägt positiv zum gesamtwirtschaftlichen Produktivitätswachstum bei.
Die dritte Komponente („Interaktions-Effekt“) erfasst die dynamische Komponente des Strukturwandels, indem die Wechselbeziehung zwischen sektoralem Produktivitätswachstum und den Änderungen der sektoralen Beschäftigungsanteile gemessen wird. Gewinnen Sektoren mit einem höheren Produktivitätswachstum Beschäftigungsanteile, so ist der Interaktionsterm positiv, verlieren sie Beschäftigungsanteile, ist er negativ. Im ersten Fall wirken der Intra-Industrie-Effekt und der Shift-Effekt komplementär, im zweiten Fall substitutiv. Quantitativ ist der Interaktionsterm in der Regel sehr niedrig, weil er sich aus der Multiplikation von zwei Veränderungsraten ergibt. Empirische Untersuchungen finden meist einen negativen Beitrag zum Produktivitätswachstum.
Der „Shift-Effekt“ und der „Interaktions-Effekt“ messen zusammen die Auswirkungen von sektoralen Strukturveränderungen auf das gesamtwirtschaftliche Produktivitätswachstum.
1.3 Beiträge der Produktionsfaktoren zur Arbeitsproduktivität
In der EU-KLEMS-Datenbank werden die Beiträge der Produktionsfaktoren zum Wachstum der Arbeitsproduktivität ausgewiesen. Dabei wird das Wachstum der Arbeitsproduktivität in seine Beiträge aus der Veränderung der Beschäftigungsstruktur, der Vertiefung des Informations- und Kommunikationstechnologie-Kapitals (IKT), der Vertiefung des Nicht-IKT-Kapitals, der Vertiefung des intangiblen Kapitals und der Gesamtfaktorproduktivität zerlegt. 41
Grafik 3 zeigt die Zerlegung für Österreich, Deutschland und die EU-20 42 für den Zeitraum 1996 bis 2017. Für die EU-20 stehen die Daten erst ab 2009 zur Verfügung. Der mit Abstand stärkste Beitrag zum Produktivitätswachstum kommt in Österreich (wie auch in Deutschland) von der Gesamtfaktorproduktivität (GFP). Im Durchschnitt der Jahre 1996 bis 2017 erklärt die GFP mehr als die Hälfte (0,8 Prozentpunkte) des gesamten Produktivitätswachstums von 1,5% p.a. In Deutschland spielt die GFP ebenso die wichtigste Rolle. Der zweitwichtigste Faktor ist die Vertiefung des Nicht-IKT-Kapitals (0,3 Prozentpunkte). In Österreich wurde das Produktivitätswachstum in der Vergangenheit auch noch durch die Veränderung der Beschäftigungsstruktur getrieben (0,2 Prozentpunkte). Dieser Beitrag hat sich jedoch sukzessive abgeschwächt und ist seit dem Jahr 2014 auf null zurückgegangen. Der Beitrag des intangiblen Kapitals liegt relativ konstant bei 0,1 Prozentpunkten. Die Rolle des IKT-Kapitals ist mit einem Wachstumsbeitrag von 0,03 Prozentpunkten zu vernachlässigen.
Die Entwicklung der Arbeitsproduktivität in Österreich und Deutschland unterscheidet sich vor allem in den ersten beiden Subperioden. In Österreich beschleunigte sich das Produktivitätswachstum in den 2000er-Jahren gegenüber der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre, während in Deutschland eine Verlangsamung zu beobachten war. Seit der Wirtschafts- und Finanzkrise verlief die Entwicklung ähnlich.
2 Gewinnentwicklung
Die Profitabilität von Unternehmen ist ein wichtiger Indikator der Wettbewerbsfähigkeit. Sie ist die Grundlage für die Fähigkeit zu investieren und stärkt die Widerstandskraft gegenüber Abschwüngen. In diesem Abschnitt wird die Profitabilität anhand von zwei Datenquellen – der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) und den Unternehmensbilanzen laut BACH-Datenbasis – dargestellt.
2.1 Gewinnentwicklung laut Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung
Die Gewinnquote ist definiert als Anteil der Nettobetriebsüberschüsse (Brutto-Betriebsüberschüsse minus Abschreibungen) an der Wertschöpfung (Brutto-Wertschöpfung zu Marktpreisen abzüglich Abschreibungen sowie Produktionssteuern minus Subventionen):
(1)
wobei GQ für die Gewinnquote steht, GOS für die Brutto-Betriebsüberschüsse, D für die Abschreibungen und T für die Produktionssteuern minus Subventionen. Schreibt man die Variablen auf der rechten Seite von Gleichung (1) in Prozent der Wertschöpfung, so erhält man:
,
(2)
Kleinbuchstaben bezeichnen die entsprechenden Variablen in Prozent der Wertschöpfung. Aus Gleichung (2) ist unmittelbar ersichtlich, dass Anstiege der Betriebsüberschüsse zu einer Erhöhung der Gewinnquote führen, während höhere Abschreibungen die Gewinnquote verringern.
| 1995 | 2007 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| in % | |||
| Gewinnquote | 29,6 | 37,1 | 31,3 |
| 1995–2018 | 1995–2007 | 2007–2018 | |
| in Prozentpunkten | |||
| Veränderung der Gewinnquote | 1,6 | 7,4 | –5,8 |
| davon: | in Prozentpunkten | ||
| Veränderung Betriebsüberschüsse | 3,8 | 8,1 | –4,4 |
| Abschreibungen | –2,2 | –0,5 | –1,5 |
| Gütersteuern | –0,0 | –0,1 | 0,1 |
| Diskrepanz | –0,0 | 0,0 | –0,1 |
| Quelle: Eurostat, eigene Berechnungen. | |||
In der Periode 1995 bis 2018 stieg die Gewinnquote in Österreich nur geringfügig von 29,6% auf 31,3%. Diese scheinbar stabile Entwicklung verdeckt aber starke Veränderungen im Zeitablauf. In den ersten Jahren stieg die Gewinnquote um 7,4 Prozentpunkte und erreichte im Jahr 2008 mit 37,1% den höchsten Wert im Beobachtungszeitraum. Mit dem Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise setzte ein Trendumkehr ein, und die Gewinnquote sank in den Jahren 2007 bis 2018 um 5,8 Prozentpunkte.
Dieses Muster ist für alle wichtigen Wirtschaftssektoren zu beobachten, am ausgeprägtesten ist es allerdings für den Industriesektor. Im Bereich der Marktdienstleistungen ist die Gewinnquote im Zeitablauf hingegen deutlich stabiler. Die höchsten Gewinnquoten weisen die Sektoren Landwirtschaft und Realitätenwesen auf, beide werden jedoch aus weiter oben ausgeführten Gründen nicht in der Analyse berücksichtigt. Auffallend auf Einzelsektorenebene ist ein über den gesamten Zeitraum stetig steigender Trend im Bereich der Transportdienstleistungen und ein stetig fallender Trend bei den Finanzdienstleistungen.
| Gesamt | B-E | F | G-N ohne L | O-U | Gesamt ohne A,L,O-U | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in % | ||||||
| 1996 | 29,6 | 24,1 | 30,7 | 31,7 | 11,9 | 29,0 |
| 1997 | 30,3 | 26,5 | 33,9 | 31,7 | 12,2 | 30,2 |
| 1998 | 30,9 | 29,5 | 31,7 | 32,2 | 11,4 | 31,2 |
| 1999 | 31,3 | 28,7 | 34,4 | 32,5 | 12,5 | 31,5 |
| 2000 | 31,1 | 30,2 | 34,8 | 30,7 | 12,5 | 31,0 |
| 2001 | 32,1 | 31,6 | 35,1 | 32,6 | 12,5 | 32,6 |
| 2002 | 32,4 | 33,2 | 34,2 | 32,4 | 12,6 | 32,9 |
| 2003 | 32,8 | 32,1 | 36,6 | 33,3 | 12,7 | 33,3 |
| 2004 | 32,9 | 32,0 | 41,0 | 32,7 | 12,6 | 33,4 |
| 2005 | 34,4 | 35,5 | 42,3 | 32,9 | 12,9 | 34,9 |
| 2006 | 35,4 | 36,7 | 42,7 | 33,8 | 13,3 | 35,7 |
| 2007 | 36,3 | 39,6 | 41,3 | 34,7 | 13,1 | 37,0 |
| 2008 | 37,1 | 40,7 | 42,5 | 35,7 | 13,3 | 38,1 |
| 2009 | 35,6 | 37,2 | 42,0 | 35,2 | 13,1 | 36,6 |
| 2010 | 32,6 | 32,5 | 39,4 | 32,3 | 12,7 | 33,1 |
| 2011 | 33,0 | 33,8 | 37,4 | 32,7 | 12,2 | 33,6 |
| 2012 | 33,6 | 33,7 | 36,5 | 33,7 | 12,4 | 34,0 |
| 2013 | 32,2 | 32,1 | 36,0 | 31,4 | 12,3 | 32,1 |
| 2014 | 31,1 | 29,8 | 36,5 | 29,7 | 12,2 | 30,5 |
| 2015 | 31,2 | 29,2 | 35,2 | 30,4 | 12,7 | 30,5 |
| 2016 | 31,2 | 30,0 | 34,2 | 30,8 | 12,5 | 30,9 |
| 2017 | 31,5 | 31,5 | 34,8 | 30,1 | 12,3 | 31,0 |
| 2018 | 31,6 | 32,2 | 36,5 | 29,6 | 12,1 | 31,1 |
| Quelle: Eurostat, eigene Berechnungen. | ||||||
| Anmerkung: Für die Sektorbezeichnungen siehe Fußnote 5 im Text. | ||||||
Im Gegensatz zu Österreich ist die Gewinnquote im EU-Durchschnitt im Beobachtungszeitraum von 33,9% im Jahr 1995 auf 32,9% im Jahr 2018 leicht gesunken. Mit Ausnahme der Jahre 2006 bis 2008 liegt das Niveau der Gewinnquote im EU-Durchschnitt jedoch über jenem in Österreich. In den Jahren bis zum Ausbruch der Finanzkrise weist die Gewinnquote im EU-Durchschnitt keinen steigenden Trend auf. In Deutschland entwickelte sich die Gewinnquote sehr ähnlich wie in Österreich, im Niveau liegt sie jedoch durchschnittlich um 2½ Prozentpunkte unter jener in Österreich.
2.2 Gewinnentwicklung laut Firmenbilanzen
In diesem Abschnitt werden ausgewählte Profitabilitätsindikatoren aus der BACH-Datenbank dargestellt. Diese enthält international harmonisierte Bilanzdaten für neun europäische Länder für die Jahre 2000 bis 2017. Insgesamt sind 113 Bilanzkennzahlen für 88 NACE-2-Steller verfügbar. Neben den Mediankennzahlen eines Sektors sind auch Werte für Firmengrößenklassen und Quartile der Verteilung vorhanden. Wir analysieren die Entwicklung der Profitabilität anhand der Kennzahlen EBITDA zu Nettoumsatz (R33) und Eigenkapitalrendite (R38).
Das EBITDA beschreibt die operative Leistungsfähigkeit vor dem Abzug von Investitionsaufwendungen. Das Verhältnis von EBITDA zu Nettoumsatz (R33) stellt damit die Umsatzrendite dar. Diese verharrte von 2000 bis 2013 relativ stabil im Bereich von 10–12%. Seit 2014 ist jedoch ein Anstieg zu beobachten. Österreich liegt damit im oberen Bereich im Vergleich zu Belgien, Deutschland, Frankreich und Italien. 43 Die Eigenkapitalrendite (R38) wird als das Verhältnis von Gewinnen zu Eigenkapital berechnet. Sie weist einen ähnlichen Verlauf wie die Umsatzrendite auf, reagiert jedoch stärker auf zyklische Entwicklungen. Dies lässt sich deutlich aus dem Anstieg in den Hochkonjunkturjahren vor der Krise und dem Einbruch während der Krise ablesen. Hier liegen die österreichischen Unternehmen ebenfalls im oberen Bereich der betrachteten vier Länder.
Die Gewinnkennzahlen laut Unternehmensbilanzen haben im Vergleich zur Gewinnquote lt. VGR einen anderen Verlauf. Während die Unternehmensbilanzen auf eine relativ stabile Gewinnentwicklung in den Jahren 2000 bis 2012 ohne nennenswerten Einbruch während der Krise und einen Anstieg in den Jahren 2013 bis 2017 hinweisen, zeigt die VGR einen stetigen Anstieg der Gewinnquote bis vor der Krise und einen Rückgang seither an (Tabelle 2). Die Gewinnkennzahlen laut Unternehmensbilanzen und VGR weisen jedoch erhebliche konzeptionelle Unterschiede auf und sind daher nur bedingt vergleichbar. Ein wesentlicher Punkt liegt in der unterschiedlichen Berechnung der Abschreibungen. Die VGR verwendet zur Berechnung laufende Marktpreise, während in den Unternehmensbilanzen üblicherweise Anschaffungspreise verwendet werden, was in Zeiten steigender Preise für Kapitalgüter zu signifikanten Unterschieden führen kann. Weitere wichtige Unterschiede bestehen in der Bewertung der Lagerbestände, der Behandlung von geistigem Eigentum und Leasing sowie der Berücksichtigung außergewöhnlicher Transaktionen wie Kapitalgewinne/-verluste. In der VGR werden weiters Vermögenseinkommen berücksichtigt, und es werden in manchen Sektoren Zuschätzungen für Betrug vorgenommen. Bei multinationalen Unternehmen werden in der VGR nur die im Inland erzielten Gewinne ausgewiesen, während in den Unternehmensbilanzen auch die im Ausland erwirtschafteten Gewinne enthalten sind. Dadurch können auch Unterschiede in der Steuerpolitik bezüglich multinationaler Unternehmen einen Einfluss auf die Gewinnquoten gemäß VGR und BACH-Daten haben. Für eine detaillierte Erläuterung siehe Lequiller und Blades (2014, S. 220 ff).
Wie hängen Produktivität und Profitabilität zusammen?
Die Arbeitsproduktivität beschreibt das Verhältnis der produzierten Menge im Verhältnis zur eingesetzten Menge an Arbeit. Sie hängt von einer Reihe technischer Faktoren ab und ist darüber hinaus konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Die Profitabilität beschreibt die Ertragskraft von Unternehmen. Die Gewinne sind dabei definiert als die Differenz zwischen nominellen Erträgen und den Kosten der Produktion. Wenn sie zu einer Referenzgröße wie Eigenkapital, Gesamtkapital oder Umsatz in Relation gesetzt werden, erhält man Maßzahlen für die Profitabilität. Für den Zusammenhang zwischen Arbeitsproduktivität und Profitabilität siehe z. B. Genscá-Garrigos und Griffel-Tatjé (1992) oder Grifell-Tatjé und Lovell (1999). Die Profitabilitätsentwicklung wird durch die Produktivität beeinflusst. Letztere ist jedoch bei weitem nicht die einzige Determinante (siehe Abschnitt 2.2). Die Profitabilitätsentwicklung auf Unternehmensebene wird in der empirischen Literatur üblicherweise in drei Faktoren zerlegt: erstens in die Entwicklung der Produktivität, zweitens in einen Preiseffekt (Veränderung von Input- und Output-Preisen); drittens in einen Aktivitätseffekt. Dieser umfasst Veränderungen in den Skalenerträgen und – allerdings weniger häufig – der Ausrichtung der wirtschaftlichen Aktivität des Unternehmens. Empirisch lässt sich anhand der BACH-Daten kein enger Zusammenhang zwischen gesamtwirtschaftlicher Arbeitsproduktivität und Gewinnkennzahlen erkennen.
Die makroökonomische Gewinnquote gibt – vereinfacht dargestellt – an, welcher Anteil des Bruttoinlandsprodukts dem Produktionsfaktor Kapital zufließt. Empirisch ist ein enger Zusammenhang zwischen der Veränderung der makroökonomischen Gewinnquote gemäß VGR und dem Wachstum der Stundenproduktivität in Österreich zu erkennen. Dies gilt sowohl im längerfristigen Trend als auch für kurzfristige Schwankungen. Die Zeit seit dem EU-Beitritt lässt sich in zwei Perioden mit stark unterschiedlichen Trends einteilen. Die Jahre bis zur Wirtschafts- und Finanzkrise waren durch ein hohes Produktivitätswachstum und einen Anstieg der Gewinnquote gem. VGR gekennzeichnet, die Jahre danach durch ein niedriges Produktivitätswachstum bei gleichzeitigem Rückgang der Gewinnquote. Auch innerhalb dieser beiden Perioden weisen beide Größen einen engen Gleichlauf auf. Das spiegelt die Tatsache wider, dass die Wertschöpfung deutlich stärker schwankt als die Beschäftigung und die Stundenlöhne.
3 Schlussfolgerungen
Im Zeitraum seit dem Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 1995 bis zum Jahr 2017 liegt das Niveau der Arbeitsproduktivität pro geleisteter Arbeitsstunde in Österreich durchschnittlich rund 20% über jenem der EU-28, jedoch 6% unter dem des wichtigsten Handelspartners Deutschland. Diese Abstände haben sich im Zeitablauf nicht wesentlich geändert.
Hingegen sind – dem internationalen Trend folgend – im Zeitablauf deutliche Änderungen beim Produktivitätswachstum zu erkennen. Während die durchschnittliche Wachstumsrate der Stundenproduktivität in den Jahren vor dem Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2008 noch bei 2,0% lag, betrug sie in den Jahren seit der Krise weniger als 1,0%. Gleichzeitig waren die Jahre mit hohem Produktivitätswachstum vor der Wirtschafts- und Finanzkrise durch einen Anstieg der Gewinnquote (+7 Prozentpunkte auf 37% im Jahr 2007) gekennzeichnet, die Jahre mit niedrigen Produktivitätswachstum danach durch einen Rückgang der Gewinnquote (–6 Prozentpunkte auf 31% im Jahr 2017).
Eine Shift-Share-Analyse auf sektoraler Ebene zeigt, dass das Produktivitätswachstum in Österreich in hohem Maße durch das Produktivitätswachstum innerhalb einzelner Branchen erklärt wird. Hingegen dämpfen Strukturveränderungen (Verschiebungen relativer Wertschöpfungs- und Beschäftigungsanteile einzelner Branchen an der Gesamtwirtschaft) das gesamtwirtschaftliche Produktivitätswachstum. Für den Zeitraum von 1995 bis 2017 haben demnach Branchen mit hoher Produktivität zugunsten von Branchen mit niedriger Produktivität an Bedeutung verloren. Wichtigster Treiber sind die rückläufigen Beschäftigungsanteile im hochproduktiven Industriesektor, während der weniger produktive Dienstleistungssektor Beschäftigungsanteile gewonnen hat.
Das Wachstum der Arbeitsproduktivität im Dienstleistungssektor blieb über den gesamten Beobachtungszeitraum hinter jenem des Industriesektors zurück, wobei sich die einzelnen Dienstleistungsbereiche sehr heterogen entwickelt haben. Das Produktivitätswachstum im Bereich der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (Sektor K) übertraf sogar jenes in der Industrie (C), während das Wachstum in Gastronomie und Beherbergung (I) oder bei der Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (M-N) nahezu stagnierte. Die Gründe für das schwache Wachstum der Arbeitsproduktivität in Dienstleistungssektor sind vielfältig. Der wirtschaftspolitisch gewünschte Anstieg der Erwerbsquoten wurde durch den vermehrten Zugang von weniger produktiven Erwerbspersonen vor allem im Dienstleistungsbereich erreicht. Der Sachgütersektor hat im Zuge von Outsourcing-Strategien weniger produktive Vorleistungsprozesse in den Dienstleistungssektor ausgelagert. Aber auch die von internationalen Organisationen wie OECD und IWF regelmäßig kritisierte hohe Regulierungsdichte und Wettbewerbsbeschränkungen in einzelnen Dienstleistungsbereichen tragen zur schwachen Entwicklung der Arbeitsproduktivität im Dienstleistungssektor bei. Wirtschaftspolitisch erscheint daher eine maßvolle Erhöhung des Wettbewerbs im Dienstleistungssektor unter gleichzeitiger Sicherung des hohen Qualitätsstandards in Österreich wünschenswert.
Literatur
Beer, C., C. Belabed, A. Breitenfellner, C. Ragacs und B. Weber. 2017. Österreich und die europäische Integration. Monetary Policy & the Economy Q1/17. 86–125.
Breuss, F. 2020. Makroökonomische Effekte der 25-jährigen EU-Mitgliedschaft Österreichs. In dieser Publikation.
European Commission. 2003. The EU Economy: 2003 Review. European Economy 6/2003.
Genscá-Garrigos, E. und E. Griffel-Tatjé. 1992. Profits and Total Factor Productivity: A Comparative Analysis. Omega 20(5-6). 553–568.
Grifell-Tatjé, E. and C. A. K. Lovell. 1999. Profits and Productivity. In: Management Science Vol. 45(9). 1177–1193.
Young Eun, K. und N. V. Loayza. 2019. Productivity Growth Patterns and Determinants across the World. World Bank Policy Research Working Paper 8852.
Lequiller, F. und D. Blades. 2014. Understanding National Accounts: Second Edition. OECD Publishing.
OECD. 2018. OECD Compendium of Productivity Indicators 2018. OECD Publishing. Paris. http://dx.doi.org/10.1787/pdtvy-2018-en.
OECD. 2019. OECD Compendium of Productivity Indicators 2019, OECD Publishing. Paris. https://doi.org/10.1787/b2774f97-en .
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. 2019. Produktivität: Wachstumsbedingungen verbessern. Nationaler Produktivitätsbericht 2019. Veröffentlicht im Jahresgutachten 2019/20, Kapitel 2. https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/themen/produktivitaet.html .
Schneider, M. 2014. Labor Productivity Developments in Austria in an International Perspective. Monetary Policy & the Economy Q3/14. 13–35.
Stehrer, R., A. Bykova, K. Jäger, O. Reiter and M. Schwarzhappel. 2019. Industry Level Growth and Productivity Data with Special Focus on Intangible Assets. wiiw Statistical Report 8.
34 Oesterreichische Nationalbank, Abteilung für Volkswirtschaftliche Analysen, gerhard.fenz@oenb.at , christian.ragacs@oenb.at , martin.schneider@oenb.at , klaus.vondra@oenb.at .
35 Um die Werte international vergleichbar zu machen, wurde die reale Wertschöpfung je Land laut EU-KLEMS-Daten durch die jeweiligen Kaufkraftparitäten des Basisjahres 2010 dividiert. Die Aussagekraft des Vergleichs der Niveaus der Arbeitsproduktivität hängt damit wesentlich von der Qualität der Daten zur Kaufkraftparität ab. Genauere Informationen zum verwendeten Datenmaterial finden sich in Abschnitt 1.2.
36 Der in der Literatur standardmäßig so genannte „Intra-Industrie-Effekt“ erfasst nicht nur Veränderungen im eigentlichen Industriesektor einer Volkswirtschaft, sondern auch Veränderungen in allen Wirtschaftssektoren und somit auch in den Dienstleistungsbranchen.
37 Alle Berechnungen der aggregierten Produktivität erfolgen „bottom-up“. Für EU-Aggregate liegt für die Jahre 1995 bis 2000 und für 2017 die Branchenaufgliederung nicht vollständig vor. Für 2018 gibt es noch keine Daten. Um die Werte näherungsweise zu bestimmen, wurde ein Aggregat mit allen zur Verfügung stehenden Länderdaten berechnet und die Werte für die EU mit den Wachstumsraten dieses Aggregats verlängert. Für dieses Aggregat wurden die Wertschöpfungsdaten aller Länder mittels Kaufkraftparitäten umgerechnet.
38 Die Branchenkennziffern laut NACE beschreiben die nachfolgenden von uns betrachteten Branchen: C: Herstellung von Waren, D: Energieversorgung, E: Sammlung gefährlicher Abfälle, F: Bau, G: Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, H: Verkehr und Lagerei, I: Beherbergung und Gastronomie, J: Information und Kommunikation, K: Erbringung von Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen, M: Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, N: Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, R: Kunst, Unterhaltung und Erholung, S: Erbringung von sonstigen Dienstleistungen, T: Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt.
39 Eine vergleichend vorgenommene Analyse auf Basis aller Branchen (also inklusive der oben ausgeschlossenen Branchen) kommt genau zu diesem Effekt (ein positiver Strukturveränderungseffekt im Durchschnitt in den Jahren von 1995 bis 2017). Diese Analyse (bzw. deren Ergebnisse) ist aber verzerrt und irreführend.
40 In der Literatur zur Shift-Share-Analyse finden sich auch von Gleichung (2) leicht abweichende Aufgliederungen des Produktivitätswachstums (z. B. ohne Interaktions-Effekt). Allen Ansätzen ist aber gemein, dass sie einfache Umformungen der Definition der Produktivität darstellen. Für neuere Shift-Share-Analysen europäischer Länder sei etwa auf OECD (2018) verwiesen.
41 Die Zerlegung basiert auf einer Cobb-Douglas-Produktionsfunktion. Die Veränderung der Beschäftigungsstruktur berücksichtigt Alter, Geschlecht und Ausbildungsniveau, die Kapitalvertiefung das Wachstum der jeweiligen Kapitalkomponente abzüglich des Wachstums der geleisteten Arbeitsstunden, gewichtet mit dem Anteil der Kapitalentlohnung am gesamten Einkommen. Die Gesamtfaktorproduktivität ergibt sich als Residuum. Siehe Schneider (2014) für eine detaillierte Erläuterung der Zerlegung.
42 Das Ländersample der EU-20 orientiert sich an der Datenverfügbarkeit. Es umfasst Österreich, Belgien, Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Rumänien, Slowakische Republik, Schweden, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und das Vereinigte Königreich. Das Vereinigte Königreich wurde in dem Sample aufgenommen, da das Vereinigte Königreich während des relevanten betrachteten Zeitraums EU-Mitglied war.
43 Da die zur Erhaltung des Anlagevermögens notwendigen Ersatzinvestitionen im EBITDA noch nicht berücksichtigt wurden, ist der Vergleich von Unternehmen mit verschiedenem Abschreibungsbedarf und damit ein Branchenvergleich nur eingeschränkt möglich.
EU-Mitgliedschaft, EU-Erweiterung und die Auswirkungen auf den österreichischen Arbeitsmarkt
Alfred Stiglbauer 44
Wissenschaftliche Begutachtung: Robert Stehrer, wiiw
Seit dem EU-Beitritt kam es in Österreich zu einem Anstieg der Beschäftigung von Personen aus den „alten“ EU-Mitgliedstaaten, seit dem Jahr 2004 und insbesondere seit 2011 zu einer deutlich stärkeren Beschäftigungszunahme aus den „neuen“ EU-Mitgliedstaaten. Diese Arbeitskräfte leisten einen bedeutenden Beitrag zum heimischen Wirtschaftswachstum. Die Zuwanderung aus den neuen EU-Mitgliedstaaten lässt sich gut durch die Größe der Herkunftsländer, ihre geografische Distanz und ihren Wohlstand relativ zu Österreich erklären. Bürgerinnen und Bürger der alten EU-Mitgliedstaaten arbeiten eher im Westen Österreichs, während jene der neuen Mitgliedstaaten vornehmlich in den östlichen Bundesländern Beschäftigung finden. Die Beschäftigten aus der EU sind überwiegend männlich, jung und gut ausgebildet. Während diejenigen aus den alten Mitgliedstaaten meist als Angestellte in akademischen und technischen Berufen tätig sind, sind die Beschäftigten aus den neuen EU-Mitgliedstaaten häufig Hilfsarbeitskräfte oder arbeiten in Dienstleistungs- und Handwerksberufen. Probit-Schätzungen ergeben, dass sich das Arbeitslosigkeitsrisiko durch die Zuwanderung aus den neuen EU-Mitgliedstaaten nur geringfügig erhöht hat. Bei einigen Gruppen von Beschäftigten (Arbeiter, Beschäftigte mit überwiegend manuellen Tätigkeiten sowie vor allem Dienstleistungs- und Verkaufsberufe) ist dieser Effekt aber höher.
JEL classification: J21, J60, R10
Keywords: Europäische Union, EU-Erweiterungen, Arbeitsmarkt
Der EU-Beitritt Österreichs zog im ersten Jahrzehnt ein moderates Ansteigen der Zuwanderung von Arbeitskräften aus den alten EU-Mitgliedstaaten nach sich. Die EU-Erweiterungen 2004, 2007 und 2013 sowie die „Arbeitsmarktöffnungen“ von 2011 und 2014 gingen hingegen mit einem deutlichen Anstieg der Beschäftigung aus den neuen EU-Mitgliedstaaten einher.
Welche Folgen hatten diese Entwicklungen für den österreichischen Arbeitsmarkt? Kapitel 1 stellt die Beschäftigungsentwicklung dar und diskutiert die Bestimmungsgründe für die nach Herkunftsländern sehr unterschiedlichen Migrationszahlen. Kapitel 2 zeigt in welchen Regionen, Branchen und Berufen die Beschäftigten aus den anderen EU-Mitgliedstaaten tätig sind und welche persönlichen Charakteristika sie aufweisen. Kapitel 3 diskutiert die Auswirkungen auf den österreichischen Arbeitsmarkt, insbesondere die Frage, ob die Zuwanderung aus den neuen EU-Mitgliedstaaten das Arbeitslosigkeitsrisiko in Österreich erhöht hat. Kapitel 4 fasst zusammen und gibt einen Ausblick.
1 Arbeitskräfteeinwanderung: Eine längerfristige Perspektive
1.1 Kontinuierlicher Anstieg der Beschäftigung ausländischer Personen seit den 1990er-Jahren
Nachdem die Beschäftigung von Personen aus dem Ausland 45 in Österreich lange Zeit von „Gastarbeitern“ geprägt war, führten schon vor dem EU-Beitritt Ereignisse wie der Fall des Eisernen Vorhangs und die „Jugoslawienkriege“ zu einem deutlichen Anstieg dieser Gruppe an der Beschäftigung. Seit 1995 ist ein stetiges Ansteigen der Beschäftigung von westeuropäischen Bürgerinnen und Bürgern und später vor allem aus Zentral-, Ost- und Südosteuropa zu verzeichnen, der bis heute anhält. Der Anteil der ausländischen Beschäftigten steigt seit Ende der 1980er-Jahre stetig und beträgt derzeit (Jahresmittel 2019) durchschnittlich 21%, was 800.000 Beschäftigten entspricht (Grafik 1, linke Abbildung). Die genannten Zahlen sind Registerdaten vom Dachverband der Sozialversicherungsträger.
Die Arbeitskräfteerhebung (AKE) erfasst auch die selbstständige Beschäftigung. Nach dieser Quelle (Grafik 1, Mitte) ergibt sich für das Jahr 2019 ein Beschäftigungsanteil ausländischer Personen von 16,1% 46 . Dieser Wert ist niedriger als jener in den Registerdaten, weil es zum einen relativ wenige Selbstständige mit ausländischer Staatsbürgerschaft gibt. Zum anderen erfasst die AKE nur Beschäftigte mit Wohnsitz im Inland. Registerdaten zeigen jedoch, dass die Zahl der Beschäftigten, die ihren Wohnsitz im Ausland haben, seit 2011 stark zugenommen hat (Grafik 1, rechte Abbildung). Nicht erfasst in diesen Pendlerzahlen sind etwa 56.000 Selbstständige im Gesundheitssektor (die meisten davon aus Rumänien und der Slowakei), von denen die meisten wohl in der Hauskrankenpflege tätig sind und ebenfalls zwischen Österreich und ihren Heimatländern pendeln.
Obwohl die Teilnahme am EU-Binnenmarkt, EU-Erweiterungen und die Einführung der gemeinsamen Währung für positive Wachstumsimpulse gesorgt haben (Breuss, 2020), war das durchschnittliche Wachstum der unselbstständigen Beschäftigung mit +0,9% seit 1995 etwas niedriger als zwischen 1970 und 1994 (+1,1%). Während bis 1994 der Anteil der ausländischen Beschäftigung am gesamten Beschäftigungswachstum etwas mehr als ein Viertel (27,9%) betrug, ist dieser Beitrag seit 1995 mehr als doppelt so hoch (59,3%). Ohne diese Arbeitsmigration nach Österreich hätte sich das Wachstum der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter deutlich ungünstiger entwickelt. 47 Für die künftigen Wachstumsaussichten erscheint weitere Zuwanderung wünschenswert, weil ansonsten das Arbeitsangebot zu einer echten Beschränkung für die gesamtwirtschaftliche Produktion werden könnte (Leitner et al., 2019). 48 Ausländische Arbeitskräfte – diese stammen vor allem aus den anderen EU-Mitgliedstaaten – leisten daher auch einen wesentlichen Beitrag zum inländischen Wirtschaftswachstum (Hofer und Weyerstraß, 2016).
Die linke Abbildung in Grafik 2 veranschaulicht, dass die Entwicklung der Beschäftigung ausländischer Personen auch vom Wirtschaftswachstum abhängt. Zum einen haben ausländische Beschäftigte ein höheres Arbeitslosigkeitsrisiko als Inländische. Zum anderen wurde und wird die Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften je nach Konjunkturlage gesteuert (z. B. die frühere gezielte Anwerbung von „Gastarbeitern“ in der Hochkonjunktur sowie konjunkturell bedingte Variationen in der Anzahl der ausgestellten Beschäftigungsbewilligungen). In der rechten Abbildung von Grafik 2 sieht man, dass das Wachstum der Beschäftigung aus den EU-8-Staaten 49 ab Mitte 2011 sprunghaft angestiegen ist (Arbeitsmarktöffnung im Mai). Ähnliches gilt für Arbeitskräfte aus Bulgarien und Rumänien (EU-2) ab Anfang 2014. In beiden Fällen verringerten sich die Zuwächse im Laufe der Jahre; 2017 und 2018 kam es, konjunkturbedingt, allerdings wieder zu einem Anstieg.
Das Wachstum der Beschäftigtenzahl aus den alten EU-Mitgliedstaaten ist geringer, verläuft aber kontinuierlich. Etwa seit dem EU-Beitritt Kroatiens, Mitte 2013, ist ein stetiges Ansteigen der Arbeitnehmerzahlen aus diesem jüngsten EU-Mitgliedstaat zu beobachten. Gemessen an den früheren Erfahrungen wäre zu erwarten, dass sich diese Anstiege mit der Öffnung des Arbeitsmarkts für kroatische Arbeitskräfte im Juli 2020 verstärken. Allerdings ist auch zu bedenken, dass die Lohnunterschiede zwischen Kroatien und Österreich weniger stark ausgeprägt sind als bei den meisten anderen neuen Mitgliedstaaten. 50
In der jüngsten Hochkonjunkturphase ab 2017 fanden vermehrt Arbeitskräfte von außerhalb der EU Beschäftigung in Österreich. Dabei handelt es sich zu einem wesentlichen Teil um Flüchtlinge (vor allem aus Syrien, Afghanistan, dem Iran und dem Irak) und um Arbeitskräfte aus Südosteuropa (vor allem aus Serbien, Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo).
1.2 Deutschland und neue EU-Mitgliedstaaten als wichtige Herkunftsstaaten
Tabelle 1 zeigt die Beschäftigung nach einzelnen Herkunftsstaaten. Laut vorliegenden Daten 51 stieg die Zahl der Beschäftigten aus den alten Mitgliedstaaten zwischen 1994 und 2004 von 18.000 auf etwa 53.000. Der Großteil der Beschäftigten stammte aus Deutschland 52 und Italien. Nach 2004 war der Zuwachs etwas stärker (+48.000 zwischen 2004 und 2010 bzw. ebenfalls +48.000 seit 2010).
Bei jenen Staaten, die 2004 der EU beitraten, war (soweit hierfür Daten vorliegen) das Beschäftigungswachstum im ersten Jahrzehnt der österreichischen Mitgliedschaft in der EU eher schwach ausgeprägt. Nach dem Jahr 2004 nahm die Beschäftigung von Bürgerinnen und Bürgern aus den neuen EU-Mitgliedstaaten etwas zu. Im Jahr 2010 hatte deren Beschäftigung schon jene aus den alten EU-Mitgliedstaaten überschritten. Zwischen 2010 und 2019 hat sich die Zahl der Arbeitskräfte aus den neuen EU-Mitgliedstaaten etwa verdreifacht (mit Ungarn, Rumänien, Polen und der Slowakei als wichtigste Herkunftsstaaten). Die Zunahme an Beschäftigten aus den neuen EU-Mitgliedstaaten beträgt 229.000, was durchaus im Einklang mit den vor der EU-Erweiterung getroffenen Prognosen ist (Prettner und Stiglbauer, 2007).
| 19942 | 2004 | Veränderung 1994–2004 | 2010 | Veränderung 2004–2010 | 2019 | Veränderung 2010–2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in 1.000 | in % der Gesamtbeschäftigung | in 1.000 | in % der Gesamtbeschäftigung | in 1.000 | in 1.000 | in % der Gesamtbeschäftigung | in 1.000 | in 1.000 | in % der Gesamtbeschäftigung | in 1.000 | |
| Beschäftigung von ausländischen Personen gesamt | 291,0 | 9,5 | 362,3 | 11,3 | 71,3 | 451,3 | 13,4 | 89,0 | 799,5 | 21,1 | 348,2 |
| Alte EU-Mitgliedstaaten und ausgewählte Einzelstaaten (EU-15) | |||||||||||
| EU-15 ohne Österreich | 18,2 | 0,6 | 53,3 | 1,7 | 35,1 | 101,2 | 3,0 | 47,9 | 149,2 | 3,9 | 47,9 |
| Deutschland | 12,1 | 0,4 | 39,0 | 1,2 | 26,9 | 80,1 | 2,4 | 41,1 | 105,5 | 2,8 | 25,4 |
| Frankreich | - | - | 1,6 | 0,1 | - | 2,2 | 0,1 | 0,6 | 3,5 | 0,1 | 1,3 |
| Italien | 2,3 | 0,1 | 4,8 | 0,2 | 2,6 | 7,6 | 0,2 | 2,8 | 17,5 | 0,5 | 9,9 |
| Spanien | - | - | 0,7 | 0,0 | - | 1,2 | 0,0 | 0,4 | 3,7 | 0,1 | 2,5 |
| Vereinigtes Königreich | - | - | 1,8 | 0,1 | - | 2,8 | 0,1 | 0,9 | 4,3 | 0,1 | 1,5 |
| Neue EU-Mitgliedstaaten | |||||||||||
| Bulgarien | - | - | 1,9 | 0,1 | - | 3,2 | 0,1 | 1,3 | 14,0 | 0,4 | 10,8 |
| Estland | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 |
| Kroatien | - | - | 12,1 | 0,4 | - | 16,1 | 0,0 | 4,0 | 34,6 | 0,9 | 18,5 |
| Lettland | - | - | 0,1 | 0,0 | - | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,5 |
| Litauen | - | - | 0,1 | 0,0 | - | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,6 |
| Polen | 11,2 | 0,4 | 12,0 | 0,4 | 0,8 | 17,3 | 0,5 | 5,3 | 42,6 | 1,1 | 25,3 |
| Rumänien | 9,6 | 0,3 | 11,0 | 0,3 | 1,4 | 17,2 | 0,5 | 6,2 | 62,2 | 1,6 | 44,9 |
| Slowakei | - | - | 4,4 | 0,1 | - | 10,3 | 0,3 | 5,9 | 37,7 | 1,0 | 27,4 |
| Slowenien | - | - | 4,3 | 0,1 | - | 6,1 | 0,2 | 1,8 | 25,4 | 0,7 | 19,3 |
| Tschechien | - | - | 3,1 | 0,1 | - | 5,5 | 0,2 | 2,4 | 17,6 | 0,5 | 12,1 |
| Tschechoslowakei3 | 10,6 | 0,3 | 4,9 | 0,2 | –5,8 | 3,3 | 0,1 | –1,6 | 1,5 | 0,0 | –1,8 |
| Ungarn | 9,3 | 0,3 | 13,6 | 0,4 | 4,3 | 26,0 | 0,8 | 12,4 | 96,9 | 2,6 | 70,9 |
| Summe neue EU-Mitgliedstaaten | - | - | 67,6 | 2,1 | - | 105,5 | 3,2 | 37,9 | 334,3 | 8,8 | 228,8 |
| Nachfolgestaaten Jugoslawiens (ohne EU-Mitgliedstaaten) | |||||||||||
| Jugoslawien3 | 142,0 | 4,6 | 113,4 | 3,5 | –28,5 | 86,8 | 2,6 | –26,6 | 52,5 | 1,4 | –34,3 |
| Bosnien-Herzegowina | - | - | 27,5 | 0,9 | - | 32,3 | 1,0 | 4,8 | 49,1 | 1,3 | 16,8 |
| Nordmazedonien | - | - | 2,2 | 0,1 | - | 1,1 | 0,0 | –1,2 | 8,5 | 0,2 | 7,4 |
| Serbien und Montenegro3 | - | - | 1,0 | 0,0 | - | 13,3 | 0,4 | 12,3 | 5,7 | 0,1 | –7,6 |
| Serbien | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 28,8 | 0,8 | 28,8 |
| Montenegro | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| Kosovo | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 6,9 | 0,2 | 6,9 |
| Ausgewählte sonstige Staaten | |||||||||||
| Türkei | 53,9 | 1,8 | 54,6 | 1,7 | 0,7 | 54,3 | 1,6 | –0,3 | 59,7 | 1,6 | 5,4 |
| Schweiz | 0,9 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,5 | 2,2 | 0,1 | 0,8 | 3,0 | 0,1 | 0,9 |
| Russische Föderation | - | - | 0,9 | 0,0 | - | 3,6 | 0,1 | 2,7 | 8,8 | 0,2 | 5,2 |
| Ukraine | - | - | 0,9 | 0,0 | - | 2,0 | 0,1 | 1,1 | 4,6 | 0,1 | 2,5 |
| Syrien | - | - | 0,3 | 0,0 | - | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 10,1 | 0,3 | 9,8 |
| Afghanistan | - | - | 0,6 | 0,0 | - | 1,6 | 0,0 | 1,0 | 11,4 | 0,3 | 9,8 |
| Sonstige Staaten | - | - | 38,6 | 1,2 | - | 47,1 | 1,4 | 8,5 | 66,1 | 1,7 | 19,1 |
| Quelle: Dachverband der Sozialversicherungsträger. | |||||||||||
| 1 Unselbstständige Registerbeschäftigung; Jahresdurchschnitte. | |||||||||||
| 2 Nur für einige wenige Staaten verfügbar. | |||||||||||
| 3 Beschäftigte, die statistisch immer noch unter der Staatsbezeichnung zum Zeitpunkt ihres Beschäftigungseintritts erfasst sind. (Die Staatsbürgerschaftsinformation wird nur bei Neuanmeldungen von Beschäftigungsverhältnissen aktualisiert). | |||||||||||
Die Netto-Zuwanderung von Arbeitskräften war nach Herkunftsstaaten sehr unterschiedlich. Gravitationsmodelle (Pooth et al., 2016) prognostizieren, dass Migrationsbewegungen von der Größe der Staaten und von ihrer geografischen Distanz bestimmt sind. Diese Modelle bilden Migration in beide Richtungen ab; allerdings gibt es kaum Daten über die Beschäftigung von österreichischen Arbeitskräften in den neuen EU-Mitgliedstaaten. Diese Zahl dürfte jedoch sehr niedrig sein. 53 Der Grund hierfür liegt wohl in den nach wie vor großen Einkommensunterschieden 54 . Es liegt daher nahe, diese als Erklärungsfaktor heranzuziehen. Dass Einkommensunterschiede eine Rolle spielen, legen auch Befragungsergebnisse zu den Emigrationsabsichten nahe (Raggl, 2019) 55 .
Tabelle 2 zeigt Schätzergebnisse für die Nettoimmigration aus 11 neuen EU-Mitgliedstaaten (EU-8, EU-2 und Kroatien). In den beiden ersten Spezifikationen ist der jeweilige gesamte Beschäftigungsanstieg die abhängige Variable. Die Bevölkerungsgröße der Beitrittsländer und die jeweiligen mittleren Entfernungen zu Österreich (siehe Anhang) üben einen signifikanten Einfluss auf die Arbeitsmigration aus und können die Varianz gut erklären: Das Bestimmtheitsmaß ist 0,81; es steigt auf 0,94, wenn man das BIP pro Kopf (relativ zu Österreich) als weitere erklärende Variable heranzieht. Die Ergebnisse werden bestätigt, wenn man die jährliche Zuwanderung aus den Beitrittsländern „poolt“ (ab Spezifikation 3). Die Zuwanderung aus den neuen Mitgliedstaaten steigt also tatsächlich mit der Größe des Landes und fällt einerseits mit der Entfernung von Österreich und andererseits, wenn das Einkommen im Quellland steigt. Aus diesem Grund sind für die Zukunft geringere Zuwächse der Beschäftigung von Arbeitnehmern aus den neuen Mitgliedstaaten zu erwarten. 56 Außerdem sind die Arbeitsmarktöffnungen und die heimische Konjunktur 57 (abgebildet durch Zeitdummies; hier nicht gezeigt) wichtige Einflussgrößen.
| Spez. 1 | Spez. 2 | Spez. 3 | Spez. 4 | Spez. 5 | Spez. 6 | Spez. 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung2 | 1,139 | 0,623 | 1,153 | 1,177 | 1,179 | 1,100 | 1,115 |
| 0,002 | 0,003 | 0,000 | (0.000) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Mittlere Distanz3 | –1,876 | –3,430 | –1,754 | –1,774 | –1,746 | –1,933 | –1,889 |
| 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.000 | 0,000 | |
| BIP/Kopf relativ zu AT (KKP)4 | - | –4,326 | - | - | - | –0,847 | –0,749 |
| 0,002 | 0,002 | 0,003 | |||||
| Arbeitsmarktöffnung5 | - | - | - | 1,174 | - | 1,236 | - |
| 0,000 | - | 0,000 | |||||
| Zeit-Dummies | - | - | - | - | ja | - | ja |
| Konstante | 12,443 | 43,008 | 8,532 | 7,874 | 7,246 | 9,425 | 8,627 |
| 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Bestimmtheitsmaß (bereinigt) | 0,808 | 0,942 | 0,624 | 0,697 | 0,769 | 0,706 | 0,777 |
| Mittelwert der abh. Variable | 9,127 | 9,127 | 6,074 | 6,074 | 6,074 | 6,093 | 6,093 |
| Beobachtungen | 11 | 11 | 165 | 165 | 165 | 164 | 164 |
| Quelle: Eigene Berechnungen (OLS–Regressionen mit robusten Standardfehlern). | |||||||
| 1 Abhängige Variable: Netto-Arbeitsimmigration (unselbstständig Beschäftigte) in 1.000 aus BG, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, PL, RO, SI, SK gesamt 2004–2019 (Spezifikationen 1 und 2) bzw. jährlich (Spezifikationen 3 bis 7), logarithmiert. | |||||||
| 2 Bevölkerung der Herkunftsstaaten im Alter zwischen 20 und 54 Jahren, jährlich in (t–1) (log.). | |||||||
| 3 Mittlere Distanz zu Österreich in km (log.). | |||||||
| 4 Relatives nominelles BIP / Kopf in Kaufkraftparitäten (log. level) 2004 (Spezifikation 2) bzw. jährliche Veränderung des log. levels (t–1) (Spezifikationen 6 und 7). | |||||||
| 5 Dummyvariable mit Wert 1 ab 2011 für die Beitrittsländer von 2004 bzw. ab 2014 für BU und RO. | |||||||
| Anmerkung: Die fettgedruckten Werte in den blaugrau schattierten Feldern stellen Koeffizienten (und andere Statistiken) dar. Die Werte in den nicht-schattierten Feldern sind p-Werte. Die Berechnung der Distanzvariable wird im Anhang erläutert. | |||||||
2 Beschäftigung von EU-Staatsangehörigen in Österreich: ein Überblick
2.1 In welchen Regionen, Sektoren und Berufen sind ausländische Arbeitskräfte tätig?
Arbeitskräfte aus den alten EU-Mitgliedstaaten finden sich in Wien sowie in den an Deutschland und an Italien grenzenden westlichen Bundesländern Tirol, Oberösterreich und Salzburg. Die Arbeitskräfte aus den neuen EU-Mitgliedstaaten finden sich hingegen gehäuft im Osten Österreichs. Zwar dominiert auch hier Wien, aber viele Personen aus diesen Staaten sind auch in Niederösterreich, der Steiermark und in Oberösterreich beschäftigt. Ihr Anteil an der Beschäftigung im jeweiligen Bundesland ist im Burgenland besonders groß (knapp 18% 58 ).
Staatsangehörige aus den alten EU-Mitgliedstaaten arbeiten vor allem in der Sachgüterindustrie, im Handel, im Beherbergungs- und Gastgewerbe und sowie in den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen. Die Arbeitskräfte aus den neuen EU-Mitgliedstaaten sind viel stärker sektoral konzentriert: 86% dieser Arbeitskräfte arbeiten in nur vier Branchen: im Beherbergungs- und Gastgewerbe, gefolgt von den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (vor allem Arbeitskräfteüberlassung), dem Bauwesen und dem Handel.
Bei den Beschäftigten aus den alten EU-Mitgliedstaaten handelt es sich vornehmlich um Angestellte (71%), während die Arbeitskräfte aus den neuen EU-Mitgliedstaaten vorwiegend Arbeiterinnen und Arbeiter sind (56%). Arbeitskräfte aus den alten EU-Mitgliedstaaten sind vor allem in akademischen Berufen sowie in technischen und gleichrangigen nicht-technischen Berufen vertreten, während die Beschäftigten aus den neuen EU-Mitgliedstaaten überwiegend als Hilfsarbeitskräfte, in Dienstleistungsberufen sowie in Handwerksberufen beschäftigt sind.
2.2 Alter, Ausbildung und Geschlechterzugehörigkeit der Beschäftigten aus den anderen EU-Mitgliedstaaten
Die Beschäftigten aus den anderen EU-Mitgliedstaaten sind vorwiegend männlich: Bei den alten EU-Mitgliedstaaten beträgt der Männeranteil etwa 58%, bei den neuen EU-Mitgliedstaaten liegt er bei 61%. Arbeitskräfte aus der EU verjüngen das Arbeitsangebot in Österreich: Der Beschäftigtenanteil im Haupterwerbsalter (25 Jahre bis 50 Jahre) ist für EU-Staatsangehörige höher (alte EU-Mitgliedstaaten: 69%; neue EU-Mitgliedstaaten: 74%) als bei Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft (58%). Arbeitskräfte aus den neuen EU-Mitgliedstaaten weisen im Gegensatz zu Inländern instabilere Beschäftigungsverhältnisse auf (Schmieder und Weber, 2018). 59
Beschäftigte aus den anderen EU-Mitgliedstaaten sind im Durchschnitt höher qualifiziert als Österreicher: Arbeitskräfte aus den alten EU-Mitgliedstaaten weisen laut Arbeitskräfteerhebung zu 45% einen Hochschulabschluss auf (Inländer: 18%). Der Anteil jener mit dem Abschluss einer höheren Schule liegt hingegen etwa auf dem gleichen Niveau wie bei den Österreichern (17% bzw. 19%). Bei den Beschäftigten aus den neuen EU-Mitgliedstaaten ist der Hochschulanteil demjenigen der Österreicher ähnlich (19%), während der Anteil mit dem Abschluss einer höheren Schule (27%) höher ist als bei Inländern.
Die im Vergleich zu österreichischen Arbeitskräften überdurchschnittliche Bildung der beschäftigten Personen aus den neuen EU-Mitgliedstaaten steht im Widerspruch zu ihrer vergleichsweise geringen beruflichen Stellung. Hofer et al. (2019) stellen fest, dass sich die berufliche Positionierung der Beschäftigten aus den neuen EU-Mitgliedstaaten seit der Arbeitsmarktöffnung verschlechtert hat (vgl. auch Schmieder und Weber, 2018) und dass diese – trotz der hohen Schulbildung – eher in Konkurrenz zu relativ gering qualifizierten Arbeitskräften im Inland stehen. Dies steht in Einklang mit Befragungsergebnissen (Statistik Austria, 2015), wonach sich knapp 31% der Beschäftigten aus den neuen EU-Mitgliedstaaten für ihren Job als überqualifiziert fühlten. Allerdings sind häufig mangelnde Sprachkenntnisse ein Hindernis für einen besseren Arbeitsplatz.
3 Auswirkungen auf den österreichischen Arbeitsmarkt
3.1 Theoretische Auswirkungen und allgemeine empirische Ergebnisse
Die Frage nach den Auswirkungen von Einwanderung auf den Arbeitsmarkt lässt sich nicht einfach beantworten. Wie sind die bereits vor einem Anstieg der Einwanderung im Land beschäftigten (inländischen) Arbeitskräfte davon betroffen? Theoretische Überlegungen legen nahe, dass es unter anderem auf den untersuchten Zeitraum und auf den Skill-Mix der einwandernden Arbeitskräfte ankommt. Kurzfristig zeigen sich eher negative Auswirkungen auf Beschäftigungschancen und Gehälter der inländischen Arbeitskräfte 60 als in der längerfristigen Betrachtung. Inländische Arbeitskräfte, die mit den zugewanderten Arbeitskräften konkurrieren, müssen eher mit negativen Konsequenzen rechnen als solche, deren Qualifikationen komplementär zu jenen der Immigranten sind (Edo, 2019). Empirische Ergebnisse – typischerweise wird die Erhöhung der Präsenz von zugewanderten Arbeitskräften auf Löhne bzw. Gehälter oder Beschäftigung untersucht – sind teilweise widersprüchlich sowie häufig nicht vergleichbar (Dustmann et al., 2016).
Überraschenderweise gibt es kaum Literatur zu den Auswirkungen des hohen Anstiegs der Einwanderung in einigen alten EU-Mitgliedstaaten infolge der EU-Erweiterungen, obwohl die „Ostöffnung“ des Arbeitsmarktes, z. B. in Österreich und Deutschland, häufig medial thematisiert wurde. Für das Vereinigte Königreich hingegen gibt es einige empirischen Studien, weil es dort zu hoher Immigration aus Polen und Rumänien kam. Es konnten jedoch keine negativen Effekte auf die Beschäftigung oder die Löhne bzw. Gehälter von inländischen Arbeitskräften insgesamt gefunden werden; lediglich für britische Arbeitskräfte mit geringer Qualifikation wurden leicht negative Auswirkungen identifiziert (Stiglbauer, 2019).
3.2 Zuwanderung und Arbeitslosigkeitsrisiko
Frühere empirische Arbeiten (Winter-Ebmer und Zweimüller, 1996 und 1999) haben den beträchtlichen Anstieg des ausländischen Arbeitskräfteangebots ab Ende der 1980er-Jahre untersucht und festgestellt, dass der österreichische Arbeitsmarkt diesen erstaunlich gut bewältigt hat. Fenz et al. (2019) können keine signifikanten Auswirkungen des hohen Anteils ausländischer Arbeitskräfte auf das aggregierte Lohnwachstum identifizieren. Hofer et al. (2017) stellen beträchtliche Lohndiskriminierung bei ausländischen Arbeitskräften fest, welche bei Personen aus EU-Mitgliedstaaten 61 niedriger ist als bei Arbeitskräften aus anderen Ländern.
Da keine geeigneten Lohndaten vorliegen, konzentrieren sich die folgenden Ausführungen auf eine mögliche Erhöhung des Arbeitslosigkeitsrisikos durch die Zuwanderung seit 2010. Die Arbeitslosigkeit von Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft ist insgesamt zurückgegangen: Die Registerquote fiel von 6,5% (2010) auf 6,4% (2019); laut Arbeitskräfteerhebung (AKE) betragen die entsprechenden Werte 4,3% und 3,8%. Die Entwicklung ist regional unterschiedlich (Grafik 3). In allen Bundesländern hat Zuwanderung das Arbeitsangebot erhöht, aber lediglich in Wien ist die Arbeitslosigkeit gestiegen (bei Inländern jedoch weniger), während sie in den meisten anderen Bundesländern gesunken ist. Es fällt auf, dass die Entwicklung der Arbeitslosenquoten in den östlichen Bundesländern (Wien, Niederösterreich und dem Burgenland) ungünstiger verlaufen ist als im Süden und im Westen Österreichs. Laut Schiman (2019) stellte die Einwanderung nach Ostösterreich einen Angebotsschock dar, während sie im Westen die Reaktion auf eine gestiegene Nachfrage nach Arbeitskräften war. Im Falle von Wien gilt es allerdings zu beachten, dass der Anteil von Geflüchteten besonders hoch ist. 62 Weiters zeigt sich, dass die Arbeitslosigkeit bei Arbeitskräften, die lediglich einen Pflichtschulabschluss haben, deutlich gestiegen ist.
Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse einer Probit-Regression für die Wahrscheinlichkeit, ob eine Person arbeitslos werden könnte. Hierfür werden AKE-Mikrodaten für die Jahre von 2004 bis 2016 verwendet. Die abhängige Variable ist ein Dummy, der den Wert 1 annimmt, wenn eine Person in einem Quartal unselbstständig beschäftigt war, im Folgequartal aber arbeitslos ist. Der Mittelwert der abhängigen Variable beträgt etwa 1,1%. Die Präsenz von Arbeitskräften aus den neuen EU-Mitgliedstaaten wird durch deren Anteil in Zellen (9 Bundesländer * 10 Berufshauptgruppen; im Folgenden kurz „Immigrantenanteil“) abgebildet.
Die ersten vier Spalten in Tabelle 3 sind die Ergebnisse von Probitregressionen. Wegen der möglichen Endogenität des Immigrantenanteils zeigen die verbleibenden Spalten die Ergebnisse von Instrumentvariablen (IV)-Schätzungen. Alle Schätzungen wurden sowohl für den gesamten Zeitraum als auch für die Periode ab 2011 durchgeführt. Außerdem wurde einerseits eine „sparsame“ Spezifikation gewählt, die nur das Alter, die Dauer der Betriebszugehörigkeit, den Bildungsabschluss und eine Gender-Dummy-Variable verwendet. In all diesen Spezifikationen ist der Koeffizient des „Immigrantenanteils“ durchwegs signifikant. Andererseits wurde für beide Schätzperioden eine erweiterte Spezifikation verwendet, die auch Staatsbürgerschaftskategorien sowie Sektoren beinhaltet. Die Koeffizientenschätzer für den Immigrantenanteil werden kleiner, bleiben aber statistisch signifikant.
| Probit | IV-Probit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004–2016 | 2004–2016 | 2011–2016 | 2011–2016 | 2004–2016 | 2004–2016 | 2011–2016 | 2011–2016 | |
| Immigrantenanteil3 | 0,027 | 0,022 | 0,025 | 0,020 | 0,029 | 0,024 | 0,027 | 0,022 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Alter | 0,009 | 0,006 | 0,008 | 0,005 | 0,009 | 0,006 | 0,008 | 0,005 |
| 0,001 | 0,017 | 0,068 | 0,262 | 0,001 | 0,017 | 0,074 | 0,269 | |
| Alter quadriert / 100 | –0,011 | –0,007 | –0,009 | –0,005 | –0,011 | –0,007 | –0,009 | –0,005 |
| 0,002 | 0,037 | 0,112 | 0,374 | 0,002 | 0,038 | 0,118 | 0,379 | |
| Dauer Betriebszugehörigkeit | –0,009 | –0,009 | –0,010 | –0,010 | –0,009 | –0,009 | –0,010 | –0,010 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Dauer Betriebszugehörigkeit quadriert / 100 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Gender (weiblich = 1) | –0,027 | –0,028 | –0,031 | –0,044 | –0,028 | –0,028 | –0,031 | –0,044 |
| 0,004 | 0,005 | 0,048 | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,049 | 0,010 | |
| Höchster Bildungsabschluss (Basiskategorie: Lehrabschluss) | ||||||||
| Pflichtschule | 0,085 | 0,051 | 0,048 | 0,018 | 0,085 | 0,052 | 0,046 | 0,017 |
| 0,000 | 0,000 | 0,031 | 0,427 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,455 | |
| Berufsbildende mittlere Schule | –0,093 | –0,078 | –0,097 | –0,089 | –0,092 | –0,077 | –0,096 | –0,089 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | |
| AHS / BHS | –0,114 | –0,103 | –0,107 | –0,107 | –0,111 | –0,101 | –0,106 | –0,107 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Universität / Fachhochschule | –0,201 | –0,156 | –0,202 | –0,175 | –0,201 | –0,157 | –0,201 | –0,174 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Staatsbürgerschaft (Basiskategorie: Österreich) | ||||||||
| Alte EU–Mitgliedstaaten (ohne AT) | - | –0,010 | - | –0,023 | - | –0,008 | - | –0,023 |
| 0,699 | 0,570 | 0,770 | 0,571 | |||||
| Nachfolgestaaten Jugoslawiens (ohne EU-MS) | - | 0,137 | - | 0,111 | - | 0,135 | - | 0,108 |
| 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,003 | |||||
| Türkei | - | 0,239 | - | 0,178 | - | 0,240 | - | 0,176 |
| 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | |||||
| Andere Staatsbürgerschaft | - | 0,176 | - | 0,228 | - | 0,177 | - | 0,225 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Sektor (Basiskategorie: Industrie) | ||||||||
| Landwirtschaft | - | 0,065 | - | 0,083 | - | 0,063 | - | 0,083 |
| 0,142 | 0,311 | 0,165 | 0,315 | |||||
| Energie- und Wasserversorgung | - | –0,234 | - | –0,227 | - | –0,231 | - | –0,228 |
| 0,000 | 0,012 | 0,000 | 0,012 | |||||
| Bauwesen | - | 0,059 | - | 0,029 | - | 0,060 | - | 0,028 |
| 0,001 | 0,346 | 0,000 | 0,358 | |||||
| Handel | - | 0,048 | - | 0,080 | - | 0,045 | - | 0,080 |
| 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | |||||
| Gastgewerbe | - | 0,263 | - | 0,289 | - | 0,258 | - | 0,288 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Andere private Dienstleistungen | - | 0,034 | - | 0,069 | - | 0,031 | - | 0,069 |
| 0,025 | 0,008 | 0,039 | 0,008 | |||||
| Öffentliche Dienstleistungen | - | –0,064 | - | –0,031 | - | –0,067 | - | –0,032 |
| 0,000 | 0,247 | 0,000 | 0,240 | |||||
| Zeitdummies (Jahre und Quartale) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Konstante | –2,054 | –2,054 | –2,079 | –2,074 | –2,067 | –2,063 | –2,085 | –2,078 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Marginaleffekt “Immigrantenanteil” (in %)4 | 0,049 | 0,039 | 0,039 | 0,030 | 0,025 | 0,022 | 0,022 | 0,019 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Mittelwert der abhängigen Variable (in %) | 1,198 | 1,198 | 1,101 | 1,101 | 1,198 | 1,198 | 1,101 | 1,101 |
| Pseudo-Bestimmtheitsmaß | 0,098 | 0,104 | 0,108 | 0,114 | – | – | – | – |
| Beobachtungen | 715.355 | 715.355 | 259.371 | 259.371 | 703286 | 703.286 | 259.371 | 259.371 |
| Log Likelihood | –41.900 | –41.613 | –14.024 | –13.925 | –992627 | –992.035 | –400.586 | –400.288 |
| Quelle: Schätzungen des Autors mit AKE–Mikrodaten (Q1 04–Q4 16). | ||||||||
| 1 Fettgedruckte, blau-unterlegte Werte sind Probit-Koeffizienten. Die nicht-farblich unterlegten Werte darunter sind p-Werte (basierend auf robusten Standardfehlern). | ||||||||
| 2 Als Instrumente für den Anteil der Arbeitskräfte aus den neuen Mitgliedstaaten dienten deren um ein Quartal verzögerte Werte, der Anteil der weiblichen Arbeitnehmerinnen in den Zellen und der Anteil der Arbeitskräfte, deren Tätigkeit überwiegend manuell ist. | ||||||||
| 3 Anteil der Arbeitskräfte aus den neuen EU-Mitgliedstaaten in Zellen, gebildet aus den neun Bundesländern, verkreuzt mit den zehn ISCO-Hauptgruppen. | ||||||||
| 4 Errechnet an den Mittelwerten der anderen erklärenden Variablen. | ||||||||
Weil sich die Probitkoeffizienten einer einfachen Interpretation entziehen, werden im unteren Teil der Tabelle die errechneten Marginaleffekte des Immigrantenanteils gezeigt. Die Veränderung der Wahrscheinlichkeit eines Eintritts in die Arbeitslosigkeit, wenn der „Immigrantenanteil“ um einen Prozentpunkt steigt, beträgt bei den IV-Schätzungen etwa 0,02 Prozentpunkte. Da die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit eines Eintritts in die Arbeitslosigkeit etwa 1,1% beträgt, bedeutet dies eine Erhöhung des Arbeitslosigkeitsrisikos um etwa 2% – ein geringer Wert also. Diese Ergebnisse sind robust, wenn man ein alternatives Schätzmodell verwendet 63 . Bei einer alternativen Definition der abhängigen Variable sind die Marginaleffekte ebenfalls ähnlich, jedoch bei den IV-Schätzungen für den kürzeren Zeitraum nur teilweise signifikant 64 .
Es wurden außerdem für viele Subgruppen (nach Berufsgruppen, Bundesländern, Altersgruppen, Bildungsabschluss und Staatsbürgerschaft) statistische Tests durchgeführt, ob die Probit-Parameter des „Immigrantenanteils“ signifikant größer sind als im Durchschnitt. Diese wurden in fast allen Fällen verworfen. Lediglich für Arbeiter, für Beschäftigte mit überwiegend manuellen Tätigkeiten sowie vor allem für Dienstleistungs- und Verkaufsberufe gab es einen signifikant höheren Einfluss auf das Arbeitslosigkeitsrisiko.
4 Zusammenfassung und Ausblick
Seit dem EU-Beitritt Österreichs ist die Beschäftigung aus den alten sowie vor allem aus den neuen EU-Mitgliedstaaten stark angestiegen. Arbeitskräfte aus der Europäischen Union haben die demografisch bedingte Verlangsamung des Wachstums der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter abgemildert und einen beträchtlichen Beitrag zur Beschäftigung und zum Wirtschaftswachstum in Österreich geleistet. Die Zuwanderung nach Österreich lässt sich mit der Größe der Herkunftsländer, der mittleren Entfernung und dem Durchschnittseinkommen gut erklären.
Zuwandernde Arbeitskräfte aus der EU sind überdurchschnittlich häufig männlich und relativ jung. Arbeitskräfte aus den alten EU-Mitgliedstaaten finden sich gehäuft im Westen sowie in Wien. Personen aus den neuen EU-Mitgliedstaaten sind hingegen zu einem beträchtlichen Teil in Ostösterreich beschäftigt. Die Arbeitskräfte aus den neuen EU-Mitgliedstaaten finden sich vor allem im Gastgewerbe, in der Arbeitskräfteüberlassung, im Bauwesen und im Handel. Sowohl die Arbeitskräfte aus den alten als auch aus den neuen EU-Mitgliedstaaten haben im Durchschnitt einen höheren Bildungsabschluss als Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft. Während aber Arbeitskräfte aus den alten EU-Mitgliedstaaten vornehmlich in akademischen und technischen Berufen arbeiten, sind jene aus den neuen EU-Mitgliedstaaten vor allem als Hilfsarbeitskräfte sowie in Dienstleistungs- und Handwerksberufen tätig.
Die Ergebnisse von Probit-Schätzungen legen nahe, dass sich durch die Immigration aus den neuen EU-Mitgliedstaaten das Arbeitslosigkeitsrisiko für die inländischen Arbeitskräfte nur geringfügig erhöht hat. Für einige Gruppen (Arbeiter, manuell Arbeitende und insbesondere Beschäftigte in den Dienstleistungs- und Verkaufsberufen) ist dieser Effekt aber größer als im Durchschnitt.
Arbeitskräfte aus der EU werden weiterhin zum Wachstum des österreichischen Arbeitskräftepotenzials beitragen. Allerdings werden durch steigende Einkommensniveaus in den neuen EU-Mitgliedstaaten die Beschäftigungszuwächse aus diesen Ländern wahrscheinlich zurückgehen. Lediglich im Falle von Kroatien dürfte die Öffnung des österreichischen Arbeitsmarkts mittelfristig zu stärkerer Zuwanderung führen.
Literaturverzeichnis
Astrov, V., M. Holzner, S. Leitner, I. Mara, L. Podkaminer und A. Rezai. 2019. Wage Developments in the Central and Eastern European EU Member States. Wiiw Research Report 443. Dezember.
Breuss, F. 2020. Makroökonomische Effekte der 25-jährigen EU-Mitgliedschaft Österreichs. In dieser Publikation.
Dustmann, C., U. Schönberg und J. Stuhler. 2016. The Impact of Immigration: Why do Studies Reach Such Different Results? In: Journal of Economic Perspectives 30(4). 31–56.
Edo, A. 2019. The Impact of Immigration on the Labor Market. In: Journal of Economic Surveys 33(3). 922–948.
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). 2018. Transition Report 2018–19.
Fenz, G., C. Ragacs und A. Stiglbauer. 2019. Aggregate wage developments in Austria since the introduction of the euro. Monetary Policy & The Economy Q1–Q2. 41–55.
Hofer, H., Hyee, R. und G. Titelbach. 2019. Der Einfluss der Arbeitsmarktöffnung auf die berufliche Positionierung der zugewanderten Arbeitskräfte. Forschungsbericht, Institut für Höhere Studien. April.
Hofer, H., G. Titelbach, R. Winter-Ebmer und A. Ahammer. 2017. Wage Discrimination Against Immigrants in Austria? In: Labour 31(2). 105–126.
Hofer, H. und K. Weyerstraß. 2016. Der Beitrag der Migration zum Wachstumspotenzial der österreichischen Wirtschaft. Wirtschaftspolitische Blätter 3.
Leitner, S. M., R. Stehrer und R. Grieveson. 2019. EU Faces a Tough Demographic Reckoning. wiiw Policy Notes and Reports 30. Juni.
Poot, J., A. Omoniyi, M. Cameron und D. C. Maré. 2016. The Gravity Model of Migration: The Successful Comeback of an Ageing Superstar in Regional Science. IZA Discussion Paper 10329.
Prettner, K. und A. Stiglbauer. 2007. Auswirkungen der vollständigen Öffnung des österreichischen Arbeitsmarkts gegenüber den EU-8-Staaten.
Raggl, A. K. 2019. Migration intentions in CESEE: sociodemographic profiles of prospective emigrants and their motives for moving. Focus on European Economic Integration Q1. 49–67.
Schiman, S. 2019. Labor Supply Shocks and the Beveridge Curve. WIFO Working Paper 568.
Schmieder, J. und A. Weber. 2018. How did EU Eastern enlargement affect migrant labor supply in Austria? Focus on European Economic Integration Q3. 113–121.
Statistik Austria. 2015. Arbeitsmarktsituation von Migrantinnen und Migranten in Österreich. Modul der Arbeitskräfteerhebung 2014.
Stiglbauer, A. 2019. Brexit and its effects on EU and UK labor markets. Schwerpunkt Außenwirtschaft.
Winter-Ebmer, R. und J. Zweimüller. 1996. Immigration and the Earnings of Young Native Workers. In: Oxford Economic Papers 48. 473–491.
Winter-Ebmer, R. und J. Zweimüller. 1999. Do Immigrants Displace Young Native Workers: The Austrian Experience. In: Journal of Population Economics 12. 327–340.
Anhang
Errechnung der „mittleren Distanz von Österreich“
Für Tabelle 2 wurden die NUTS 1-Regionen Österreichs und der neuen EU-Mitgliedstaaten verwendet. Da Tschechien und die Slowakei trotz ihrer relativen Größe lediglich eine einzige NUTS 1-Region konstituieren, wurden diese in drei bzw. zwei Subregionen unterteilt. Tabelle A1 listet die verwendeten Regionen, die für sie repräsentativen Städte und die jeweiligen Distanzen zu den österreichischen Regionen auf.
Die mittlere Distanz eines Beitrittslandes c nach Österreich dc berechnet sich wie folgt:
dc= ∑ci∑j dcij *sci *sj, wobei ci die Regionen eines Beitrittslandes und j die drei Regionen Österreichs sind. dcij bezeichnet die Distanz zwischen der repräsentativen Stadt der Region ci und der repräsentativen Stadt j einer österreichischen Region. sci sind die Bevölkerungsanteile der Regionen der Beitrittsländer und sj die Bevölkerungsanteile der österreichischen Regionen (jeweils im Alter zwischen 20 und 54 Jahren).
| Entfernung nach | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUTS 1–Region | Bezeichnung | Stadt | Wien | Graz | Salzburg |
| BG3 | Norden und Südosten | Burgas | 1.395 | 1.359 | 1.590 |
| BG4 | Südwesten und Südzentralraum | Sofia | 1.003 | 966 | 1.197 |
| CZ11 | Zentralraum (CZ01 + CZ02) | Prag | 336 | 525 | 379 |
| CZ21 | Süden (CZ03 + CZ06 + CZ07 | Brno | 136 | 325 | 432 |
| CZ31 | Norden (CZ04 + CZ05 + CZ08) | Liberec | 435 | 624 | 479 |
| EE0 | Estland | Tallinn | 1.718 | 1.908 | 2.015 |
| HR3 | Adriatisches Kroatien | Split | 762 | 741 | 741 |
| HR4 | Kontinentales Kroatien | Zagreb | 371 | 185 | 416 |
| HU1 | Mittelungarn | Budapest | 243 | 346 | 547 |
| HU2 | Transdanubien | Györ | 122 | 224 | 425 |
| HU3 | Norden und Tiefebene | Debrecen | 474 | 577 | 777 |
| LT0 | Litauen | Vilnius | 1.174 | 1.363 | 1.471 |
| LV0 | Lettland | Riga | 1.408 | 1.597 | 1.704 |
| PL1 | Region Centralny | Warszawa | 708 | 898 | 1.005 |
| PL2 | Makroregion Poludniowy | Krakow | 463 | 653 | 760 |
| PL3 | Region Wschodni | Lublin | 790 | 979 | 1.086 |
| PL4 | Makroregion Pólnocno–Zachodni | Posen | 719 | 908 | 964 |
| PL5 | Poludniowo–Zachodni | Wrozlaw | 535 | 724 | 694 |
| PL6 | Makroregion Pólnocny | Gdansk | 913 | 1.102 | 1.209 |
| RO1 | Macroregiunea unu | Cluj–Napoca | 692 | 794 | 995 |
| RO2 | Macroregiunea doi | Constanta | 1.315 | 1.418 | 1.618 |
| RO3 | Macroregiunea trei | Bukarest | 1.094 | 1.196 | 1.397 |
| RO4 | Macroregiunea patru | Timisoara | 853 | 653 | 853 |
| SI0 | Slowenien | Ljubiljana | 379 | 194 | 276 |
| SK11 | Westen (SK01 + SK02) | Bratislawa | 79 | 265 | 382 |
| SK21 | Osten (SK03 + SK04) | Kosice | 503 | 605 | 806 |
| AT1 | Ostösterreich | Wien | - | - | - |
| AT2 | Südösterreich | Graz | - | - | - |
| AT3 | Westösterreich | Salzburg | - | - | - |
| Quelle: Eurostat, https://luftlinie.org (Fahrtstrecken). | |||||
| 1 Untergliederung der jeweils einzigen NUTS 1–Region in Subregionen, basierend auf NUTS 2–Regionen (siehe Spalte Bezeichnung). | |||||
44 Oesterreichische Nationalbank, Abteilung für volkswirtschaftliche Analysen, alfred.stiglbauer@oenb.at. Die in diesem Artikel vertretenen Ansichten spiegeln nicht notwendigerweise die offizielle Haltung der OeNB oder des Eurosystems wider. Der Autor dankt Ernest Gnan, Walpurga Köhler-Töglhofer, Doris Ritzberger-Grünwald und dem Gutachter für wertvolle Anregungen und Kommentare.
45 In diesem Artikel wird generell die Staatsbürgerschaft als Indikator für Arbeitsmigration verwendet. Bei längerfristigen Betrachtungen ist dieses Maß durch die Möglichkeit von Einbürgerungen verzerrt. Allerdings sind die nach einzelnen Herkunftsländern detaillierten Beschäftigungsdaten nur für die Staatsbürgerschaft (und nicht nach einem anderen Kriterium für Migrationshintergrund) verfügbar. Außerdem werden in den empirischen Teilen dieses Artikels (Tabellen 2 und 3) Vorgänge untersucht, in denen es zu einem raschen Anwachsen der Beschäftigung von Arbeitnehmern mit ausländischer Staatsbürgerschaft gekommen ist.
46 Schätzung, basierend auf den Werten für die ersten drei Quartale des Jahres.
47 Laut Bevölkerungszählungen und Registerdaten der Statistik Austria betrug das Wachstum der Wohnsitzbevölkerung im Alter zwischen 15 und 64 Jahren zwischen 1971 und 1991 im Durchschnitt 0,68% sowie zwischen 1991 und 2019 (inklusive Zuwanderung) 0,47%.
48 Bemerkenswert ist, dass die stärkste Einwanderung vor allem aus den neuen Mitgliedstaaten der EU kommt (siehe unten), also aus Ländern deren demografische Prognosen im europäischen Vergleich besonders ungünstig sind (siehe ebenfalls Leitner et al., 2019).
49 Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.
50 Angesichts der gegenwärtigen Arbeitsmarktlage und der Einschränkungen der Freizügigkeit für Arbeitskräfte auf Grund der COVID-19-Pandemie ist unsicher, ob es unmittelbar nach der Arbeitsmarktöffnung für Kroatien zu einem Anstieg der Arbeitsimmigration kommen wird.
51 Für die Zeit vor 2004 weisen die publizierten Registerdaten die Beschäftigung nur für wenige Herkunftsstaaten separat aus.
52 Die Zuwanderung aus Deutschland ist auch auf die hohe Arbeitslosigkeit (insbesondere im Osten des Landes) Anfang der 2000er-Jahre zurückzuführen.
53 So waren etwa im Jahr 2017 etwa 1.300 Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft in Tschechien, Polen, Slowenien und der Slowakei beschäftigt.
54 Für eine Analyse der Reallohnentwicklung in den neuen Mitgliedstaaten siehe Astrov et al. (2019).
55 Der Anteil der Menschen mit Auswanderungsabsichten im Euro Survey 2017 ist etwa in Tschechien und Polen viel geringer als in Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Serbien, Albanien und Nordmazedonien.
56 Dazu kommt, dass die in Summe beträchtliche Auswanderung aus den CESEE-Ländern zu wirtschaftlichen und demografischen Problemen führt. Die betreffenden Regierungen treffen Maßnahmen, um die Arbeitskräfte im Land zu halten und den „brain drain“ zu stoppen (vgl. EBRD, 2018).
57 Auch die ausländische Konjunktur, insbesondere die lange Zeit sehr hoher Arbeitslosigkeit in vielen der neuen EU-Mitgliedstaaten, dürfte zur Zuwanderung von Arbeitskräften beigetragen haben. Dies bestätigen auch Regressionsspezifikationen mit den jeweiligen ausländischen Arbeitslosenquoten (diese werden hier nicht gezeigt).
58 Alle im Folgenden genannten Prozentzahlen beziehen sich auf das Jahr 2019 (Registerdaten).
59 Die Register-Arbeitslosenquote für Beschäftigte aus den neuen EU-Mitgliedstaaten betrug 2019 7,7%. Zum Vergleich: Für die alten EU-Mitgliedstaaten betrug sie 5,9%, für Inländer 6,4% und für Beschäftigte aus Drittstaaten 15,8%.
60 Die „inländischen“ Arbeitskräfte umfassen in diesem Zusammenhang all jene Arbeitskräfte, die sich bereits vor einer Erhöhung der Zuwanderung im Land befinden, d.h. heimische Arbeitnehmer und solche, die bereits früher zugewandert sind.
61 Die Autoren treffen keine Unterscheidung zwischen alten und neuen EU-Mitgliedstaaten.
62 So entfallen etwa 45% des Arbeitsangebots aus den bereits erwähnten vier größten Asylherkunftsländern auf Wien allein.
63 Schätztechnisch wird im Fall von wenigen Realisierungen der abhängigen Variable das komplementäre Log-Log-Modell als Alternative zu Probit empfohlen. In den Schätzungen damit waren die Marginaleffekte ähnlich den hier gezeigten Ergebnissen (tendenziell aber etwas niedriger).
64 Eintrittsrisiko in die Arbeitslosigkeit nicht nur im nächsten Quartal, sondern in einem der 4 Folgequartale.
Freizügigkeit des Dienstleistungsexports im EU-Binnenmarkt und Effekte auf die österreichische Wirtschaft
Erwin Kolleritsch, Patricia Walter 65
Wissenschaftliche Begutachtung: Elisabeth Christen, Martin Falk, Wifo
Wir gehen der Frage nach, welche Effekte vom Beitritt Österreichs zur EU bzw. von deren Vertiefungsschritten auf die Entwicklung der Dienstleistungsexporte Österreichs ausgegangen sind. Wir finden eine hohe Persistenz der Exportbeziehungen Österreichs mit der EU, aber nur eine (relativ) beschränkte Wachstumsdynamik. Es gab relative Umschichtungen hin zu den Mitgliedsländern des Euroraums und zu den (nicht an Österreich angrenzenden) EU-Beitrittsländern. Neben impliziten Handelsbeschränkungen und einem unvollständigen Binnenmarkt prägen der frühe Aufbau von Wirtschaftsbeziehungen mit Osteuropa und die Nutzung des Niederlassungsverkehrs die Entwicklung. Wenngleich der Dienstleistungsverkehr für Österreich relativ bedeutender ist als für vergleichbare EU-Mitgliedstaaten, sind die komparativen Handelsvorteile gering. Wir finden einerseits eine relativ höhere Bedeutung des EU-Binnenmarkts für kleinbetriebliche und heimisch dominierte Unternehmen; andererseits eine relativ höhere Bedeutung von wissensbasierten und von der Sachgüterindustrie getragenen Dienstleistungsexporten in Länder außerhalb der EU. Langfristig ist der Anteil der Dienstleistungsexporte in die EU an der gesamten Wertschöpfung Österreichs gestiegen. Die abgeleiteten Endnachfragemultiplikatoren liegen jedoch unter jenen der Extra-EU-Staaten.
JEL classification: L80, F15, D57
Keywords: Services trade, Single Market, Input-Output Analysis
Der freie Dienstleistungsverkehr und die Niederlassungsfreiheit bilden neben dem freien Warenverkehr, dem freien Kapitalverkehr und der Freizügigkeit der Arbeitnehmer die Eckpfeiler des Europäischen Binnenmarkts. Dienstleistungsfreiheit und Niederlassungsfreiheit ermöglichen die Mobilität von Unternehmen und Arbeitnehmern innerhalb der EU. In der vorliegenden Untersuchung beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Effekte der freie Dienstleistungsverkehr in den vergangenen 25 Jahren auf die Entwicklung der österreichischen Dienstleistungsexporte hatte. Des Weiteren gehen wir der Frage nach, wie sich diese Entwicklung auf die Wertschöpfung der österreichischen Volkswirtschaft ausgewirkt hat. Der Fokus des Beitrags liegt auf der Entwicklung des Exports von unternehmensnahen Dienstleistungen. Der Reiseverkehr, Bestandteil insbesondere des privaten Konsums, wird nur zur Vergleichszwecken herangezogen. In Kapitel 1 des Artikels untersuchen wir die Entwicklung des Dienstleistungsexports nach regionalen und sektoralen Aspekten und ziehen unternehmensspezifische Eigenschaften, wie Wirtschaftsbranche, Größe bzw. Beschäftigtenzahl oder Spezialisierung (reine Dienstleistungsunternehmen versus Unternehmen, die sowohl Güter- als auch Dienstleistungen anbieten) in die Analyse mit ein. In Kapitel 2 versuchen wir mithilfe der Input-Output-Analyse die Gesamteffekte des grenzüberschreitenden, unternehmensnahen Dienstleistungsverkehrs auf die österreichische Wertschöpfung abzuleiten. Bei der Analyse der letzten rund 25 Jahre mussten wir Zeitreihenbrüche berücksichtigen, die aus Änderungen von Methodologie und Klassifikationen resultieren. Alle Vergleiche zur EU und zu Extra-EU-Staaten beziehen sich auf die bislang 28 Mitgliedstaaten.
1 Entwicklung und Struktur des freien Dienstleistungsverkehrs
Gemäß Ebell (2016), die die Vorteile der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) im Vorfeld des bevorstehenden „Brexit“ untersucht hat, gehen mit der EU-Mitgliedschaft substanzielle und statistisch signifikante Zuwächse im bilateralen Dienstleistungsverkehr einher. Das Ausmaß der positiven Handelseffekte wird ganz wesentlich vom Umfang bzw. der Tiefe von Handelsabkommen bestimmt. Grundsätzlich haben im Dienstleistungsverkehr implizite Handelsbeschränkungen (es handelt es sich um „intangible goods“ 66 ) sowie tarifäre bzw. physische (im Transport) und nicht-tarifäre Beschränkungen (unterschiedliche Regularien bei den Finanz-, Rechts- und Wirtschaftsdiensten) eine wesentlich größere Bedeutung als im Güterhandel (Ebeke et al., 2019; Borchert et al., 2012) 67 . Der EU-Binnenmarkt stellt aber das weltweit umfangreichste Abkommen hinsichtlich der Freizügigkeit von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen dar. Im Jahr 2006 wurde die Dienstleistungsrichtlinie 68 verabschiedet, um die bis dato bestehenden Einschränkungen der Dienstleistungsfreiheit zu beseitigen und damit die Vollendung des Binnenmarkts zu beschleunigen, unter anderem durch administrative Vereinfachungen und zwischenstaatliche Kooperation sowie die Beseitigung ungerechtfertigter Restriktionen im grenzüberschreitenden Austausch von Dienstleistungen und der Errichtung kommerzieller Präsenz. Die Umsetzung dieser EU-Richtlinie durch die Mitgliedstaaten der EU erfolgte jedoch nur zögerlich (in Österreich ab 2012) und blieb bislang, nach Einschätzung der EU-Kommission (2017), unvollständig 69 . Zwar konnte für grenzüberschreitende Dienstleistungsanbieter in der EU die rechtliche Sicherheit erhöht werden, doch die im Vergleich zum Güterhandel geringen grenzüberschreitenden Transaktionen und Investitionen bei Wirtschaftsberatern, Rechtsanwälten, Architekten und Ingenieuren sowie im Bau werden auf weiterhin komplexe administrative und an der jeweiligen Ländersituation orientierte regulatorische Hürden zurückgeführt. Tendenziell stellt die OECD (2020) jedoch eine zunehmende Liberalisierung des Dienstleistungsverkehrs im Binnenmarkt fest, vor allem im Frachten-, Versicherungs- und Finanzsektor. Für Österreich haben Francois et al. (2008) die möglichen Effekte der Liberalisierung des Dienstleistungshandels simuliert und positive Handelseffekte innerhalb der EU sowie eine Verschiebung der Handelsbeziehungen zugunsten der EU erwartet. Darauf basierend haben Fritz und Streicher (2008) einen, wenn auch nur geringen Effekt auf die österreichische Bruttowertschöpfung berechnet. Wir finden in Retrospektive relativ stabil bleibende Handelsbeziehungen zu den Ländern der EU und eine Verringerung des Wertschöpfungsdifferenzials zwischen den Dienstleistungs- und den Sachgüterexporten.
1.1 Entwicklung des freien Dienstleistungsverkehrs
Die Einnahmen aus dem Export von unternehmensnahen Dienstleistungen in andere EU-Mitgliedstaaten betrugen im Jahr 2018, dem letzten Jahr für das Informationen für unsere Untersuchung vorlagen, laut International Trade in Services Statistics (ITSS) rund 33 Mrd EUR. Die ITSS umfasst Exporte, die im eigentlichen Sinn grenzüberschreitend erfolgen (Mode 1 laut Welthandelsorganisation, WTO), des Weiteren Exporte, die durch Vor-Ort-Erbringung (Mode 2) sowie durch Entsendung von Personen erbracht werden (Mode 4). 70 Eine Unterscheidung der Erbringungsarten gibt es bislang leider nicht. Seit dem Eintritt Österreichs in den gemeinsamen Binnenmarkt sind die unternehmensnahen Dienstleistungsexporte in nomineller Rechnung auf rund das Sechsfache gestiegen. Das bedeutet ein durchschnittliches Wachstum von rund 8% p.a. Im Verhältnis zum nominellen BIP stiegen die Erlöse zwischen 1995 und 2018 um rund 5 Prozentpunkte auf 9%. Das mag als beeindruckende Entwicklung erscheinen, der Abstand zum Güterhandel konnte jedoch nicht verringert werden, vielmehr ist er weitergewachsen: Die nominellen Güterexporte beliefen sich im Jahr 2018 auf 45% des BIP. Der Anteil der aus der EU stammenden Erlöse an den weltweiten Exporterlösen heimischer Dienstleistungsexporteure ist langfristig bei rund 75% stabil geblieben. Das bedeutet, der Dienstleistungsverkehr mit Ländern außerhalb der EU konnte nicht zum Intra-EU-Handel aufschließen. Allerdings hat es trotz EU-Mitgliedschaft, der gemeinsamen Währung im Euroraum, der Erweiterung des EU-Binnenmarkts und der (teilweisen) Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie auch keine signifikante Verschiebung zugunsten der EU-Mitgliedstaaten gegeben. Der Schwerpunkt des Dienstleistungsverkehrs lag schon vor diesen wirtschaftlichen Vertiefungsmaßnahmen bei den übrigen EU-Mitgliedstaaten. Berücksichtigen wir den globalen Handelseinbruch im Jahr 2009 in einer Trendbeobachtung, dann brachte die globale Finanz- und Wirtschaftskrise einen temporären Rückgang der Dienstleistungsexporte in die EU mit sich, der stärker ausfiel als gegenüber Ländern außerhalb der EU. Bis zum Jahr 2008 und am aktuellen Zeitrand (2016 bis 2018) verlief jedoch die Entwicklung der Erlöse aus den Exporten von unternehmensnahen Dienstleistungen in Nicht-EU-Mitgliedstaaten vergleichsweise gedämpfter.
Während sich die Exporte von unternehmensnahen Dienstleistungen seit 1995 auf die Märkte innerhalb der EU fokussierten, wurden im Tourismus verstärkt Drittstaaten als neue Herkunftsmärkte erschlossen. Die Zusammensetzung des Dienstleistungsverkehrs in der WWU hat sich damit gewandelt: Im Jahr 2018 machten die Erlöse aus unternehmensnahen Dienstleistungen rund zwei Drittel der Gesamterlöse aus, zu Beginn der EU-Mitgliedschaft war die Zusammensetzung annähernd spiegelbildlich. Damals hatte der Reiseverkehr eine ähnlich große Bedeutung wie die unternehmensnahen Dienstleistungen heute.
1.1.1 Regionale Entwicklung der Dienstleistungsexporte
Es gibt mehrere Gründe für die anhaltend starke Fokussierung auf europäische Destinationen im Handel mit unternehmensnahen Dienstleistungen und ihr (vergleichsweise) wenig dynamisches Wachstum. Dazu gehören nach wie vor bestehende Beschränkungen des grenzüberschreitenden Handels mit Dienstleistungen in der EU bzw. die nur teilweise Umsetzung des Binnenmarktes. Hinzu kommen die allgemeine Bedeutung der räumlichen, sprachlichen und kulturellen Nähe für den Dienstleistungsverkehr, sowie speziell für den österreichischen Dienstleistungshandel der frühzeitige Aufbau wirtschaftlicher Beziehungen mit den osteuropäischen, vormals kommunistischen Nachbarstaaten. Nicht erst der EU-Beitritt 1995 (Westöffnung), sondern zuvor schon das Jahr 1989 (Ostöffnung) und später die EU-Erweiterung hatten positive Effekte auf die österreichische Wirtschaft im Sinn der Globalisierung (Breuss, 2016). Die Exportbeziehungen Österreichs mit den direkten Nachbarländern (Deutschland, Schweiz, Italien, Tschechische Republik, Ungarn, Slowenien, Slowakei, Liechtenstein) sind über die Jahrzehnte gewachsen und sehr stabil. Ein Bedeutungszuwachs anderer Absatzmärkte fand nur in einem beschränkten Ausmaß statt: Der Anteil der Dienstleistungsexporte in die direkten Nachbarländer betrug im Jahr 1995 rund 62% der weltweiten Dienstleistungsexporte Österreichs, im Jahr 2018 belief sich dieser noch immer auf rund 58% (knapp 26 Mrd EUR). Daraus kann man schließen, dass trotz moderner Entwicklungen im Dienstleistungsverkehr (Stichwort Digitalisierung) nach wie vor Faktoren wie regionale Nähe und gemeinsame Sprache 71 die wichtigen Determinanten für die Dienstleistungsexporte sind. Das lässt sich auch daran ablesen, dass Deutschland und die Schweiz nach wie vor die zwei bei weitem wichtigsten Absatzmärkte für heimische Dienstleistungsexporteure geblieben sind.
Italien ist mittlerweile zur drittwichtigsten Exportdestination geworden. Wie eingangs beschrieben, ist dies kein Indiz für eine weitere Verschiebung von Exportbeziehungen in die EU; es spiegelt allerdings wider, dass es (vorsichtige) Verschiebungen innerhalb der WWU hin zu den Euroländern gegeben hat: Die nominellen Dienstleistungsexporte in die Euroraumstaaten haben sich im Jahr 2018 auch auf 26 Mrd EUR belaufen bzw. auf einen Anteil von knapp 59% an den Gesamterlösen. Damit sind die Exporte in den Euroraum inzwischen so bedeutsam wie jene in die Nachbarländer Österreichs. Ungarn und Tschechien zählten schon vor rund 25 Jahren zu den zehn wichtigsten Exportmärkten. In den letzten zweieinhalb Jahrzehnten haben sie als Exportdestinationen jedoch einen relativen Bedeutungsverlust verzeichnet, während andere Beitrittsländer an Bedeutung gewonnen haben. Innerhalb der Gruppe der Beitrittsländer haben Verschiebungen von den Nachbarländern zu anderen EU-Mitgliedstaaten stattgefunden.
1.1.2 Sektorale Entwicklung der Dienstleistungsexporte
Im Export von unternehmensnahen Dienstleistungen in andere EU-Mitgliedstaaten ist nach wie vor der Transport die führende Dienstleistungsart (2018: rund 12 Mrd EUR bzw. 36% der Gesamterlöse). Dahinter folgen bereits die technologieintensiven Dienstleistungen 72 , die in den letzten 25 Jahren einen dynamischen Zuwachs verzeichnet (durchschnittlich +11% p. a.) und ihren Anteil an den EU-Exporten annähernd verdoppelt haben (rund +10 Mrd EUR bzw. 30% der Erlöse). Beratungsleistungen oder Rechts- und Wirtschaftsdienste haben in diesem Zeitraum kaum den Rückstand zu den Hauptsegmenten aufholen können (rund +3 Mrd EUR bzw. 9% der EU-Erlöse). Seit 2012, als auch die letzten Mitgliedstaaten der EU (unter ihnen Österreich) die Dienstleistungsrichtlinie umsetzten, beschleunigte sich das Wachstum der Dienstleistungsexporte von durchschnittlich 8% auf 11% p. a. Die Erlöse aus grenzüberschreitenden Versicherungs- und Finanzdienstleistungen, die im EU-Binnenmarkt lukriert werden, haben aber infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise an Bedeutung verloren. Ihr Anteil an den Dienstleistungserlösen aus der EU halbierte sich auf 6% bzw. 2 Mrd EUR.
Vergleicht man die Struktur der Dienstleistungsexporte in die EU-Mitgliedstaaten mit jener in Drittstaaten, zeigt sich, dass der Dienstleistungsverkehr mit Mitgliedstaaten weniger wissensintensiv ist 73 : Im Jahr 2018 trugen wissensintensive Dienstleistungen zu mehr als 50% zu den Exporterlösen aus der Extra-EU bei, innerhalb der EU lag der Anteil darunter (45% oder rund 15 Mrd EUR). Einerseits hat der Transport, der in Österreich vom Straßentransport dominiert wird, außerhalb der EU eine vergleichsweise untergeordnete Bedeutung (26% der Gesamterlöse); zum anderen stehen technologieintensive Dienstleistungen in engem Zusammenhang mit dem Warenverkehr (insbesondere Ingenieursleistungen, F&E; Dell’mour und Walter, 2009). Das eröffnet ihnen eine größere regionale Reichweite, und sie können digital ausgetauscht werden, d. h.sie sind per se grenzüberschreitend (Mode 1).
1.1.3 Internationale Vergleiche
Die bei EUROSTAT aktuell verfügbaren Daten des ITSS 74 zeigen, dass der Export unternehmensnaher Dienstleistungen aus Österreich im EU-Vergleich in absoluter Größe (Rang 10) als auch im Verhältnis zur gesamten Wirtschaftsleistung (Rang 11) im oberen Mittelfeld bzw. am oder über dem EU-Durchschnitt 75 liegt. Die größte Bedeutung, gemessen an der gesamten Wertschöpfung, hat der freie Dienstleistungsverkehr für Luxemburg und Malta. Dies dürfte auf die Niederlassung multinationaler Konzerne zurückzuführen sein. Für internationale Vergleiche Österreichs werden oftmals Finnland und Schweden herangezogen. Alle drei Länder sind 1995 der EU beigetreten, zwei davon haben den Euro eingeführt. Es zeigt sich, dass der Export von Dienstleistungen beider Vergleichsländer, sowohl in absoluter Größe als auch im Verhältnis zum BIP, hinter Österreich liegt. Man kann daraus schließen, dass es Österreich vergleichsweise gut gelungen ist, die WWU für den Dienstleistungsverkehr zu nutzen. Allerdings legen auch die wichtigen Determinanten gemeinsame Sprache und Nähe die Fokussierung auf die Region nahe.
Für eine Einschätzung, ob Österreich einen komparativen Vorteil im Dienstleistungsverkehr hat, haben wir den RCA-Index (Revealed Comparative Advantage Index oder Balassa-Index) berechnet. In der Außenwirtschaftsanalyse wird der Index angewandt, um den relativen Vorteil (oder Nachteil) eines Landes im Handel mit Gütern und Dienstleistungen zu bestimmen. In der vorliegenden Untersuchung werden die drei Handelskategorien, Güter, unternehmensnahe Dienstleistungen und Reiseverkehr herangezogen, und zwar für Österreich und für die EU-28, wobei zwischen innergemeinschaftlichem Handel und jenem mit Drittstaaten unterschieden wird.
Der RCA-Index wird definiert als: RCA = (Eij / Eit) / (Enj / Ent), wobei E für Exporte steht, i für das betreffende Land, n für die Gesamtheit aller Länder, j für die Handelskategorie und t für die Gesamtheit der Handelskategorien.
Demnach entspricht der RCA-Index dem Anteil des Exports einer Handelskategorie j (Eij / Eit) an den Gesamtexporten eines Landes, dividiert durch den Anteil der weltweiten oder regionalen Exporte in dieser Kategorie (Enj / Ent) an den Gesamtexporten der Welt oder der Region. Ein komparativer Vorteil besteht dann, wenn der RCA-Index eine Ausprägung von > 1 annimmt. Im anderen Fall, wenn der RCA-Index niedriger ausfällt, ist das ein Hinweis, dass das Land in der jeweiligen Handelskategorie einen komparativen Nachteil hat.
Der RCA-Index zeigt, dass Österreich im Export von unternehmensnahen Dienstleistungen innerhalb der EU einen komparativen Vorteil besitzt, während ein komparativer Nachteil im Export in Drittstaaten besteht. Allerdings ist der Wert von etwa 1,1 des RCA-Index gegenüber der EU überraschend niedrig, wobei dieser Wert bis 2013 stieg, seither aber abgenommen hat. Für Österreich bedeutet dies keinen großen komparativen Vorteil im Dienstleistungsexport innerhalb der EU: Trotz der Dienstleistungsfreiheit sind Österreichs Handelsvorteile aus der Fokussierung auf die EU-Mitgliedstaaten als Zielmärkte sowohl im Vergleich zu den übrigen Handelskategorien als auch im Vergleich zu den Dienstleistungsexporten der EU im Verhältnis zu den Gesamtexporten der Region gering. Gegenüber der Extra-EU ist der komparative Nachteil Österreichs im Dienstleistungsverkehr in den letzten Jahren sogar größer geworden 76 .
1.2 Struktur und strukturelle Determinanten des freien Dienstleistungsverkehrs
Empirische Theorien, welche Firmen am internationalen Handel teilnehmen, basieren Großteils auf dem Handel mit Gütern, wo Exportunternehmen im Allgemeinen größer, produktiver, wissens- und kapitalintensiver sind (Bernard et al., 2007). Obwohl einige der Erkenntnisse auch auf Firmen im Dienstleistungsverkehr zutreffen, sind die Besonderheiten im Austausch von Dienstleistungen, wie eingangs beschrieben, zu berücksichtigen. Nur wenige Unternehmen nehmen am Export von Dienstleistungen teil 77 , weiters ist die Firmengröße entscheidend, es gibt große Unterschiede zwischen den verschiedenen Dienstleistungsbranchen und eine hohe Konzentration der Exporte innerhalb der Branche und mit den Zielmärkten und reine Dienstleistungsexporteure zeichnen sich durch eine hohe Wissensintensität aus (Breinlich und Criscuolo, 2011). Um dies für die österreichischen Exporteure unternehmensnaher Dienstleistungen zu untersuchen, ziehen wir die Befragungsergebnisse von rund 5.000 Unternehmen heran 78 und verknüpfen sie mit Informationen aus anderen Quellen, nämlich der Leistungs- und Strukturerhebung und der Foreign Affiliates Trade Statistics (FATS). Dadurch erhalten wir Informationen über die Wirtschaftsbranchen, Unternehmensgrößen (Anzahl an Beschäftigten) und Unternehmensformen (inländische oder ausländische Kontrolle).
Die Wirtschaftsbranche, die den freien Dienstleistungsverkehr in den letzten rund zehn Jahren dominierte (zu durchschnittlich 39%), ist das Verkehrswesen 79 . So ist der Transport die wichtigste Dienstleistungsexportkategorie Österreichs. Dahinter folgt, noch mit Abstand, der sich aber in den letzten zehn Jahren angesichts eines überdurchschnittlichen Wachstums von 7% p.a. deutlich verringerte, die Sachgüterindustrie 80 mit rund 17%. Angeführt wird diese von den Hochtechnologiebranchen Elektrotechnik und Elektronikindustrie, gefolgt vom Maschinenbau 81 . Auf freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleister entfallen rund 11% der Exporte in die WWU. Es folgen Information und Kommunikation (rund 9%), deren Exporte im Durchschnitt um rund 10% p.a. stiegen, und der Handel (rund 7%).
Vergleicht man diese Branchenstruktur mit jener der Exporte unternehmensnaher Dienstleistungen in Nicht-EU-Mitgliedstaaten, ergeben sich einige interessante Unterschiede. Die sektorale Analyse hat bereits gezeigt, dass der Transportsektor außerhalb der EU weniger Bedeutung hat (rund 30%). Dem gegenüber hat die Sachgüterindustrie – angeführt von der chemischen Industrie – einen vergleichsweise höheren Anteil am Export in die Extra-EU (rund 21% der gesamten Exporte von unternehmensnahen Dienstleistungen) und diese weist eine dynamischere Entwicklung auf (rund +12% p. a.). Hinzu kommt, und das ist überraschend, dass auch freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleister beim Export in Nicht-EU-Mitgliedstaaten eine vergleichsweise höhere Bedeutung aufweisen (19%). Im Detail sind es Architekten und Ingenieure sowie die Forschung und Entwicklung, deren Exporte im außergemeinschaftlichen Dienstleistungsverkehr ein größeres Gewicht haben als innerhalb der EU. Das legt einen Zusammenhang mit den Sachgüterexporten und dem dafür bereitgestellten Know-how nahe. Eine Bestätigung dieser Annahme erlauben die verfügbaren Daten leider nicht. Insgesamt nimmt die Bedeutung des EU-Binnenmarkts für Dienstleistungsexporte der Sachgüterindustrie im Zeitverlauf ab, während sie für den Dienstleistungssektor zunimmt. Eine Untersuchung der Entwicklung am intensiven und extensiven Rand zeigt, dass bei den Dienstleistungsexporten der Industrie die Exportdiversifikation bedeutsamer ist, vor allem bei technologieintensiveren Branchen (Walter, 2017). Rouzet et al. (2017) weisen darauf hin, dass die Kosten, um mit Beschränkungen im Dienstleistungsverkehr umzugehen, für Exporteure von Sachgütern und verschiedenen Dienstleistungen niedriger sind als für reine Dienstleistungsexporteure.
| Darstellung nach der Wirtschaftsbranche (ÖNACE 2008) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branchencode | Bezeichnung | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| in Mio EUR | ||||||||||||
| A+B | Landwirtschaft, Bergbau | 11 | 6 | 6 | 3 | 11 | 8 | 8 | 8 | 24 | 15 | |
| C | Herstellung von Waren | 2.639 | 2.604 | 2.721 | 2.778 | 3.013 | 3.785 | 3.748 | 3.908 | 4.028 | 4.858 | |
| 10–12 | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | 31 | 45 | 51 | 26 | 43 | 79 | 79 | 80 | 73 | 77 | |
| 13–15 | Textilien, Bekleidung, Leder | 7 | 7 | 37 | 37 | 33 | 37 | 41 | 42 | 42 | 45 | |
| 16–18 | Holz, Papier, Druckerei | 135 | 130 | 129 | 153 | 162 | 187 | 205 | 218 | 241 | 256 | |
| 19–22 | Chemie, Kunststoff, Pharma | 378 | 331 | 323 | 330 | 368 | 431 | 445 | 414 | 479 | 571 | |
| 23 | Glas, Steinwaren | 35 | 32 | 26 | 26 | 29 | 41 | 44 | 46 | 49 | 53 | |
| 24–25 | Metall und Metallwaren | 180 | 171 | 161 | 176 | 252 | 388 | 412 | 480 | 522 | 523 | |
| 26–27 | Elektrotechnik, Elektronik, Optik | 857 | 669 | 703 | 657 | 771 | 695 | 651 | 844 | 823 | 1.019 | |
| 28 | Maschinenbau | 300 | 307 | 372 | 410 | 550 | 666 | 708 | 734 | 799 | 1.062 | |
| 29–30 | Fahrzeugbau | 213 | 289 | 348 | 363 | 181 | 552 | 651 | 596 | 527 | 621 | |
| 31–33 | Sonstige Waren, Reparatur | 503 | 623 | 572 | 599 | 622 | 709 | 511 | 457 | 473 | 631 | |
| D+E | Energie, Wasser, Abfall | 140 | 116 | 116 | 128 | 181 | 159 | 227 | 315 | 400 | 543 | |
| F | Bauwesen | 796 | 598 | 565 | 526 | 502 | 515 | 508 | 686 | 740 | 788 | |
| G | Handel | 1.357 | 1.039 | 952 | 1.225 | 1.321 | 1.544 | 1.542 | 1.639 | 1.802 | 1.988 | |
| 45 | Fahrzeughandel, Reparatur | 123 | 94 | 106 | 185 | 237 | 256 | 246 | 240 | 269 | 324 | |
| 46 | Großhandel | 1.117 | 830 | 741 | 934 | 953 | 1.119 | 1.096 | 1.216 | 1.331 | 1.447 | |
| 47 | Einzelhandel | 117 | 115 | 105 | 106 | 131 | 169 | 199 | 183 | 203 | 217 | |
| H+I | Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastronomie | 6.960 | 5.687 | 6.278 | 7.074 | 7.366 | 7.946 | 8.170 | 8.716 | 9.020 | 9.819 | |
| 49–51 | Verkehr (Land, Luft, See) | 2.736 | 2.184 | 2.458 | 2.776 | 2.860 | 2.943 | 2.841 | 3.043 | 2.859 | 3.329 | |
| 52–56 | Lagerei, Post- u. Kurierdienste, Beherbergung u.Gastronomie | 4.224 | 3.503 | 3.820 | 4.298 | 4.506 | 5.004 | 5.328 | 5.672 | 6.161 | 6.491 | |
| J | Information und Kommunikation | 1.174 | 1.137 | 1.132 | 1.447 | 1.652 | 2.009 | 2.234 | 2.240 | 2.513 | 2.808 | |
| 58 | Verlagswesen | 87 | 78 | 71 | 82 | 117 | 179 | 187 | 209 | 219 | 237 | |
| 59–61 | Rundfunk, Filmverleih, Telekommunikation | 491 | 492 | 443 | 463 | 457 | 444 | 445 | 446 | 543 | 507 | |
| 62–63 | Informationstechnologie | 596 | 567 | 618 | 902 | 1.079 | 1.386 | 1.602 | 1.585 | 1.751 | 2.064 | |
| K | Versicherung und Finanzwesen | 1.385 | 1.153 | 1.281 | 1.150 | 1.155 | 1.031 | 1.006 | 874 | 868 | 797 | |
| Quelle: OeNB, Statistik Austria. | ||||||||||||
| 1 Für alle Firmen, die an der Befragung des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs teilnehmen und über eine Firmenbuchnummer verfügen. | ||||||||||||
| Darstellung nach der Wirtschaftsbranche (ÖNACE 2008) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branchencode | Bezeichnung | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| in Mio EUR | ||||||||||||
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 76 | 71 | 42 | 36 | 38 | 116 | 172 | 31 | 34 | 39 | |
| M | Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 1.924 | 1.858 | 1.541 | 1.741 | 1.834 | 2.231 | 2.350 | 2.582 | 2.864 | 3.001 | |
| 69-70 | Rechts- und Steuerberatung; Verwaltung, Führung von Unternehmen, Unternehmensberatung | 992 | 1.016 | 857 | 1.011 | 1.083 | 1.334 | 1.452 | 1.542 | 1.722 | 1.799 | |
| 71 | Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 427 | 369 | 258 | 304 | 263 | 336 | 300 | 358 | 406 | 364 | |
| 72 | Forschung und Entwicklung | 237 | 228 | 168 | 156 | 204 | 240 | 293 | 359 | 398 | 484 | |
| 73 | Werbung und Marktforschung | 232 | 206 | 233 | 244 | 238 | 258 | 270 | 291 | 303 | 320 | |
| 74-75 | Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | 38 | 39 | 25 | 26 | 47 | 62 | 34 | 33 | 35 | 35 | |
| N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 458 | 379 | 359 | 432 | 490 | 611 | 629 | 671 | 737 | 782 | |
| 77 | Vermietung beweglicher Sachen | 203 | 162 | 154 | 182 | 224 | 287 | 280 | 296 | 334 | 371 | |
| 78 | Vermittlung u. Überlassung v. Arbeitskräften | 17 | 10 | 10 | 21 | 30 | 30 | 27 | 31 | 50 | 56 | |
| 79 | Reisebüros, -veranstalter | 113 | 77 | 77 | 84 | 86 | 96 | 88 | 99 | 116 | 122 | |
| 80-82 | Wachdienste, Detekteien, Gebäudereinigung, sonstige | 124 | 130 | 118 | 146 | 150 | 199 | 234 | 244 | 237 | 233 | |
| O-U | Öffentliche und persönliche Dienste | 69 | 55 | 73 | 71 | 65 | 167 | 158 | 181 | 227 | 244 | |
| nicht zuteilbar | 101 | 157 | 325 | 379 | 450 | 294 | 577 | 285 | 17 | 13 | ||
| Insgesamt | 17.091 | 14.862 | 15.391 | 16.990 | 18.078 | 20.415 | 21.328 | 22.135 | 23.273 | 25.694 | ||
| Quelle: OeNB, Statistik Austria. | ||||||||||||
| 1 Für alle Firmen, die an der Befragung des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs teilnehmen und über eine Firmenbuchnummer verfügen. | ||||||||||||
Es stellt sich die Frage, ob der freie Dienstleistungsverkehr innerhalb der EU kleinen Firmen Exportchancen ermöglicht. Dass Unternehmen im Dienstleistungssektor die „kritische Größe“ fehlt, um überhaupt in internationalen Märkten wettbewerbsfähig sein zu können, wird oftmals als Grund für eine mangelnde Internationalisierung des Sektors genannt 82 . So weisen Ebeke et al. (2019) darauf hin, dass eine kleinbetriebliche Struktur die Produktivitätsentwicklung im Dienstleistungsbereich negativ beeinflusst und nur beschränkte Skalenerträge ermöglicht. Rouzet et al. (2017) finden anhand der Untersuchung von Mikrodaten verschiedener Länder, dass spezifische Restriktionen im Dienstleistungsverkehr vor allem die Beteiligung von Klein- und Mittelbetrieben verhindern. Für Österreich zeigt sich, dass die Beteiligung von Kleinbetrieben am Export innerhalb der EU zwar niedrig, aber vergleichsweise höher als in Nicht-EU-Mitgliedstaaten ist: Der Anteil von Großunternehmen (250 Beschäftigte und mehr) am Export in die EU liegt aktuell unter 50% (Extra-EU: 59%), der Anteil von Kleinbetrieben (unter 50 Beschäftigte) bei 21% (Extra-EU: 15%). Dass kleinbetriebliche Strukturen ein geringeres Hindernis im Dienstleistungsverkehr innerhalb der EU als außerhalb der EU sind, ist in den meisten der erbrachten Dienstleistungsarten der Fall, vor allem bei Erlösen aus der Vergabe von Patenten und Lizenzen, bei Beratungsleistungen, technischen, Handels- und sonstigen unternehmensbezogenen Dienstleistungen. Allerdings seit dem Jahr 2013 – dem Jahr seit dem aufgrund von statistischen Reklassifikationen Vergleiche möglich sind – ist der Anteil von Kleinbetrieben am freien Dienstleistungsverkehr innerhalb der EU rückläufig.
| Darstellung nach der Unternehmensgröße (Anzahl der Beschäftigten per Ultimo) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstleistungsart | Anzahl der Beschäftigten | nicht zuteilbar | Insgesamt | ||
| 0–49 | 50–249 | 250+ | |||
| in Mio EUR | |||||
| Gebühren für Lohnveredelung | 73 | 191 | 454 | 2 | 719 |
| Reparaturdienstleistungen | 44 | 109 | 382 | 14 | 549 |
| Transport | 1.949 | 3.070 | 5.282 | 119 | 10.421 |
| Bauleistungen | 58 | 229 | 311 | 28 | 625 |
| Versicherungsdienstleistungen | 39 | 208 | 88 | 1 | 336 |
| Finanzdienstleistungen | 63 | 86 | 260 | 73 | 482 |
| Patente, Lizenzen, Franchise und Handelsmarken | 226 | 218 | 208 | 55 | 706 |
| Telekommunikations-, EDV- und Informationsdienstleistungen | 782 | 997 | 1.520 | 304 | 3.604 |
| Sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 2.219 | 1.991 | 3.661 | 253 | 8.124 |
| Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 76 | 175 | 1.165 | 20 | 1.435 |
| Rechts- und Wirtschaftsdienste, Werbung und Marktforschung | 805 | 721 | 432 | 65 | 2.024 |
| Technische, Handels- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 1.339 | 1.094 | 2.064 | 168 | 4.665 |
| Dienstleistungen für persönliche Zwecke, für Kultur und Erholung | 37 | 21 | 7 | 63 | 129 |
| Insgesamt | 5.491 | 7.119 | 12.173 | 911 | 25.694 |
| Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||
| 1 Für alle Firmen, die an der Befragung des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs teilnehmen und über eine Firmenbuchnummer verfügen. | |||||
Eine weitere Frage ist, inwieweit die Exporte aus Österreich auf die Niederlassung multinationaler Konzerne zurückzuführen sind. Eine Annahme könnte sein, dass dies im innergemeinschaftlichen Dienstleistungsverkehr stärker der Fall ist, da ausländische Konzerne Österreich quasi als „entry point“ in die EU nutzen. Wie die Unternehmensstatistiken zeigen, dürfte das aber nicht der Fall sein bzw. ist der Anteil der Exporte, die unter ausländischer Kontrolle stattfinden, innerhalb der EU niedriger als außerhalb der EU (29% im Vergleich zu 36%). Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der freie Dienstleistungsverkehr vor allem von heimischen Unternehmen determiniert wird. In der Forschung und Entwicklung, bei Beratungsleistungen, technischen, Handels- und sonstigen unternehmensnahen Dienstleistungen haben Unternehmen unter ausländischer Kontrolle allerdings eine vergleichsweise höhere Bedeutung im Export innerhalb als außerhalb der EU. Unter jenen Ländern, die die Beteiligungen aus dem Ausland dominieren, sind Deutschland, die USA, Italien, das Vereinigte Königreich, die Schweiz und die Niederlande. Der kurze Zeitreihenvergleich seit dem Jahr 2013 zeigt klar, dass der Anteil heimischer Unternehmen am freien Dienstleistungsverkehr wächst.
| Darstellung nach der Unternehmensform (inländische oder ausländische Kontrolle) | |||
|---|---|---|---|
| Dienstleistungsart | Unternehmensform, Firmen unter | Insgesamt | |
| inländischer Kontrolle | ausländischer Kontrolle2 | ||
| in Mio EUR | |||
| Gebühren für Lohnveredelung | 353 | 366 | 719 |
| Reparaturdienstleistungen | 340 | 209 | 549 |
| Transport | 9.066 | 1.355 | 10.421 |
| Bauleistungen | 522 | 103 | 625 |
| Versicherungsdienstleistungen | 323 | 13 | 336 |
| Finanzdienstleistungen | 377 | 105 | 482 |
| Patente, Lizenzen, Franchise und Handelsmarken | 514 | 192 | 706 |
| Telekommunikations-, EDV- und Informationsdienstleistungen | 1.956 | 1.648 | 3.604 |
| Sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 4.569 | 3.555 | 8.124 |
| Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 415 | 1.020 | 1.435 |
| Rechts- und Wirtschaftsdienste, Werbung und Marktforschung | 1.207 | 817 | 2.024 |
| Technische, Handels- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 2.947 | 1.718 | 4.665 |
| Dienstleistungen für persönliche Zwecke, für Kultur und Erholung | 99 | 30 | 129 |
| Insgesamt | 18.119 | 7.575 | 25.694 |
| Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||
| 1 Für alle Firmen, die an der Befragung des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs teilnehmen und über eine Firmenbuchnummer verfügen. | |||
| 2 Firmen mit direkter oder indirekter Beteiligung eines ausländischen Konzerns von mindestens 50% am Grundkapital. | |||
1.3 Entwicklung und Struktur der Nutzung von Niederlassungsfreiheit
Die Erbringung durch gewerbliche Präsenz in der EU (Mode 3) betrifft die Nutzung der Niederlassungsfreiheit im Austausch von Dienstleistungen. Der Niederlassungsverkehr kann komplementär oder substituierend zum grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr sein. Aktuell kann der Umfang dieser Erbringungsart nur approximiert werden, da die Statistik nicht nach der Art der Umsatzerlöse im Ausland unterscheidet. Internationale Untersuchungen legen jedoch nahe, dass es sich um die wichtigste Erbringungsart handelt (Francois und Hoekmamn, 2010). Laut FATS betrugen die Umsatzerlöse des österreichischen Dienstleistungssektors aus Standorten innerhalb der EU im Jahr 2017 tatsächlich ein Vielfaches der in Mode 1, 2 und 4 lukrierten Exporterlöse (rund 114 Mrd EUR). Inzwischen haben die Umsätze des tertiären Sektors in der Nutzung der Niederlassungsfreiheit jene des sekundären Sektors bzw. der Sachgüterindustrie im engeren Sinn überholt. Um die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs laut ITSS zu erhöhen, kann man den tertiären Sektor um den Bau, der als Dienstleistungsart in der ITSS erfasst ist, sowie um die Dienstleistungserlöse der Sachgüterindustrie erweitern 83 (auf rund 130 Mrd EUR). Im Vergleich erbrachten die approximierten Dienstleistungsexporte über Auslandstochtergesellschaften außerhalb der EU noch höhere Erlöse (rund 145 Mrd EUR). Eine zunehmende Nutzung der Niederlassungsfreiheit innerhalb der EU, die die Persistenz und beschränkte Dynamik im grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr zusätzlich beitragen würde, zu erklären, kann nicht beobachtet werden: Mit einem durchschnittlichen Wachstum von rund 6% p. a. in den letzten rund 10 Jahren lag die Expansionsrate des Mode 3 innerhalb der EU deutlich unter jener in der Extra-EU (+rund 15% p. a.) und nur knapp über der Entwicklung der Modes 1,2 und 4 laut ITSS (+rund 5%).
Im innergemeinschaftlichen Umsatz von Auslandstöchtern dominierte in den letzten zehn Jahren augenscheinlich der Handel (rund 65% der Exporterlöse durch Mode 3), und das mit zunehmender Tendenz 84 . Das Finanz- und Versicherungswesen folgte danach, wobei dessen Bedeutung jedoch abgenommen hat (rund 21%). Die Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen hatte in der Auslandspräsenz kaum Relevanz (rund 2%), etwas mehr die Erbringung durch Unternehmen der Information und Kommunikation (rund 4%). Die Zusammenfassung der gesamten Erlöse aus der Nutzung der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit innerhalb der EU für die einzelnen Dienstleistungssparten zeigt, dass der österreichische Handel – trotz Digitalisierung – fast ausschließlich die Niederlassungsfreiheit nutzt, während es bei den freiberuflichen Dienstleistern eine annähernde Gleichverteilung der Erbringungsarten gibt. In der Information und Kommunikation entfällt nur rund ein Drittel auf den Niederlassungsverkehr. Hier ist allerdings in den letzten zehn Jahren eine gewisse Dynamik bei den Auslandstöchtern in der EU festzustellen (+rund 9% p.a.), während der freiberufliche Niederlassungsverkehr innerhalb der EU vergleichsweise stagniert.
| Branchencode | Bezeichnung/Sektor | Auslandstöchter in der EU | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| in Mio EUR | |||||||||||
| A+B | Landwirtschaft, Bergbau | 1.781 | 1.262 | 1.497 | 1.262 | 1.255 | 1.821 | 1.883 | 2.610 | 6.213 | 3.107 |
| C | Herstellung von Waren | 70.210 | 58.992 | 66.309 | 77.182 | 80.219 | 79.002 | 80.522 | 68.750 | 79.300 | 86.948 |
| D+E | Energie, Wasser, Abfall | 5.065 | 4.458 | 2.740 | 3.505 | 3.883 | 3.470 | 4.242 | 4.296 | 5.536 | 6.789 |
| F | Bauwesen | 6.830 | 7.603 | 8.890 | 8.738 | 8.367 | 7.866 | 8.490 | 8.845 | 8.467 | 9.271 |
| G | Handel | 36.174 | 40.750 | 42.643 | 52.474 | 63.824 | 61.868 | 67.070 | 65.842 | 71.972 | 78.886 |
| H+I | Verkehr, Lagerei, Beherbergung und Gastronomie | 2.344 | 2.449 | 3.078 | 3.300 | 4.125 | 4.269 | 4.319 | 3.704 | 4.146 | 4.863 |
| J | Information und Kommunikation | 2.634 | 2.742 | 2.852 | 3.488 | 3.693 | 3.852 | 4.224 | 4.475 | 4.795 | 5.512 |
| K | Versicherung und Finanzwesen | 16.514 | 17.183 | 19.210 | 18.419 | 19.931 | 18.469 | 18.132 | 17.609 | 15.465 | 16.403 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1.008 | 877 | 981 | 1.093 | 762 | 927 | 780 | 887 | 1.040 | 1.087 |
| M | Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 2.113 | 1.450 | 1.479 | 1.214 | 2.057 | 1.934 | 1.978 | 2.127 | 2.175 | 2.249 |
| N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.666 | 1.209 | 1.058 | 1.550 | 1.704 | 1.760 | 1.778 | 1.730 | 1.779 | 1.662 |
| O-U | Öffentliche und persönliche Dienste | 500 | 703 | 746 | 760 | 881 | 1.102 | 1.250 | 2.059 | 2.795 | 3.151 |
| INSGESAMT | 146.839 | 139.678 | 151.483 | 172.985 | 190.701 | 186.340 | 194.668 | 182.934 | 203.683 | 219.928 | |
| Quelle: Statistik Austria, Statistik der Auslandsunternehmenseinheiten. | |||||||||||
| 1 Mehrheitlich (>50%) unter inländischer Kontrolle stehende Unternehmen im Ausland. | |||||||||||
2 Effekte auf die österreichische Wirtschaft
Wir haben die Entwicklung und Struktur des freien, unternehmensnahmen Dienstleistungsverkehrs für Österreich untersucht und eine hohe, stabil bleibende Integration in den Binnenmarkt und eine (relativ) beschränkte Wachstumsdynamik festgestellt. Wenn wir nun die Effekte für die österreichische Wertschöpfung ableiten, müssen wir eine Gesamtschau anwenden. Wir berücksichtigen dementsprechend Exporte und Importe und damit den Gesamteffekt des freien Dienstleistungsverkehrs auf das Bruttoinlandsprodukt. 85 Die Untersuchung baut auf den Ergebnissen der Input-Output-Statistik 86 und daraus abgeleiteten Wertschöpfungsmultiplikatoren und Endnachfrageeffekten auf. Bei der Erstellung von Input-Output-Analysen dieser Art werden die direkten und indirekten Auswirkungen auf die Primärinputs (Wertschöpfung und Importe von Vorleistungsgütern) berücksichtigt. Input-Output-Multiplikatoren sind demnach Kennzahlen der Intensität und der verschiedenen Aspekte von Verflechtungen in einer Volkswirtschaft aufgrund der arbeitsteiligen Wirtschaftsstruktur, sowohl innerhalb der nationalen Volkswirtschaft als auch mit dem Rest der Welt. 87 Maßzahlen sind der Importmultiplikator und der Wertschöpfungsmultiplikator. Diese Multiplikatoren addieren sich auf eins, weil sich eine zusätzliche Einheit an Export zu jeweils einem Teil auf eine zusätzliche heimische Wertschöpfung und eine zusätzliche ausländische Wertschöpfung (Importe, die in die Erwirtschaftung der Exporte eingehen) aufteilt. Ein fortschreitender Trend zur Auslagerung von Produktionsschritten ins Ausland und damit eine Zunahme von Vorleistungsimporten führt somit in einer Zeitreihenbetrachtung zu einem sinkenden Wertschöpfungsmultiplikator und einem steigenden Importmultiplikator. Das bedeutet, dass Wertschöpfungseffekte, die aufgrund beobachteter Exportsteigerungen erwartet werden, durch die ebenfalls globalisierungsinduzierten Importsteigerungen von Vorleistungsgütern abgeschwächt werden.
2.1 Wertschöpfungsgehalt der Dienstleistungsexporte
Wir haben die direkten und indirekten Effekte 88 auf die Wertschöpfung berechnet, die von den Endnachfragekategorien für ein bestimmtes Jahr ausgehen. Es erfolgte also eine Zurechnung der für ein bestimmtes Jahr gegebenen Wertschöpfung auf die Endnachfragekategorien (Exporte – Güter und Dienstleistungen, ohne Reiseverkehr -, Konsumausgaben und Bruttoinvestitionen). Bei der Endnachfragekategorie „Exporte“ haben wir zwischen Gütern und Dienstleistungen (ohne Reiseverkehr) sowie zwischen EU- und Extra-EU unterschieden. Die graphische Darstellung zeigt den Anteil der von der Exportnachfrage induzierten Wertschöpfung an der Gesamtwertschöpfung Österreichs im Zeitverlauf und ist in Relation zu den übrigen Endnachfragekategorien (Konsumausgaben und Bruttoinvestitionen) zu sehen. Die relative Bedeutung der gesamten Exportnachfrage für die heimische Wertschöpfung hat vom Jahr 1995 bis zum Jahr 2007 – im Verhältnis zu den übrigen Endnachfragekategorien – deutlich zugenommen (um 9,5 Prozentpunkte auf 30,5%). Getragen wurde diese Entwicklung von der Wertschöpfungsintensität der Exporte in die EU. Die Entwicklung der Wertschöpfungsintensität der Extra-EU-Exporte verlief wesentlich flacher und hat ihren „peak“ bereits im Jahr 2000 erreicht. Danach haben die relativen Wertschöpfungseffekte des Extra-EU-Exports tendenziell abgenommen. Deutlich zu erkennen ist die Zäsur, die die Finanz- und Wirtschaftskrise für den Wertschöpfungsgehalt der EU-Exporte in Österreich hatte und das bereits beginnend im Jahr 2008, vor dem globalen Handelseinbruch. Im Verlauf der Wirtschaftskrise sind die heimischen Endnachfragekomponenten relativ bedeutsamer geworden.
In den Gesamtexporten spiegelt sich der Anstieg des relativen Anteils der Sachgüterexporte an der Wertschöpfung in Österreich seit Beginn des EU-Beitritts bis zum Jahr 2007 wider. Der Wertschöpfungsgehalt der Exporte in Länder außerhalb der EU war bereits nach der Jahrtausendwende rückläufig; jener der Exporte in die EU weist einen Rückgang im Zuge der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 und des globalen Handelskollaps im Jahr 2009 auf. Seit dem EU-Beitritt Österreichs hat sich die Wertschöpfungsintensität der Extra-EU-Exporte verringert (von 5,6% im Jahr 1995 auf ein Minimum von 3,6% im Jahr 2012, mit einem leichten Anstieg auf 4,8% im Jahr 2016). Jene der Sachgüterexporte in die EU ist zwar gestiegen, die Intensität vor Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise wurde aber bislang nicht wieder erreicht (10,7% im Jahr 1995, ein Maximum von 14,5% im Jahr 2007 und 12,6% im Jahr 2016).
Im Gegensatz zu den Sachgüterexporten hat der relative Anteil der Dienstleistungsexporte an der heimischen Wertschöpfung im gesamten Zeitverlauf, seit dem EU-Beitritt Österreichs, deutlich zugenommen (von 4,7% im Jahr 1995 auf 11% im Jahr 2008 bzw. 10,8% im Jahr 2016). Der Rückgang des relativen Wertschöpfungseffekts im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise verlief zeitverzögert und schwächer als bei den Sachgüterexporten. Bei den Exporten in die Extra-EU ist ein mäßiger Anstieg der Wertschöpfungsintensität festzustellen (von 1,9% im Jahr 1995 auf 3,1% im Jahr 2016). Hingegen nahm der relative Anteil der Dienstleistungsexporte in die EU an der heimischen Wertschöpfung deutlich zu (von 2,8% im Jahr 1995 auf 7,7% im Jahr 2016) und hat inzwischen das Vorkrisenniveau wieder erreicht. Der Abstand des relativen Wertschöpfungsanteils zu den Sachgüterexporten hat sich damit verringert 89 .
2.2 Ableitung der Endnachfragemultiplikatoren
In einer Input-Output-analytischen-Modellanwendung lassen sich aus den errechneten Wertschöpfungsgehalten der Exporte und den gegebenen Exporten Endnachfragemultiplikatoren ableiten 90 . Die dargestellten Endnachfragemultiplikatoren geben den Gesamteffekt auf die heimische Wertschöpfung an, der von einer zusätzlichen Exportnachfrage in Höhe von einer Währungseinheit ausgeht. Die Spalten Exporte Summe sowie Exporte EU und Exporte Extra-EU zeigen den Effekt der Nachfrage in durchschnittlicher, gütermäßiger Zusammensetzung. Die Spalten Sachgüter und „Dienstleistungen ermöglichen eine getrennte Beobachtung der Effekte, die von einer zusätzlichen Nachfrage in der jeweiligen Kategorie ausgehen. Die Endnachfragemultiplikatoren für Dienstleistungen sind generell höher als jene für Sachgüter. So ist die Produktion von Dienstleistungen wertschöpfungsintensiver, weil der Produktionsprozess arbeitsintensiv und weniger vorleistungslastig ist. Der Multiplikator von 0,7310 in der letzten Zeile der Spalte EU-Dienstleistungen besagt beispielweise, dass von einer Exportnachfrage in der Höhe von 1 Mio EUR im Jahr 2016 direkte und indirekte Wertschöpfungseffekte von 731.000 EUR auf die österreichische Volkswirtschaft ausgingen.
| Exporte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global | EU | Extra-EU | EU -Sachgüter | EU- Dienstleistungen | Extra-EU -Sachgüter | Extra-EU -Dienstleistungen | |
| 1995 | 0,665 | 0,658 | 0,679 | 0,621 | 0,856 | 0,632 | 0,868 |
| 2000 | 0,602 | 0,605 | 0,598 | 0,554 | 0,822 | 0,539 | 0,841 |
| 2005 | 0,535 | 0,533 | 0,539 | 0,463 | 0,751 | 0,468 | 0,772 |
| 2006 | 0,525 | 0,519 | 0,537 | 0,451 | 0,738 | 0,463 | 0,765 |
| 2007 | 0,516 | 0,511 | 0,531 | 0,441 | 0,737 | 0,457 | 0,769 |
| 2008 | 0,512 | 0,502 | 0,536 | 0,427 | 0,736 | 0,450 | 0,777 |
| 2009 | 0,553 | 0,549 | 0,561 | 0,478 | 0,754 | 0,473 | 0,799 |
| 2010 | 0,533 | 0,530 | 0,542 | 0,463 | 0,751 | 0,444 | 0,780 |
| 2011 | 0,514 | 0,508 | 0,533 | 0,436 | 0,742 | 0,434 | 0,787 |
| 2012 | 0,517 | 0,522 | 0,502 | 0,454 | 0,740 | 0,384 | 0,781 |
| 2013 | 0,515 | 0,518 | 0,507 | 0,445 | 0,731 | 0,399 | 0,770 |
| 2014 | 0,523 | 0,522 | 0,527 | 0,450 | 0,732 | 0,416 | 0,772 |
| 2015 | 0,530 | 0,522 | 0,548 | 0,448 | 0,730 | 0,456 | 0,767 |
| 2016 | 0,537 | 0,529 | 0,558 | 0,453 | 0,731 | 0,470 | 0,779 |
| Quelle: Statistik Austria. | |||||||
Die Zeitreihenbetrachtung zeigt, dass die höchsten Endnachfragemultiplikatoren der Exporte zu Beginn der EU-Mitgliedshaft auftraten und in weiterer Folge abgenommen haben. Das gilt sowohl für Exporte in die EU als auch in Nicht-EU-Länder, wobei der Rückgang bei den Extra-EU-Exporten tendenziell ausgeprägter ist. Diese Abnahme der Wertschöpfungsmultiplikatoren deutet einerseits auf einen Anstieg der importierten Vorleistungen hin, der zum Beispiel durch Auslagerung von Produktionsschritten ins Ausland hervorgerufen werden kann; andererseits kann der Rückgang auch durch eine Erhöhung der direkten Importanteile in der Endnachfrage hervorgerufen werden. Der Zeitreihenvergleich zeigt weiters, dass der Rückgang der Wertschöpfungsmultiplikatoren bei der Kategorie Sachgüter deutlich ausgeprägter ist als bei den Dienstleistungen. Das deutet auf eine tendenziell stärkere Auslagerung von Produktionsprozessen und auf den Reexporteffekt 91 hin. Bei den Dienstleistungen liegt der Endnachfragemultiplikator der Exporte in Länder außerhalb der EU im gesamten Zeitverlauf über jenem der EU-Exporte, das Differential nimmt sogar zu. Das weist auf die unterschiedliche Zusammensetzung der Dienstleistungsexporte innerhalb und außerhalb der EU hin.
Literaturverzeichnis
Bernard, A., B. Jensen, S. Redding and P. Schott. 2007. Firms in international trade. NBER Working Paper Series 13054. Cambridge. April.
Breinlich, H. und C. Criscuolo. 2011. International trade in services: A portrait of importers and exporters. In: Journal of International Economics 84 (201). März. 188–206.
Borchert, I., B. Gootiiz und A. Mattoo. 2012. Policy barriers to international trade in services: Evidence from a new database. World Bank Policy Research Working Paper 6109.
Breuss, F. 2016. Wirtschaftliche Auswirkungen von „1989“ auf Österreich. In: Müller, W. (Hg.). AUSTRIACA. Österreichische Akademie der Wissenschaften. Wien. 2016. 124–154.
Copenhagen Economics. 2005. Economic assessment of the barriers to the internal market for services.
Corugedo, E. F. und E. Pérez Ruiz. 2014. The EU Services Directive: Gains from further liberalization. IMF Working paper 14/113. 2014.
Dell’mour, R. und P. Walter. 2009. Struktur des Dienstleistungshandels 2006. STATISTIKEN Sonderheft Juni 09. OeNB.
Ebeke, C., J-M. Frie und L. Rabier. 2019. Deepening the EU’s single market for services. IMF Working Paper 19/269. Dezember.
Ebell, M. 2016. Assessing the impact of trade agreements on trade. In: National Institute Economic Review 238. November. 31–42.
Europäische Kommission. 2017. Commission Staff Working Document. Impact Assessment Accompanying the Document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Introducing a European services E-card and Related Administrative Facilities. SWD (2016) 439 Final.
Francois, J. und B. Hoekman. 2010. Services trade and policy. In: Journal of Economic Literature 48 (September 2010). 642–692.
Francois, J., O. Pindyuk und J. Wörz. 2008. Effekte von Liberalisierungsschritten auf den Dienstleistungshandel. Arbeitspaket im Rahmen des Forschungsschwerpunks Internationale Wirtschaft (FIW). Wien.
Fritz, O. und G. Streicher. 2008. Trade Effects of Service Liberalization in the EU – Simulation of Regional Macroeconomic Effects for Austria. FIW Research Report 5. Juni.
Kelle, M. und J. Kleinert. 2010. German firms in services trade. Economic Working Paper. 2010-03. Kiel University. Department of Economics. Kiel. März.
Kolleritsch, E. 2016. Input-Output-Multiplikatoren 2012. Statistische Nachrichten 8/2016. Statistik Austria. Wien. August.
Kulmer, V., M. Kernitzkyi, J. Köberl und A. Niederl. 2015. Global Value Chains: Implications for the Austrian economy. FIW-Research Reports 2014/15. 3. April.
Miroudot, S., J. Sauvage und B. Sheperd. 2013. Measuring the cost of international trade in services. In: World Trade Review (2013) 12:4. 719–735.
OECD. 2020. OECD Services Trade Restrictiveness Index: Policy trends up to 2020. Jänner.
Rouzet, D., S. Benz und F. Spinelli. 2017. Trading firms and trading costs in services: Firm-level analysis. OECD Trade Policy Papers 2010. Dezember.
Walter, P. 2017. Anatomy of Austria’s trade in services. In: Monetary Policy & the Economy. Q1/17. OeNB.
65 Statistik Austria, erwin.kolleritsch@statistik.gv.at; Oesterreichische Nationalbank, Abteilung Statistik – Außenwirtschaft, Finanzierungsrechnung und Monetärstatistiken, patricia.walter@oenb.at. Wir bedanken uns bei Herrn Erich Greul (Statistik Austria) für die Auswertung der Daten und die fachliche Expertise.
66 Dienstleistungen sind nicht lagerbar und verlangen damit die laufende Interaktion bzw. räumliche Nähe von Konsumenten und Anbietern („proximity burden“, Francois und Hoekman, 2010). Technologischer Wandel und Digitalisierung tragen dazu bei, die inhärenten Hürden in einigen Dienstleistungsarten zu vermindern.
67 Die OECD (2020) stellt aktuell fest, dass auch die digitale Bereitstellung von Dienstleistungen, die prinzipiell die Handelbarkeit fördert, zunehmend Beschränkungen unterliegt.
68 Für eine Beschreibung siehe https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive_en.
69 Corugedo und Perez Ruiz (2014) heben insbesondere Artikel 15 hervor, demnach bestehende Restriktionen beibehalten werden können, wenn das dem Schutz öffentlicher Interessen dient. Miroudot et al. (2013) zeigen anhand systematischer Schätzungen der Handelskosten in Dienstleistungssektoren, dass es im EU-Binnenmarkt noch bedeutsame Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten gibt. Schätzungen gehen bei einer ambitionierten Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie von positiven Effekten auf das EU-BIP von bis zu 2,6% aus (Ebeke et al., 2019, EU-Kommission 2017, Copenhagen Economics, 2005).
70 Ein Beispiel für grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr ist der elektronische Austausch von digitalen Prototypen im Maschinenbau oder die telefonische Rechtsberatung eines Kunden im Ausland. Die Planung eines Werbeauftritts beim Kunden im Ausland erfordert hingegen die zeitweise Entsendung von Personen in das Sitzland des Vertragspartners. Die Erbringung von Dienstleistungen vor Ort, im Land des Dienstleistungsanbieters, betrifft im Speziellen waren-bezogene Dienstleistungen wie die Weiterverarbeitung von Rohstoffen und Intermediärgütern (Lohnveredelung).
71 Ein ähnliches Bild zeigt sich, wenn man jene Länder berücksichtigt, in denen Deutsch zu den Amtssprachen zählt (im gesamten Staatsgebiet oder in Teilregionen: Belgien, Deutschland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Schweiz). Auf diese Länder entfallen rund 24 Mrd EUR bzw. 55% der Gesamterlöse, minus drei Prozentpunkte.
72 Darunter fallen Einnahmen aus der Vergabe von Patenten und Lizenzen, Telekommunikationsdienstleistungen, Computer- und Informationsdienste, Leistungen der Forschung und Entwicklung sowie Architektur- und Ingenieursdienste.
73 Der Begriff „wissensintensiv“ orientiert sich an der Klassifikation „knowledge-intensive services“ (KIS) von EUROSTAT, die auf hochtechnologische, marktbezogene, finanzielle und sonstige wissensintensive Dienstleistungen abstellt. In der vorliegenden Untersuchung werden als wissensintensive Dienstleistungsarten technologieintensive Dienstleistungen, Beratungsleistungen und Versicherungs- und Finanzdienstleistungen zusammengefasst.
74 Eine vergleichbare Zeitreihe gibt es bei EUROSTAT ab 2010. Für einige Länder waren die notwendigen Daten für die Abgrenzung von Wirtschaftsdienstleistungen längstens bis 2017 verfügbar (u. a. Irland und das Vereinigte Königreich). Vergleichsdaten für Spanien und Ungarn gibt es nicht.
75 Ohne Luxemburg und Malta.
76 Wir haben auch die Marktanteile des österreichischen, unternehmensnahen Dienstleitungsexports an den Exporten der EU-28 innerhalb und außerhalb der EU berechnet: Zwischen 2010 und 2018 verzeichnete Österreich im Durchschnitt einen Marktanteil von 3,5% innerhalb der EU und 1,5% vis-a-vis der Extra-EU. Nennenswerte Abweichungen um den Mittelwert gab es nicht. Im Verhältnis zu den beiden Vergleichsländern, Schweden und Finnland, ist der Marktanteil Österreichs innerhalb der EU bedeutsamer (absolut oder in der Entwicklung). Der Marktanteil Österreichs außerhalb der EU liegt jedoch deutlich unter jenem Schwedens.
77 Bezogen auf die Grundgesamtheit in Österreich (approximiert durch die Leistungs- und Strukturstatistik) weisen nur knapp 3% der Unternehmen Dienstleistungsexporte oder -importe auf (Dell‘mour und Walter, 2009).
78 Die Befragung zum grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr hat in Österreich im Jahr 2006 begonnen. Harmonisierte Zeitreihen sind ab dem Berichtsjahr 2008 verfügbar. Obwohl von der Untersuchung ausgenommen, sind auch öffentliche und persönliche Dienstleister in den Unternehmensstatistiken inkludiert, um die Auswertungen zu harmonisieren. Das Gesamtergebnis weicht von jenem der ITSS ab, da es keine Hochrechnungen zum Makro- oder Österreich-Aggregat beinhaltet.
79 Da der Tourismus nicht Teil der Unternehmensbefragung ist, sind Beherbergung und Gastronomie von untergeordneter Bedeutung.
80 Hierbei handelt es sich um die Unternehmen, deren Wirtschaftsaktivität im Abschnitt C der ÖNACE 2008, Herstellung von Waren klassifiziert sind. Dem gegenüber zählen zum Dienstleistungssektor oder tertiären Wirtschaftssektor die Abschnitte G bis U, wobei es sich um reine Dienstleistungsanbieter (privatwirtschaftlich und staatlich) handelt.
81 Für Deutschland stellen Kelle und Kleinert (2010) die Bedeutung der Industrie für den Dienstleistungsverkehr fest. Das mag überraschen, wird aber verständlich, wenn man die Einbettung in die internationalen Wertschöpfungsketten berücksichtigt. Österreichs Exporte zeichnen sich durch Sachgüter aus, die in hohem Maß als wissens- und dienstleistungsintensiv zu charakterisieren sind (siehe unter anderem Kulmer et al., 2015).
82 Für Österreich zeigt sich, dass Dienstleistungsexporteure im Durchschnitt zehnmal so groß sind wie der Branchendurchschnitt (Dell‘mour und Walter 2009). Dazu trägt neben den sachlichen Gründen auch die Durchführung der Befragung in Form einer Konzentrationsstichprobe bei.
83 Für die Dienstleistungsumsätze der Warenindustrie haben wir das durchschnittlich beobachtbare Verhältnis von Waren- zu Dienstleistungsexporten herangezogen (7,5%).
84 Zum Vergleich, der Export durch Dienstleistungsfirmen in Form gewerblicher Präsenz außerhalb der EU ist überwiegend (zu 90%) auf den Handel zurückzuführen.
85 Diese Art von Analyse ist im Zusammenhang mit der Diskussion von generellen Effekten der Globalisierung zu sehen, die sich nicht nur auf die Länder der EU beschränken müssen. Einige der für die EU-Exporte identifizierten Effekte werden somit auch bei den Nicht-EU-Exporten zu beobachten sein.
86 Die Analysen basieren auf den österreichischen Input-Output-Tabellen, die von Statistik Austria für das jeweilige Berichtsjahr publiziert wurden. Die Tabellen werden nicht revidiert und sind somit konzeptiv, klassifikatorisch und methodologisch nicht durchgehend vergleichbar. Input-Output-Tabellen sind für die Jahre 1995 und 2000 sowie ab 2005 jährlich, zum Zeitpunkt der Untersuchung bis 2016 verfügbar.
87 Für eine detaillierte Beschreibung siehe Kolleritsch (2016).
88 Direkte Effekte entsprechen den durch die Produktion in der für das nachgefragte Gut charakteristischen homogenen Produktionseinheit induzierten Effekten, indirekte Effekte werden durch die Vorleistungsverflechtungen in anderen homogenen Produktionseinheiten induziert.
89 Mehrere Gründe sind dafür möglich: ein höherer Anteil der Dienstleistungsexporte an der Endnachfrage, die Veränderung in der Zusammensetzung der Exporte (hin zu wertschöpfungsintensiveren Komponenten) oder die Veränderung der „Produktionstechnologie“ bzw. der Bereitstellung der Dienstleistungen (hin zu einer höheren Wertschöpfungsintensität).
90 Wertschöpfungsgehalte dividiert durch Gesamtexporte von heimischen und importierten Gütern und Dienstleistungen.
91 Bei Reexporten handelt es sich um den direkten Verkauf von importierten Gütern ins Ausland, ohne eine zwischengeschaltete Verwendung in einem heimischen Produktionsprozess. Reexporte betreffen hauptsächlich Sachgüter. Bei Dienstleistungen treten Reexporte nur im Ausnahmefall, bei einzelnen konzeptbedingten Verbuchungskonventionen auf. Im Jahr 1995 belief sich der Reexportanteil auf 3,2%, im Jahr 2016 lag er schon bei 13,2%.
Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft auf ausländische Greenfield-Direktinvestitionen
Elisabeth Christen, Martin Falk 92
Wissenschaftliche Begutachtung: Erwin Kolleritsch, Statistik Austria; Patricia Walter, OeNB
Empirische Studien zeigen, dass die EU-Mitgliedschaft und die Schaffung des Europäischen Binnenmarktes 1992 zu einer höheren Direktinvestitionstätigkeit führten. Theoretisch ist es möglich, dass die Auswirkungen der wirtschaftlichen Integration auf die ausländischen Direktinvestitionen (foreign direct investment, FDI) mit zunehmender Zahl an EU-Mitgliedstaaten im Lauf der Zeit nachlassen. In dieser Arbeit werden die Auswirkungen des EU-Beitritts auf die Greenfield-Direktinvestitionen untersucht. Dabei wird nach Sektoren (Dienstleistungen und Sachgütererzeugung) unterschieden, und es werden die unterschiedlichen Herkunftsländer berücksichtigt. Die Auswirkungen werden anhand eines FDI-Gravitationsmodells geschätzt, das Informationen über 200.000 Direktinvestitionsprojekte im Zeitraum von 2003 bis 2018 enthält. Die Ergebnisse zeigen, dass die Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft auf die Greenfield-Direktinvestitionen für Bulgarien und Rumänien groß und signifikant sind, jedoch nicht signifikant für Kroatien. Die Anzahl der angekündigten Greenfield-Direktinvestitionsprojekte österreichischer multinationaler Unternehmen in Bulgarien und Rumänien stieg in den ersten drei Jahren nach dem Beitritt um durchschnittlich 180%, die Zahl der dadurch geschaffenen Arbeitsplätze um 140%. Die größten Effekte waren bereits im Jahr vor dem Beitritt zu beobachten gewesen. Investitionen aus den Nicht-EU-Ländern sind nach dem EU-Beitritt weniger stark angestiegen. Die Ergebnisse unterscheiden sich nicht wesentlich für den Dienstleistungssektor und die Sachgütererzeugung.
JEL classification: F21
Keywords: Greenfield FDI, EU accession, gravity model
Theoretische Überlegungen legen nahe, dass regionale Wirtschaftsintegrationsabkommen durch präferenzielle Handelsregelungen, EU-Mitgliedschaft und Währungsintegration – sowohl für die teilnehmenden Länder als auch für die Drittländer – zu einer Erhöhung der ausländischen Direktinvestitionen (foreign direct investment, FDI) führen. Die empirische Literatur zeigt, dass die europäische Wirtschaftsintegration (d. h. die Einheitliche Europäische Akte von 1987, die Schaffung des Europäischen Binnenmarktes 1992 und die Erweiterung der EU in den Jahren 1995, 2004 und 2007) sowohl mit einem Anstieg der innergemeinschaftlichen FDI als auch erhöhten FDI-Strömen aus Drittländern einherging (Brenton et al., 1999; Baltagi et al.,2008; Bevan und Estrin, 2004; Straathof et al., 2008; Narula und Bellak, 2009). Straathof et al. (2008) kommen unter Verwendung eines Gravitationsmodells zu dem Ergebnis, dass die EU-Mitgliedschaft die Direktinvestitionsbestände aus Nicht-EU-Ländern um 14% und aus anderen EU-Mitgliedstaaten um 28% erhöht.
Die Brexit-Abstimmung im Jahr 2016 hat die Debatte über die Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft auf Außenhandel und Direktinvestitionen (DI) neu belebt. Bruno et al. (2016) zeigen, dass sich die EU-Mitgliedschaft statistisch signifikant positiv auf die ausländischen Direktinvestitionen auswirkt. Die Größenordnung des Anstiegs der FDI reicht 14 bis 38%, je nach genauer statistischer Methode. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Campos und Coricelli (2015), welche einen Einfluss von 25 bis 30% auf die Direktinvestitionsströme durch die EU-Mitgliedschaft feststellen, indem sie die Entwicklung der Direktinvestitionen des Vereinigten Königreichs mit einer Reihe übereinstimmender Länder als Referenzgruppe vergleichen.
Die hier zitierten Studien basieren alle auf den gesamten Direktinvestitionen, ohne zwischen Fusionen und Übernahmen sowie Greenfield-Investitionen zu unterscheiden. Diese beiden Investitionsarten weisen jedoch deutliche Unterschiede auf (Kasten 1).
Abgrenzung von Greenfield-Direktinvestitionen
Ausländische Direktinvestitionen können in Form von Investitionen „auf der grünen Wiese“ oder von grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen (mergers and acquisitions, M&A) getätigt werden. Bei Greenfield-Direktinvestitionen handelt es sich um die Gründung eines völlig neuen Unternehmens oder die Erweiterung einer bestehenden ausländischen Tochtergesellschaft, während grenzüberschreitende M&A eine Änderung der Eigentumsverhältnisse an einem bestehenden Unternehmen bedeuten. UNCTAD (2000) legt nahe, dass Investitionen „auf der grünen Wiese“ für das Zielland günstiger sind als grenzüberschreitende M&A, da sie den Kapitalstock und damit die Produktionskapazität erhöhen; bei grenzüberschreitenden M&A bleiben hingegen Kapitalstock und Produktionskapazität (zumindest kurzfristig) unverändert. Tatsächlich zeigen neuere empirische Studien, dass ein Markteintritt „auf der grünen Wiese“ einen relativ größeren positiven Effekt auf die Unternehmens- oder makroökonomische Performance im Zielland hat als andere Eintrittsmodelle (Wang und Wong, 2009).
Die vorliegende Studie nimmt eine erste Bewertung der Auswirkungen des EU-Beitritts Kroatiens im Vergleich zu anderen EU-Beitrittsländern auf die ausländischen Direktinvestitionen vor. Zu diesem Zweck wird ein FDI-Gravitationsmodell für Greenfield-Direktinvestitionen aus 30 EU/OECD-Herkunftsländern in 50 Zielländer geschätzt. Die Literatur über die Determinanten von ausländischen Direktinvestitionen auf Basis von Gravitationsgleichungen ist umfangreich (Chakrabarti, 2001; Fratianni et al., 2011; Zwinkels und Beugelsdijk, 2010). Neuere Studien, die FDI-Determinanten für EU-Länder untersuchen, wurden von Wolff (2007) und Bénassy-Quéré et al. (2007) durchgeführt. Allerdings haben nur wenige Studien die Determinanten von Greenfield-Direktinvestitionen untersucht.
2 Entwicklung der österreichischen Direktinvestitionen
Die Ostöffnung, der EU-Beitritt Österreichs 1995 sowie die EU-Erweiterungsrunden nach 2004 führten zu einem enormen Internationalisierungsschub der österreichischen Wirtschaft. Österreich nutzte allerdings nicht nur im Außenhandel die Chancen der europäischen Integrationsschritte, sondern wurde auch als Standort für neue Investitionen und regionale Headquarter attraktiver. Zudem haben gerade die Länder Mittel- und Osteuropas aufgrund niedriger Löhne, aber auch ihres hohen Wachstums- und damit Nachfragepotenzials, neue Möglichkeiten für österreichische Unternehmen und Investitionen eröffnet. Insgesamt ist der Direktinvestitionsbestand Österreichs im Ausland von nur rund 2% des BIP (Direktinvestitionen-Bestandsquote) Anfang der 1990er-Jahre und rund 5% im Beitrittsjahr 1995 auf knapp 53% bis 2018 angestiegen. Seit dem EU-Beitritt Österreichs legten die aktiven Direktinvestitionsbestände durchschnittlich um ca. 14,7% pro Jahr zu. Im Vergleich dazu nahmen ausländische Direktinvestitionen in Österreich von nur rund 6% des BIP Anfang der 1990er-Jahre und rund 9% im Beitrittsjahr auf knapp 46% bis 2018 zu und wuchsen damit seit 1995 durchschnittlich um rund 11,1% pro Jahr. Bis zur Krise 2008 ist der ausländische Direktinvestitionsbestand in Österreich stets stärker gewachsen als die heimischen Investitionen im Ausland. In Folge der EU-Erweiterungsrunden hat sich die Position Österreichs allerdings erstmals 2003 und seit 2008 nachhaltig gedreht.
Aufgrund der geographischen Nähe und der historisch gewachsenen wirtschaftlichen Verflechtungen haben die EU-Erweiterungen ab 2004 (Grafik 1) einen wichtigen Beitrag zu einem außerordentlich dynamischen Aufholprozess der Internationalisierung Österreichs über ausländische Direktinvestitionen geleistet. Der Bestand österreichischer Direktinvestitionen in den Beitrittsländern lag im Jahr 1989 erst bei 0,1 Mrd EUR, erhöhte sich bis zur EU-Erweiterung 2004 auf 18,9 Mrd EUR und hat sich seither mit 51,6 Mrd EUR im Jahr 2018 fast verdreifacht. Dies entspricht einem Anstieg der DI-Bestandsquote von rund 8% im Beitrittsjahr auf 13% im Jahr 2018. Das wichtigste Zielland für österreichische Direktinvestitionen unter den EU-Erweiterungsländer ist 2018 eindeutig Tschechien (Anteil am Gesamtbestand von 6,4%) gefolgt von Rumänien (4,4%), Ungarn und der Slowakei mit jeweils rund 3%. Zudem zählt Österreich in vielen Beitritts- und (potenziellen) Kandidatenländern noch heute zu den wichtigsten Herkunftsländern ausländischer Direktinvestitionen, insbesondere in Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina (Rang 1) sowie in Bulgarien (Rang 2) und Rumänien, der Slowakei und Ungarn (Rang 3). Österreichische Investoren profitierten dabei überdurchschnittlich von ihren Projekten in der mittel- und osteuropäischen EU-Region. Die aus Investitionen in den Beitrittsländern generierten Einkommen überstiegen ausnahmslos die Einkommen aus Investitionen in den EU-15-Ländern. Während etwa 2018 46,1% des österreichischen FDI-Bestandes auf die EU-15 entfielen, stammten nur 27,5% der Einkommen aus diesen EU-15-Investitionen. Für die Beitrittsländer stand einem Anteil von 25,4% am Gesamtbestand, ein Anteil am Einkommen von 29,2% gegenüber, was die hohe Profitabilität der österreichischen FDI in diesen Ländern zeigt.
3 Empirisches Modell
Der Hauptbeitrag der vorliegenden Arbeit liegt in der detaillierten empirischen Analyse der Effekte der EU-Mitgliedschaft auf die Greenfield-Direktinvestitionen. Das grundlegende FDI-Gravitationsmodell wird um Unternehmensteuern im Zielland, dem Pro-Kopf-BIP sowie dem Wirtschaftswachstum im Herkunfts- und im Zielland ergänzt. Die FDI-Gravitationsgleichung wird mit Hilfe eines Zähldatenmodells mit bilateralen Effekten geschätzt. Diese Schätzmethode berücksichtigt, dass für einige Herkunfts- bzw. Zielländer keine Direktinvestitionen verzeichnet werden.
Die empirische Literatur zu den Bestimmungsfaktoren der bilateralen FDI-Ströme und -Bestände mit Hilfe von Gravitationsmodellen ist umfangreich (Blonigen und Piger, 2011 und Faeth, 2009 für aktuelle Literaturübersichten). Blonigen und Piger (2011) zeigen, dass die traditionellen Gravitationsfaktoren zu den robustesten Determinanten der FDI-Ströme und -Bestände gehören. Fast alle Studien, die sich auf Daten für EU/OECD-Länder stützen, zeigen, dass die bilateralen FDI-Ströme und -Bestände mit der Entfernung zwischen dem jeweiligen Herkunfts- und Zielland abnehmen und mit dem BIP des Herkunfts- und Ziellandes zunehmen. Dies zeigt, dass die DI-Aktivitäten zwischen großen Ländern (gemessen am BIP) höher sind, die Höhe der DI-Aktivitäten jedoch mit der geografischen Entfernung zwischen Herkunfts- und Zielland abnimmt. In der vorliegenden Spezifikation werden Paneldaten mit bilateralen (fixen) Effekten verwendet, die automatisch die mögliche Rolle der Entfernung berücksichtigen. Es wird ebenfalls unterstellt, dass Faktoren wie Arbeitskosten und andere kostenbasierte Faktoren, Unternehmens- und Lohnsteuern, Qualifikationen, technologische Infrastruktur und FDI-Regulierungen durch bilaterale fixe Effekte abgebildet werden können. Die Determinanten der Greenfield-Direktinvestitionen werden wie folgt spezifiziert:
wobei i das Herkunftsland, j das Zielland und ln() der natürliche Logarithmus ist. Die Variablen sind wie folgt definiert:
FDIijt Anzahl der geplanten Greenfield-DI-Projekte (alternativ die dadurch geschaffenen Arbeitsplätze) im Zielland j aus dem Herkunftsland i in einem bestimmten Jahr t; BIPKOPFHOMEit und BIPKOPFHOSTjt sind das jeweilige BIP pro Kopf in konstanten Preisen des Herkunfts- und Ziellandes in der jeweiligen Landeswährung; CORPTAXHOSTjt–1 sind die durchschnittlichen Steuersätze für den Nicht-Finanzsektor im Zielland; EUHOMEit–z nimmt den Wert 1 an, wenn das Herkunftsland ein EU-Mitgliedstaat ist; EUNEUDESTjt–z nimmt den Wert 1 an, wenn das Zielland der EU beigetreten ist (z. B. Bulgarien und Rumänien im Jahr 2007, Kroatien 2013), ansonsten 0. Der Koeffizient β6z kann als Difference-in-Difference-Effekt interpretiert werden. In diesem Modell sind verzögerte Effekte inkludiert und auch der Effekt ein Jahr vor dem Beitritt wird abgebildet, der einen möglichen Vorzieheffekt widerspiegeln soll.
Die Anzahl der Direktinvestitionsprojekte ist eine Zählvariable. In 40% der Beobachtungen sind keine Direktinvestitionsprojekte zu beobachten. Es ist bekannt, dass bei Vorliegen einer Vielzahl von Nullbeobachtungen die gepoolten OLS- oder Fixed-Effects-Schätzungen verzerrt sind. Santos Silva und Tenreyro (2006, 2011) schlagen eine Zähldaten-Schätzmethode (Poisson-Pseudo-Maximal-Likelihood-Schätzer) vor, welche mit dem hohen Anteil von Nullwerten bei der abhängigen Variablen umgehen kann. Zusätzlich werden clusterrobuste Standardfehler nach Herkunftsländer-Zielländer-Paaren verwendet. 93
4 Daten und deskriptive Evidenz
Die Informationen über Greenfield-Investitionen stammen aus der fDi Markets Datenbank, welche Informationen über rund 200.000 Investitionsprojekte weltweit für den Zeitraum von 2003 bis 2018 enthält. Die Projektinformationen in der Datenbank basieren auf Medienquellen. Die Daten zu Greenfield-Direktinvestitionen sind teilweise geschätzt und können als Investitionsabsichten interpretiert werden. Sie haben gegenüber den offiziellen Direktinvestitionen Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist, dass sie weniger von Round-Tripping-Aktivitäten 94 zwischen verschiedenen Zielregionen betroffen sind. Ein Nachteil ist, dass die geschaffenen Arbeitsplätze nur grobe Schätzwerte sind. Die offiziellen Direktinvestitionsdaten werden in der Literatur zunehmend kritisch gesehen. Beugelsdijk et al. (2010) argumentieren, dass die FDI-Bestände ein verzerrtes Maß für die Aktivität multinationaler Unternehmen sind, wobei der Grad der Über- oder Unterschätzung der FDI-Aktivität von den Merkmalen des Ziellandes abhängt. Neben den durch Steuersparmodellen motivierten Direktinvestitionen kritisieren die Autoren auch, dass gerade in entwickelten Finanzmärkten, wie in den OECD-Ländern, Investitionen durch lokal beschaffte externe Mittel finanziert werden, welche nicht in den FDI enthalten sind.
Die fDi Markets Datenbank wird von der UNCTAD für ihren World Investment Report verwendet und ist auch in der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur weit verbreitet (Hahn et al., 2011; Wang und Wong, 2009). Das BIP pro Kopf stammt aus der World-Development-Indicators-Datenbank, der Körperschaftssteuersatz aus der OECD-Datenbank, ergänzt durch die KPMG-Datenbank.
Die einzelnen FDI-Projektdaten werden nach Herkunfts- und Zielland aggregiert. Der endgültige Datensatz besteht aus bilateralen Greenfield-Direktinvestitionen aus 30 Herkunftsländern 95 in 52 Zielländern 96 (darunter die EU-Mitgliedstaaten sowie die restlichen Industrieländer) für den Zeitraum von 2004 bis 2018. Für die Gravitationsgleichung beträgt die Gesamtzahl der möglichen Kombinationen 21.840 (14 Jahre x 30 Herkunftsländer x 52 Zielländer).
Die Tabellen 1 und 2 zeigen die Entwicklung der Greenfield-Direktinvestitionen in den drei untersuchten neuen EU-Mitgliedstaaten. Während sich die Greenfield-DI in Rumänien und Bulgarien bereits ein Jahr vor dem Beitritt dynamisch entwickelt hatten, ist dies bei Kroatien nicht der Fall gewesen.
5 Resultate
Tabelle 3 zeigt die Koeffizienten der Panel-Poisson-Schätzung der Determinanten der bilateralen Greenfield-Direktinvestitionen. Neben der Anzahl der Greenfield-Direktinvestitionen werden auch die durch diese Projekte geschaffenen Arbeitsplätze untersucht. Die Schätzungen werden für drei verschiedene Gruppen von Herkunftsländern vorgenommen: Österreich, EU-Länder und Nicht-EU-Länder. Dummy-Paare des Herkunfts- und Ziellandes und die Zeitdummy-Variablen sind jeweils gemeinsam signifikant, werden aber in der Tabelle nicht aufgeführt.
Die Schätzergebnisse zeigen, dass die EU-Mitgliedschaft von Bulgarien und Rumänien im Jahr 2007 zu einem starken Anstieg der Greenfield-Direktinvestitionen zwischen den neuen und den bestehenden EU-Mitgliedstaaten führte. Dies gilt insbesondere für Investitionen aus Österreich in Bulgarien und Rumänien sowie auch für jene aus EU-Ländern; für jene aus Nicht-EU-Ländern jedoch in geringerem Maße. Bemerkenswert ist, dass die Effekte bereits ein Jahr vor dem EU-Beitritt eingetreten waren und mehrere Jahre anhielten. Im Durchschnitt der ersten drei Jahre nach dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens ist die Anzahl der Greenfield-Direktinvestitionsprojekte von österreichischen multinationalen Unternehmen um 180% gestiegen, im Jahr des Beitritts um 280% (berechnet als ((exp(X)-1)) *100).
Wenn alle EU-Herkunftsländer betrachtet werden, liegt die Größenordnung des Effekts im Durchschnitt bei ca. 50% pro Jahr. Die Zunahme der Greenfield-Direktinvestitionen nach dem EU-Betritt fällt geringer aus, wenn nur die Nicht-EU-Ländern betrachtet werden (+16% im Durchschnitt pro Jahr). Tendenziell nimmt der Direktinvestitionseffekt im Zeitverlauf nach der EU-Mitgliedschaft ab. Bei österreichischen Greenfield-Direktinvestitionen ist jedoch der Effekt auch nach drei Jahren immer noch signifikant auf dem 5-Prozent-Niveau. Das Ausmaß der Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft Bulgariens und Rumäniens auf die Greenfield-Direktinvestitionen ist deutlich höher als in den Studien, die die gesamten Direktinvestitionen (Bestände und Zuflüsse) betrachten (Bruno et al., 2016).
Für Kroatien kann in den meisten Fällen nach dem EU-Beitritt keine Intensivierung der bilateralen Greenfield-Direktinvestitionen nachgewiesen werden. Eine Ausnahme ist das Jahr 2012, als die Anzahl der Greenfield-Direktinvestitionsprojekte österreichischer multinationaler Unternehmen signifikant stieg. Allerdings spiegelte sich das nicht in einer Zunahme der Arbeitsplätze wider (T-stat von 0,72). In den darauffolgenden Jahren waren sogar negative Effekte beobachtbar.
| Österreich | EU-Länder | Nicht-EU-Länder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeffizient | z-Stat | Koeffizient | z-Stat | Koeffizient | z-Stat | |
| Anzahl der Greenfield-FDI-Projekte | ||||||
| BG_RO 2006 | 1,35*** | 5,79 | 0,84*** | 6,68 | 0,73*** | 4,23 |
| BG_RO 2007 | 1,18*** | 6,93 | 0,58*** | 4,61 | 0,10 | 0,65 |
| BG_RO 2008 | 0,87*** | 3,43 | 0,33** | 2,56 | 0,44** | 2,35 |
| BG_RO 2009 | 1,06*** | 5,09 | 0,26* | 1,92 | –0,21 | –1,24 |
| HR 2012 | 0,64*** | 3,99 | 0,06 | 0,23 | –0,26 | –0,90 |
| HR 2013 | –0,30* | –1,79 | –0,30 | –1,66 | 0,00 | 0,00 |
| HR 2014 | –0,53** | –2,46 | 0,01 | 0,02 | –0,05 | –0,20 |
| HR 2015 | –0,44 | –1,60 | 0,19 | 0,54 | –0,07 | –0,34 |
| Zeitdummy-Variable Wald test (p) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Kontrollvariable Wald test (p) | 0,14 | 0,00 | 0,00 | |||
| Anzahl der Beobachtungen | 594 | 6.666 | 7..034 | |||
| Anzahl der Herkunfts-Zielländerpaare | 44 | 672 | 502 | |||
| Log pseudolikelihood | –945 | –14.568 | –11.172 | |||
| Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze durch die Greenfield–FDI–Projekte | ||||||
| BG_RO 2006 | 0,87*** | 2,65 | 1,09*** | 5,48 | 1,25*** | 3,99 |
| BG_RO 2007 | 0,96** | 2,28 | 0,76*** | 3,48 | 0,84** | 2,31 |
| BG_RO 2008 | 0,89*** | 2,59 | 0,81*** | 3,06 | 1,01** | 2,32 |
| BG_RO 2009 | 0,81*** | 4,44 | –0,07 | –0,33 | –0,03 | –0,11 |
| HR 2012 | –0,24 | –0,91 | –0,70* | –1,76 | –1,00** | –2,43 |
| HR 2013 | –1,43*** | –4,30 | –1,02** | –2,49 | –0,73 | –1,48 |
| HR 2014 | –0,49 | –1,65 | –0,15 | –0,26 | –0,84* | –1,70 |
| HR 2015 | –1,58*** | –3,74 | –0,50 | –0,88 | –1,32*** | –3,89 |
| Zeitdummy-Variable Wald test (p) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Kontrollvariable Wald test (p) | 0,14 | 0,00 | 0,00 | |||
| Anzahl der Beobachtungen | 594 | 6.666 | 7034 | |||
| Anzahl der Herkunfts-Zielländerpaare | 44 | 672 | 502 | |||
| Log pseudolikelihood | –106.250 | –1.713.492 | –1.594.669 | |||
| Quelle: fDi Markets, WIFO-Berechnungen. | ||||||
| Anmerkungen: Die abhängige Variable ist die Anzahl der Greenfield-FDI-Projekte (obere Hälfte) und die Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze durch die Greenfield-FDI-Projekte (untere Hälfte). ***, ** und * bezeichnen die statistische Signifikanz bei 1%, 5% bzw. 10%, Standardfehler werden nach Herkunftsländer-Zielländer-Paaren geclustert. | ||||||
Es werden auch separate Schätzungen für die Sachgütererzeugung und die Dienstleistungen vorgenommen. Die positiven Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft lassen sich für diese beiden Sektoren nachweisen, sind aber stärker für Dienstleistungen (Tabelle A1). Es wurden mehrere Robustheitsanalysen durchgeführt. Dies betrifft in erster Linie die vorauseilende Wirkung des EU-Beitritts. Bei den Greenfield-Direktinvestitionsdaten handelt es sich um geplante Investitionsprojekte, die allerdings noch nicht realisiert wurden. Die zeitliche Zuordnung ist daher mit Vorsicht zu interpretieren. Geplante Investitionsprojekte werden oft mit Verzögerung umgesetzt. Um dem Rechnung zu tragen, werden die Vorzieheffekte zwei Jahre vor dem EU-Beitritt modelliert (BG_RO 2006 und BG_RO 2005 statt BG_RO 2006 bzw. HR 2011 und HR 2012 statt HR 2012). Die Ergebnisse zeigen, dass es signifikante Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft bereits im Jahr 2005 gibt und auch für 2011 bei österreichischen Greenfield-Direktinvestitionen in Kroatien. 97 Es ist jedoch durchaus möglich, dass die geplanten Direktinvestitionen erst im nächsten Jahr realisiert werden. Somit kann die Frage nach Vorzieheffekten durch die EU-Mitgliedschaft mit den vorliegenden Greenfield-Direktinvestitionsdaten nicht vollständig beantwortet werden. Zudem wurden die Regressionsmodelle auch mit Daten zu Direktinvestitionszuflüssen geschätzt. 98 Die Ergebnisse unterscheiden sich nicht wesentlich von den beiden anderen Indikatoren (Anzahl der Greenfield-Projekte sowie Anzahl der Arbeitsplätze) 99 .
6 Schlussfolgerungen
Dieser Artikel untersuchte den Einfluss der EU-Mitgliedschaft von Bulgarien und Rumänien sowie Kroatien auf bilaterale Greenfield-Investitionen aus EU/OECD-Ländern. Die Ergebnisse, basierend auf einem Poisson-Modell mit bilateralen Effekten, zeigen, dass die EU-Mitgliedschaft von Bulgarien und Rumänien im Jahr 2007 zu einem starken Anstieg der Greenfield-Direktinvestitionen zwischen den neuen und den bestehenden EU-Mitgliedstaaten führte. Dies gilt insbesondere für die Greenfield-Direktinvestitionen von Österreich in Rumänien und Bulgarien, aber auch von allen anderen EU-Herkunftsländern. Ebenso nahmen die Direktinvestitionen von Nicht-EU-Ländern in den beiden neuen EU-Mitgliedstaaten zu, wenn auch in geringerem Maße als jene aus den EU-Ländern. Die Effekte waren bereits ein Jahr vor dem Beitritt aufgetreten und hielten mehrere Jahre an. Für Kroatien kann keine Intensivierung der bilateralen Direktinvestitionstätigkeit nachgewiesen werden. Dies könnte auf eine Abschwächung der Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft auf die Greenfield-Direktinvestitionen mit zunehmender Anzahl an EU-Mitgliedstaaten hindeuten. Eine andere Erklärung könnte mit den Merkmalen des Ziellandes zusammenhängen. Die Frage ist nicht leicht zu beantworten und muss für beide Erweiterungsrunden und die neue Mitgliedsländer getrennt betrachtet werden. Ein möglicher Grund für die starke Zunahme der DI-Aktivitäten zwischen den EU-Ländern und Bulgarien und Rumänien war, dass diese beiden Länder zum Zeitpunkt des Beitritts die niedrigsten Mindestlöhne in der EU hatten, die sogar niedriger waren als in Serbien (Europäischen Kommission, verschiedene Jahre). Ein anderer Faktor war sicherlich die strategische geographische Lage am Schwarzen Meer in einer Region, die zu dieser Zeit zusammen mit der Ukraine und der Türkei als neue Wachstumsregion angesehen wurde. Kroatien hingegen war durch seine Kriegsvergangenheit und durch die kurze Entfernung zu Österreich und den meisten EU-Ländern gekennzeichnet, was den direkten Export von Waren und Dienstleistungen ermöglicht, und günstiger sein könnte als die Belieferung durch eine lokale Produktionsstätte. Zudem verlief auch die wirtschaftliche Entwicklung in Bulgarien und Rumänien weitaus dynamischer als in Kroatien. Sowohl vor und nach der Finanz- und Wirtschaftskrise als auch rund um den EU-Beitritt 2013 lag die Konjunkturdynamik in Kroatien um rund 2 Prozentpunkten hinter jener der Erweiterungsländer von 2007.
Ob diese Ergebnisse auf künftige EU-Mitglieder übertragbar sind, kann noch nicht abschließend beurteilt werden. Offen ist noch, ob sich diese Effekte auch für die Direktinvestitionen insgesamt oder für anderen Kennzahlen der Direktinvestitionen (z. B. Beschäftigung in Tochtergesellschaften) nachweisen lassen. In zukünftigen Arbeiten könnte das Gravitationsmodell um zusätzliche Erklärungsfaktoren (Lohnkosten, Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften, Standortfaktoren) erweitert werden oder die Schätzung für verschiedene Teilsektoren durchgeführt werden. Die Anzahl der Greenfield-Direktinvestitionsprojekte in Kroatien ist jedoch sehr gering, sodass eine weitere Differenzierung nicht sehr sinnvoll ist.
Literatur
Baltagi, B.H., P. Egger und M. Pfaffermayr. 2008. Estimating Regional Trade Agreement Effects on FDI in an Interdependent World. In: Journal of Econometrics 145(1–2). 194–208.
Bénassy–Quéré, A., N. Gobalraja und A. Trannoy. 2007. Tax and public input competition. In: Economic Policy 19. 385–430.
Beugelsdijk, S., J. F. Hennart, A. Slangen and R. Smeets (2010). Why and how FDI stocks are a biased measure of MNE affiliate activity. In: Journal of International Business Studies, 41(9), 1444-1459.
Bevan, A. und S. Estrin. 2004. The determinants of foreign direct investment into European transition economies. In: Journal of Comparative Economics 32. 775–787.
Blonigen, B.A. und J. Piger. 2011. Determinants of Foreign Direct Investment, NBER Working Papers 16704. National Bureau of Economic Research.
Borga, M. (2016). Vital statistics: Taking the real pulse of foreign direct investment. OECD, Paris. In Love, P. (ed.): Debate the Issues: Investment, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264242661-19-en.
Brenton, P., F. Di Mauro und M. Lücke. 1999. Economic integration and FDI: An empirical analysis of foreign investment in the EU and in Central and Eastern Europe. In: Empirica. 26(2). 95121.
Bruno, R., N. Campos, S. Estrin und M. Tian. 2016. Gravitating towards Europe: an econometric analysis of the FDI effects of EU membership. CEP technical paper, Brexit analysis 3.
Campos, N. und F. Coricelli. 2015. Some Unpleasant Brexit Econometrics. VoxEU.org (http://www.voxeu.org/article/some-unpleasant-brexit-econometrics).
Chakrabarti, A. 2001. The determinants of foreign direct investments: sensitivity analyses of cross-country regressions. In: Kyklos 54(1). 89–114.
Europäische Kommission. Mindestlöhne 2004-2015, https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/gicNh24uVRaqMknQjI7s6Q.
Faeth, I. 2009. Determinants of foreign direct investment – A tale of nine theoretical models. In: Journal of Economic Surveys 23. 165-196.
Fratianni, M, F. Marchionne und C.H. Oh. 2011. Commentary on the gravity equation in international business. In: Multinational Business Review. 19. 36–46.
Hahn, E.D., K. Bunyaratavej und J.P. Doh. 2011. Impacts of risk and service type on nearshore and offshore investment location decisions: An empirical approach. In: Management International Review 51(3). 357–380.
Narula, R. und C. Bellak. 2009. EU enlargement and consequences for FDI-assisted industrial development. In: Transnational Corporations 18(2). 69-89.
Santos Silva, J.M.C. und S. Tenreyro. 2006. The log of gravity. In: The Review of Economics and Statistics 88. 641–658.
Santos Silva, J.M.C. und S. Tenreyro. 2011. Further Simulation Evidence on the Performance of the Poisson Pseudo-Maximum Likelihood Estimator. In: Economics Letters 112(2). 220–222.
Straathof, S., G-J. Linders, A. Lejour und J. Mohlmann. 2008. The Internal Market and the Dutch Economy: Implications for Trade and Economic Growth. CPG Netherlands Document 168.
UNCTAD. 2000. World Investment Report 2000: Cross-Border Mergers and Acquisitions and Development. United Nations, New York and Geneva.
Wang M. und M.C.S. Wong. 2009. What Drives Economic Growth? The Case of Cross-Border M&A and Greenfield FDI Activities. In: Kyklos 62(2). 316–330.
Wolff, G.B. 2007. Foreign Direct Investment in the Enlarged EU: Do Taxes Matter and to What Extent? In: Open Economies Review 18. 327–346.
Zwinkels, R.C.J. und S. Beugelsdijk. 2010. Gravity Equations: Workhorse or Trojan Horse In Explaining Trade and FDI Patterns Across Time and Space? In: International Business Review 19(1). 482–497.
Anhang
| Österreich | EU-Länder | Nicht-EU-Länder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeffizient | z-Stat | Koeffizient | z-Stat | Koeffizient | z-Stat | |
| BG_RO 2006 | 1,25*** | 5,36 | 0,84*** | 5,06 | 0,81*** | 4,22 |
| BG_RO 2007 | 1,17*** | 5,18 | 0,51*** | 3,13 | 0,04 | 0,21 |
| BG_RO 2008 | 1,00*** | 2,97 | 0,25 | 1,48 | 0,46* | 1,94 |
| BG_RO 2009 | 0,91*** | 3,69 | 0,29** | 2,10 | –0,31 | –1,56 |
| HR 2012 | 0,60*** | 3,72 | 0,04 | 0,12 | –0,10 | –0,37 |
| HR 2013 | –0,20*** | –1,13 | –0,23 | –1,21 | –0,17 | –0,43 |
| HR 2014 | –1,09*** | –4,03 | –0,07 | –0,19 | 0,11 | 0,39 |
| HR 2015 | –0,41*** | –1,33 | 0,30 | 0,79 | –0,06 | –0,31 |
| Zeitdummy-Variable Wald test (p) | 0,11 | 0,00 | 0,00 | |||
| Kontrollvariable Wald test (p) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |||
| Anzahl der Beobachtungen | 594 | 6.666 | 6.936 | |||
| Anzahl der Herkunfts-Zielländerpaare | 44 | 672 | 494 | |||
| Log pseudolikelihood | –846 | –14.568 | –10.117 | |||
| Quelle: fDi Markets, WIFO-Berechnungen. | ||||||
| Anmerkungen: Die abhängige Variable ist die Anzahl der Greenfield-FDI-Projekte. ***, ** und * bezeichnen die statistische Signifikanz bei 1%, 5% bzw. 10%, Standardfehler werden nach Herkunftsländer-Zielländer-Paaren geclustert. | ||||||
92 Wifo, elisabeth.christen@wifo.ac.at, martin.falk@wifo.ac.at.
93 In Bezug auf die ökonometrische Schätzung der beobachteten Investitionen stellen Poisson-Regressionsmodelle den führenden Ansatz für Zähldaten dar. Solche Modelle werden mit Hilfe von Quasi-Maximum-Likelihood (QML)-Methoden geschätzt. Zu den Hauptvorteilen dieses Ansatzes gegenüber dem zuvor angewandten logarithmisch-linearen Modellierungsrahmen gehört die Möglichkeit, Null-Ströme zu berücksichtigen und mit der beobachteten Heteroskedastizität in den Fehlertermen der bilateralen DI-Gravitationsgleichungen umzugehen (Santos Silva und Tenreyro, 2006).
94 Round-Tripping tritt auf, wenn Unternehmen über eine Holdinggesellschaft oder eine Tochtergesellschaft mit Sitz in einem Drittland im Ausland investieren. Die Gründe dafür sind vielfältig, wie z.B. Steuerersparnis, Doppelbesteuerung, bilaterale Investitionsabkommen oder sie widerspiegeln individuelle Strategien der Unternehmen (Borga, 2016). Round-Tripping Aktivitäten betrifft auch EU-Länder. So zählt Zypern zu den drei größten Herkunftsländern für Direktinvestitionen in manchen Zielländern.
95 Zu den Herkunftsländern zählen Australien, Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Indien, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, die Schweiz, Spanien, Südkorea, Tschechien, die Türkei, die USA, die Vereinigten Arabischen Emirate und das Vereinigte Königreich.
96 Zu den Zielländern zählen Albanien, Australien, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Moldawien, Montenegro, die Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, die Schweiz, Serbien, Singapur, die Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Taiwan, Tschechien, die Türkei, die Ukraine, Ungarn, die USA, das Vereinigte Königreich, Weißrussland und Zypern.
97 Die Ergebnisse werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
98 Zwischen Greenfield-Investitionen und Direktinvestitionszuflüssen in den drei betrachteten Ländern besteht eine sehr hohe Korrelation. Für Bulgarien und Rumänien weisen die Daten eine Korrelation von mehr als 75% auf, lediglich in Kroatien ist die Korrelation mit rund 30% etwas niedriger.
99 Die Ergebnisse werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
Die Expansion der österreichischen Banken nach Zentral-, Ost- und Südosteuropa 100
Meilensteine der Expansion – Rückblick und Ausblick
Stefan Kavan, Tina Wittenberger
101
Wissenschaftlicher Begutachter: Ernest Gnan, OeNB
Die großen österreichischen Banken erkannten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs früh die Chance, den margenschwachen Heimatmarkt nach Zentral-, Ost- und Südosteuropa (CESEE) zu erweitern. Bankneugründungen und -zukäufe erlaubten rasch in dieser Region fußzufassen und die Aussicht auf mögliche EU-Beitritte von CESEE-Ländern löste eine Reform- und Aufbruchstimmung aus. Die dynamische Kreditvergabe brachte hohe Gewinne mit sich, aber die schnelle Expansion hatte auch Schattenseiten. So erfolgte die Kreditvergabe oftmals in Fremdwährungen und wurde durch die Mutterbank refinanziert. Die aufgebauten Risiken wurden während der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise schlagend und führten zu hohen Kosten. Bei den Banken folgte eine Phase der Konsolidierung. Makroprudenzielle Maßnahmen zur Hintanhaltung von Risiken für die Finanzmarktstabilität waren eine wichtige Lehre aus der Krise, die auch in Österreich von der Bankenaufsicht gezogen wurde. Das in den letzten Jahren erneut einsetzende Wirtschaftswachstum verbesserte die Zahlungsfähigkeit der Kunden. Die gute Ertragslage ist aber auch dem wieder anziehenden Kreditwachstum geschuldet, das erneut systemische Herausforderungen mit sich bringt und makroprudenzielle Maßnahmen in einigen CESEE-Ländern notwendig machte. Der wirtschaftliche Aufholprozess im erweiterten Heimatmarkt österreichischer Banken bietet weiterhin ein beachtliches Wachstums- und Ertragspotenzial und die momentane Gewinnsituation und Qualität des Kreditportfolios sind gut. Allerdings bringen der vom Kreditwachstum getriebene lange Aufschwung und die einsetzende wirtschaftliche Abschwächung auch zahlreiche Herausforderungen mit sich, denen sich die betroffenen Banken und die Bankenaufsicht stellen müssen.
JEL classification: F36, G01, G21, G28, N24, N44, O16
Keywords: österreichische Banken, CESEE, CEE, EU-Osterweiterung, Finanzkrise, notleidende Kredite, makroprudenzielle Politik, Fremdwährungskredite, Liquiditätstransfers, Vienna Initiative, Systemrisikopuffer
Die österreichischen Banken erkannten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs früh die historische Chance, ihren margenschwachen Heimatmarkt nach Zentral-, Ost- und Südosteuropa (CESEE) 102 zu erweitern, um von neuen Ertragsquellen zu profitieren. Bankneugründungen und -zukäufe erlaubten, rasch in diesen Märkten fußzufassen. Vorbereitungen auf die ab 2004 stattfindenden EU-Beitritte 103 lösten eine Reform- und Aufbruchsstimmung aus, die zu einer dynamischen Kreditvergabe führte. Die globale Finanzkrise unterbrach dieses starke Wachstum, und die gezogenen Lehren führten zu einer Phase der Konsolidierung. In der jüngeren Vergangenheit kam es aufgrund der einsetzenden wirtschaftlichen Erholung wieder zu einem deutlichen Ausbau der Geschäftsaktivitäten in CESEE, die erneut die Aufmerksamkeit der Bankenaufsicht weckten und makroprudenzielle Maßnahmen in einigen Ländern dieser Region nötig machten.
Diese Studie ist in sechs Kapitel untergliedert: Kapitel 1 bietet einen historischen Rückblick auf den Beginn des CESEE-Geschäfts der österreichischen Banken. Kapitel 2 und 3 beleuchten die Jahre direkt vor sowie nach der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, in denen zuerst alle Zeichen auf Wachstum standen und danach eine Phase der Konsolidierung einsetzte. Kapitel 4 zeigt die von der Aufsicht gesetzten makroprudenziellen Maßnahmen zur Verringerung des Systemrisikos auf. Kapitel 5 befasst sich mit der wirtschaftlichen Erholungs- und erneuten Wachstumsphase, und Kapitel 6 schließt die Studie mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick ab.
1 Beginn der Geschäftsaktivitäten österreichischer Banken in CESEE
1.1 Aufbau neuer Bankensysteme in CESEE nach der Wende und Rolle ausländischer Banken
Nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime in Osteuropa mussten die Bankensektoren in diesen Ländern neu aufgebaut werden. 104 In den Jahren danach kam es zu einer Reihe von Bankenkrisen: Während Länder wie beispielsweise Ungarn, Polen und Slowenien ihre Bankensysteme mit Hilfe von Rekapitalisierungsprogrammen bis zum Jahr 1997 stabilisierten, benötigten andere wie Tschechien und die Slowakei länger. 105 Viele Länder nahmen mehrere Anläufe, um die Strukturen des alten Systems endgültig aufzubrechen und ihre Banken auf neue Beine zu stellen. 106
Ausländische Banken waren mit ihrem finanzwirtschaftlichen und technischen Wissen sowie ihrer Kapitalbasis oftmals willkommen. Der Eintritt ausländischer Akteure beschleunigte sehr wahrscheinlich den Übergang zur Marktwirtschaft. 107 Häufig genossen sie zudem hohes Vertrauen in der Bevölkerung. Ausländische Banken nahmen in ihrer Rolle als Finanz-intermediäre Funktionen wahr, die durch die lokalen Finanzmärkte (noch) nicht bereitgestellt werden konnten und leisteten damit einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung von Wertpapiermärkten und zur Finanzierung von Unternehmen, was zur wirtschaftlichen Entwicklung beitrug. Aus Sicht der ausländischen Banken machten insbesondere die hohen Ertragschancen die Expansion in die Region äußerst attraktiv. 108
1.2 Der Fall des Eisernen Vorhangs läutete die Internationalisierung der österreichischen Banken ein
Die Aktivitäten der in der Nachkriegszeit verstaatlichten österreichischen Banken konzentrierten sich jahrzehntelang auf den inländischen Markt. Mit der sukzessiven Privatisierung kamen geschäftliche Neuorientierungen, Umstrukturierungen und Fusionierungen, die sich bei manchen bis in die späten 1990er-Jahre zogen. Der Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989 läutete bei den österreichischen Banken eine Wende in Richtung Internationalisierung ein. Neben dem Anreiz des hohen Ertragspotenzials spielte auch die Begleitung österreichischer Unternehmen bei der Expansion nach CESEE eine tragende Rolle.
Die Raiffeisen Zentralbank hatte mit ihrer 1987 in Ungarn gegründeten Tochterbank bereits vor dem Fall des Eisernen Vorhangs einen Fuß nach Osteuropa in der Tür und war damit die erste, die sich abseits des bloßen Filialsystems über die Ostgrenze wagte. Im Jahr 1991 wurde die Raiffeisen International Holding gegründet, in der das Ostgeschäft gebündelt wurde. Während sie in den 1990er-Jahren vornehmlich durch Eigengründungen expandierte, waren es in den 2000er-Jahren vor allem Übernahmen. Die Creditanstalt AG, die später mit der Bank Austria AG fusionierte und inzwischen Teil der UniCredit AG ist, war bald nach der Wende mit gegründeten Tochterbanken in Osteuropa tätig. So wurden beispielsweise im Jahr 1990 Tochterbanken in Slowenien und Ungarn gegründet, 1991 in Polen und Tschechien und 1992 in Russland. Außerdem expandierte sie über Bankenbeteiligungen, Kooperationen sowie Übernahmen im Bereich der Export- und Handelsfinanzierungen in Osteuropa. Etwas länger benötigte die Erste Bank bis zum Start ihrer Geschäfte in CESEE, da die Umstrukturierung des österreichischen Sparkassensektors fast die gesamten 1990er-Jahre in Anspruch nahm. Ihre Expansion fand primär über Akquisitionstätigkeiten statt, so beispielsweise 1997 in Ungarn, 2001 in der Slowakei und 2006 in Rumänien. Während sich die genannten Banken erfolgreich etablierten und bis heute zu den größten Akteuren in CESEE zählen, scheiterte das Geschäftsmodell anderer österreichischer Banken (Volksbank International, Hypo Group Alpe Adria).
1.3 Rascher Markteintritt österreichischer Banken ermöglichte erfolgreiche Etablierung in CESEE 109
| Bilanzsumme | Marktanteil | Beschäftigte | Geschäftsstellen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 00 | Q4 19 | Q4 00 | Q4 19 | Q4 00 | Q4 19 | Q4 00 | Q4 19 | |
| in Mrd EUR | in % | Anzahl | ||||||
| Polen1 | 7,7 | 11,3 | 12 | 3 | 9.839 | 3.871 | 414 | 237 |
| Slowakei | 2,8 | 33,4 | 16 | 39 | 2.365 | 8.081 | 98 | 472 |
| Slowenien | 0,7 | 4,7 | 5 | 11 | 380 | 955 | 12 | 40 |
| Tschechien | 15,3 | 78,4 | 21 | 26 | 17.303 | 13.553 | 749 | 636 |
| Ungarn | 3,5 | 19,0 | 18 | 14 | 2.813 | 5.983 | 134 | 240 |
| Zum Vergleich Österreich | 562,8 | 885,0 | – | – | 69.457 | 73.203 | 5.479 | 3.521 |
| Quelle: OeNB. | ||||||||
| 1 Letztverfügbare Daten stammen aus dem dritten Quartal 2018, seither gibt es keine österreichische Tochterbank mehr in Polen. | ||||||||
Das rasche Agieren der österreichischen Banken sicherte ihnen einen klaren Startvorteil gegenüber anderen ausländischen Banken und spiegelt sich (bis heute) auch in ihren Marktanteilen wider. Für Banken, die sich zögerlicher verhielten, waren die Markteinstiegskosten bereits deutlich höher. Die in den Anfangsjahren vergleichsweise geringe Konkurrenz erlaubte hohe Gewinnspannen: Wenigen Anbietern stand eine stark steigende Nachfrage gegenüber, da die Marktdurchdringung mit Bankdienstleistungen noch sehr gering war. Die Aufrechterhaltung höherer Gewinnspannen gelang insbesondere den ausländischen Banken, da diese im Gegensatz zu den inländischen Banken niedrigere Refinanzierungs-, aber auch Kreditrisikokosten hatten. 110 Der große Vorteil des CESEE-Geschäfts lag daher im Ertragspotenzial. Die österreichischen Tochterbanken leisteten schon damals einen wesentlichen Beitrag zum Geschäftsergebnis der Mutterbanken und waren profitabler als das Bankgeschäft im Inland. Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union (EU) im Jahr 1995 beschleunigte die Verflechtung zwischen Österreich und anderen europäischen Finanzmärkten. Die zügige Expansion der österreichischen Banken fand in den Anfangsjahren in Polen, der Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn, also in Ländern mit geografischer Nähe, aber auch mit Aussicht auf einen späteren EU-Beitritt, statt (Tabelle 1). Der EU-Beitritt einer steigenden Anzahl osteuropäischer Länder trug schließlich zu einer weiteren Verstärkung der Verflechtung bei. Die österreichischen Tochterbanken in Tschechien, Polen, der Slowakei, Slowenien und Ungarn wiesen im Dezember 2000, rund eine Dekade nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, eine Bilanzsumme von 30 Mrd EUR auf und umfassten mehr als 1.400 Filialen und 30.000 Mitarbeiter. 111 In Tschechien, Ungarn, der Slowakei und Polen verzeichneten die österreichischen Tochterbanken bereits Ende 2000 zweistellige Marktanteile. Fast zwei weitere Dekaden später hat sich die Bilanzsumme der österreichischen Tochterbanken in diesen Ländern nahezu verfünffacht (Tabelle 1).
2 Die Jahre 2005 bis 2008: Nach der EU-Osterweiterung stehen alle Zeichen auf Wachstum
Die Bilanzsumme der österreichischen Tochterbanken in CESEE stieg in den Jahren vor der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise stark an und war Ende 2008 mehr als zweieinhalb Mal so hoch wie noch vier Jahre zuvor (Grafik 1). Neben dem Wachstum bestehender Kreditinstitute (z. B. durch die Kreditvergabe) trugen Zukäufe und gruppeninterne Restrukturierungen, die zu sprunghaften Erhöhungen von Marktanteilen führten, dazu bei. 112 Beispiele dafür sind die Akquisition einer rumänischen Großbank durch die Erste Bank (2006) oder der konzerninterne Transfer von zehn CESEE-Tochterbanken zur Bank Austria Creditanstalt (2007). 113 Dieses schnelle Wachstum führte auch zu einem deutlichen Anstieg der Gewinne der österreichischen Tochterbanken in CESEE, die sich im selben Zeitraum mehr als verdreifachten und somit verstärkt zur Profitabilität des gesamten österreichischen Bankensektors beitrugen. So machte das Periodenergebnis der CESEE-Tochterbanken 2007 knapp die Hälfte des gesamten (konsolidierten) Gewinns des österreichischen Bankensektor aus. Im Jahr 2008, als die globale Finanzkrise den Gesamtgewinn bereits auf unter 0,6 Mrd EUR gedrückt hatte, verdienten die Tochterbanken in CESEE 4,2 Mrd EUR.
Allerdings hatte die dynamische Entwicklung des österreichischen Bankenengagements in CESEE auch Schattenseiten: So war die Kreditvergabe in einigen Ländern nicht durch lokale Quellen refinanziert (z. B. Einlagen), sondern wurde durch Liquiditätstransfers der jeweiligen österreichischen Mutterbank angetrieben. Stark erhöhte Kredit-Einlagen-Quoten, z. B. in Ungarn und Rumänien (Ende 2008: 156 % bzw. 139 %), waren nicht nur ein Indiz für eine lokale Kreditvergabe, die rascher als der lokale Vermögensaufbau erfolgte, sondern auch für eine erhöhte Ansteckungsgefahr für den österreichischen Bankensektor. 114 Des Weiteren erfolgte die Kreditvergabe oftmals in Fremdwährung (z. B. in Kroatien, Rumänien und Ungarn), wobei insbesondere Kredite in Schweizer Franken (neben – auf den ersten Blick attraktiven – Zinsersparnissen) für private Haushalte hohe Wechselkursrisiken mit sich brachten (siehe die Abschnitte 4.1 und 4.2 für weitere Informationen). Aufgrund der dynamischen Kreditvergabe und der teilweise hohen Risikobereitschaft – sowohl der Banken als auch der Kreditnehmenden – hatten sich in den Jahren vor der Krise bereits bedeutende Risiken für Banken in CESEE aufgebaut.
3 Die Jahre 2009 bis 2015: Krise und Konsolidierung
Die Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise erreichten die Realwirtschaft in CESEE im Jahr 2009 und machten sich für den Bankensektor in einer deutlichen Verschlechterung der Kreditqualität bemerkbar. Da der Anteil der notleidenden Kredite (NPL-Quote) anstieg, verschlechterte sich infolge die Wertberichtigungsquote bei den österreichischen Tochterbanken in CESEE zunehmend, von unter 3 % vor der Krise auf 8 % Ende 2013. 115 Insbesondere die Qualität der Fremdwährungskredite (FWK) erwies sich während der Krise als deutlich schlechter als jene der Kredite in lokaler Währung, und ihre Erholung setzte auch erst zwei Jahre später ein (Grafik 2). Auch waren jene Geschäftsmodelle, deren Kreditvergabe vor der Krise außergewöhnlich stark auf Wachstum und geringe Kundeneinlagen ausgelegt war, besonders häufig von hohen Kreditwertberichtigungen betroffen („Boom-Bust-Zyklus“). 116 Während die Tochterbanken in den ersten Jahren nach der Krise mit deren unmittelbarer Bewältigung beschäftigt waren, wurde ab 2012 die Bevorsorgung notleidender Kredite deutlich verbessert und die Coverage Ratio 117 stieg von 43% (Ende 2011) auf 59 % an (Ende 2015). Die vor der Krise aufgebauten Risiken führten zu hohen Kosten: Allein die Dotierung der Wertberichtigungen für Kreditrisiken kostete die österreichischen Tochterbanken in CESEE zwischen 2009 und 2015 fast 60 % ihres Betriebsergebnisses; unberücksichtigt sind in dieser Berechnung Kosten, die aufgrund gesetzlich vorgeschriebener FWK-Konvertierungen oder durch Abschreibungen der Beteiligungswerte an Tochterbanken entstanden waren. 118
Dennoch erwirtschafteten die österreichischen CESEE-Tochterbanken im Aggregat auch in den Jahren 2009 bis 2015 substanzielle Profite (Grafik 3). Dafür ausschlaggebend waren insbesondere zwei Faktoren:
1. Diversität der Geschäftsmodelle: Tochterbanken, die vor der Krise umsichtig handelten – d. h. keine FWK an Haushalte vergaben und unabhängig von Liquiditätstransfers ihrer österreichischen Mutterbank agierten – waren weniger stark von der Verschlechterung der Kreditqualität betroffen. Dies spiegelt sich auch in der Gewinnsituation in einzelnen Ländern wider, wobei stabile Gewinne in Tschechien und der Slowakei die Verluste in Ungarn (2011–2014), Rumänien (2012, 2014) und Kroatien (2015) ausglichen.
2. Fokus auf das Retailgeschäft: Dies erwies sich als vorteilhaft, da die anfallenden (Kreditrisiko-)Kosten über mehrere Jahre schlagend wurden und somit eine zeitlich längerfristige Kostenverteilung ermöglichten (im Gegensatz zu schnell realisierten Wertpapierverlusten bei Investmentbanken).
4 Makroprudenzielle Maßnahmen zur Hintanhaltung des Systemrisikos
Eine wesentliche Lehre aus der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise war die Ergänzung des mikroprudenziellen – auf die Einzelbanken fokussierten – Ansatzes der Bankenaufsicht um die makroprudenzielle Sicht, die die Systemperspektive berücksichtigt. Die österreichische Bankenaufsicht setzte vier wichtige makroprudenzielle Schritte, um systemische Risiken aus dem CESEE-Engagement der Banken zu senken.
4.1 Die Fremdwährungskreditvergabe wurde in CESEE erfolgreich eingedämmt
Ende 2010 waren Fremdwährungskredite in Höhe von rund 85 Mrd EUR bei österreichischen Tochterbanken in CESEE ausständig, was knapp die Hälfte der vergebenen Kredite ausmachte. Von diesen wurden 65% in EU-Mitgliedstaaten vergeben (inklusive Kroatien, das 2013 beitrat). 56% der FWK waren in Euro denominiert, 19% in Schweizer Franken und 24% in anderen Fremdwährungen (insbesondere US-Dollar). Die höchsten FWK-Volumina waren zu diesem Zeitpunkt in Kroatien (Anteil: 77%), Ungarn (70%) und Rumänien (70%) ausständig (Grafik 4). FWK wurden von den Kreditnehmenden aufgrund des vorteilhaften Zinsdifferentials und der damals angenommenen geringen Wechselkursschwankungen, aufgenommen. Durch den Ausbruch der Finanzkrise 2008 wurden diese Risiken jedoch schlagend. Vor allem die Kredite in Schweizer Franken wurden für die Kreditnehmenden (und Banken) zunehmend problematisch. 119 Im Jahr 2010 stimmten die österreichischen, in CESEE tätigen Banken, den von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) lancierten sogenannten „Guiding Principles“ zu. Diese sehen vor keine neuen FWK in anderen Währungen als dem Euro (bzw. US-Dollar in den GUS-Staaten) an private Haushalte und Klein- und Mittelbetriebe zu vergeben. Analysen der OeNB bestätigen die Einhaltung dieser Selbstverpflichtung. Auf europäischer Ebene wurde im Herbst 2011 eine Empfehlung zu FWK seitens des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (ESRB) veröffentlicht. 120 CESEE-Länder mit hohem FWK-Anteil reagierten unterschiedlich: Während Rumänien die ESRB-Empfehlung umgehend umsetzte, wurden z.B. in Ungarn und Kroatien sogenannte „unorthodoxe“ Maßnahmen 121 ergriffen. Ende 2019 betrugen die von den österreichischen Tochterbanken vergebenen FWK knapp 30 Mrd EUR. Der Anteil an den Gesamtkrediten lag damit bei weniger als einem Viertel.
4.2 Nachhaltigkeitspaket führt zu stärkerer lokaler Refinanzierung
Um die Refinanzierungsstruktur der Tochterbanken ausgewogener zu gestalten und übermäßiges Kreditwachstum zu vermeiden, wurde im Jahr 2012 die Leitlinie zur Stärkung der Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle international aktiver österreichischer Großbanken veröffentlicht. Seitdem wird das Verhältnis von Krediten zur lokalen stabilen Refinanzierung sowie die Bepreisung gruppeninterner Liquiditätstransfers sehr genau beobachtet, um in exzessiven Aufschwungsphasen eine „Bremswirkung“ zu entfalten. 122 Seit der Einführung dieser Maßnahme sank die Kredit-Einlagen-Quote von über 100% auf zuletzt rund 80% und die konzerninternen (Brutto-)Liquiditätstransfers der österreichischen Mutter- an ihre CESEE-Tochterbanken von über 40 Mrd EUR auf unter 20 Mrd EUR (Grafik 5). Zieht man von dieser Summe die Transfers an tschechische Tochterbanken ab, die zwei Drittel der verbliebenen Transfers ausmachen und aufgrund des positiven Leitzinsdifferenzials bestehen, ergibt das eine Senkung des Ansteckungsrisikos für den österreichischen Bankensektor um mehr als 36 Mrd EUR.
4.3 Vienna Initiative: Eine effektive Koordinationsplattform zur Sicherung der Finanzmarktstabilität in CESEE
Um einen ungeordneten Rückzug ausländischer Banken aus CESEE zu vermeiden und die Versorgung der Realwirtschaft mit Krediten sicherzustellen, wurde die Vienna Initiative im Jänner 2009, am Höhepunkt der Finanzkrise, ins Leben gerufen. Diese Diskussions- und Kooperationsplattform brachte die relevanten Vertreterinnen und Vertreter der Heimat- und Gastlandaufseher, internationale Finanzinstitutionen 123 und die in der Region tätigen Banken zusammen. 124 Wie Grafik 6 in der rechten Abbildung zeigt, trug die Initiative wesentlich zur Sicherung der Finanzmarktstabilität bei, da jene Banken mit signifikantem Anteil an den Auslandsforderungen gegenüber CESEE diese in den Jahren 2009 und 2010 nicht reduzierten.
Als die systemischen Risiken ab dem Jahr 2010 deutlich abnahmen, verschob sich der Fokus der nunmehrigen „Vienna Plus“-Initiative vom Krisenmanagement zur -prävention. Ziel heute ist der Aufbau lokaler Kapitalmärkte und die Förderung von Kredit- und Refinanzierungsmärkten in lokaler Währung.
Im Lichte der Lehren aus der Krise konsolidierten auch große österreichische Bankengruppen ihr CESEE-Engagement. Zwei mittelgroße Gruppen zogen sich komplett aus CESEE zurück (Volksbank International und Hypo Group Alpe Adria). Aufgrund der Weiterführung der Geschäfte durch neue Eigentümer (Sberbank Europe und Addiko Bank) kam es aber auch hier zu keinen Kreditklemmen für die lokalen Volkswirtschaften. 125
4.4 Makroprudenzieller Systemrisikopuffer zur Reduktion des systemischen Klumpenrisikos österreichischer Banken in CESEE
Im Jahr 2015 schlug die OeNB dem österreichischen Finanzmarktstabilitätsgremium 126 den Einsatz eines makroprudenziellen Systemrisikopuffers zur strukturellen Stärkung der Finanzmarktstabilität vor, und die FMA setzte eine entsprechende Verordnung um. Dieser Kapitalpuffer wurde Anfang 2016 eingeführt und soll der „systemischen Verwundbarkeit“ und dem „systemischen Klumpenrisiko“ der betroffenen österreichischen Banken begegnen. Die „systemische Verwundbarkeit“ beschreibt das Risiko, dass eines oder mehrere Kreditinstitute von Störungen im Finanzsystem in erhöhtem Maße betroffen sein können. Für die österreichische Finanzmarktstabilität bestimmt sich diese Verwundbarkeit unter anderem aus der Größe des Bankensektors, aus den spezifischen Eigentümerstrukturen und aus dem Wegfall der impliziten Staatsgarantie aufgrund des Bankenabwicklungsregimes. Das „systemische Klumpenrisiko“ entsteht durch ähnliche Exponierungen der Kreditwirtschaft und kann bei mehreren Kreditinstituten gleichzeitig zu Störungen und zu schwerwiegenden negativen Auswirkungen auf das Finanzsystem und die Realwirtschaft führen. Für den österreichischen Bankensektor wurde das hohe Engagement in CESEE als solches identifiziert (mit erhöhten Kredit- und Wechselkurs-, aber auch politischen Risiken). Dank des Aufbaus des Systemrisikopuffers, der die Kreditvergabe nicht einschränkte, halten die betroffenen Banken 127 nun mehr Kapital und sind für potenzielle Krisen besser gewappnet.
5 Die Jahre 2016 bis 2019: Erholung und erneute Wachstumsphase
In der zweiten Hälfte der 2010er-Jahre kam es zu einer stetigen Verbesserung des Geschäftsumfelds in CESEE. Wiedererstarkte Volkswirtschaften und niedrigere Zinssätze verbesserten die Zahlungsfähigkeit der Kundinnen und Kunden, wodurch die NPL-Quote österreichischer Tochterbanken in CESEE – trotz hoher regionaler Heterogenität – auf nur noch 2,4 % gedrückt wurde (Q4/19). Die niedrigen (Kredit-)Risikokosten trugen wiederum zu höheren Gewinnen bei (Grafik 7). Diese gute Ertragslage ist auch dem wieder anziehenden Kreditwachstum geschuldet, bringt aber auch systemische Herausforderungen mit sich. Die österreichischen Tochterbanken sind mit ihren hohen Marktanteilen in einigen EU-CESEE-Ländern 128 und einem ausstehenden Kreditvolumen von insgesamt 127 Mrd EUR in CESEE (per Dezember 2019) maßgeblich an dieser Entwicklung beteiligt. Betrug das jährliche Wachstum der Haushaltskredite im Jahr 2016 etwa 2%, waren es in den folgenden drei Jahren jeweils etwa 8%. 129 Die Kreditvergabe konzentrierte sich in den vergangenen drei Jahren auf Immobilienkredite an Haushalte. Diese stellen mittlerweile mehr als ein Drittel aller in CESEE durch österreichische Tochterbanken vergebenen Kredite dar, wovon wiederum die meisten in Tschechien und der Slowakei vergeben wurden. Im Zuge des konjunkturellen Aufschwungs zog zudem die Konsumkreditvergabe an. Aufgrund des erhöhten Kreditwachstums haben die Aufsichtsbehörden in zahlreichen CESEE-Ländern makroprudenzielle Maßnahmen ergriffen. Hierzu zählen insbesondere kreditnehmerbasierte Maßnahmen (v.a. Verschuldungsobergrenzen), Maßnahmen zur Reduktion von FWK sowie der antizyklische Kapitalpuffer.
6 Zusammenfassung und Ausblick
Auch drei Jahrzehnte nach dem Fall des Eisernen Vorhangs beziehungsweise 16 Jahre nach dem EU-Beitritt der ersten CESEE-Länder bietet der wirtschaftliche Aufholprozess in diesem „erweiterten Heimatmarkt“ weiterhin beachtliches Wachstums- und Ertragspotenzial für international tätige österreichische Banken. 130 Die globale Finanzkrise hat aber auch die Anfälligkeiten gewisser Geschäftsmodelle und Produkte aufgezeigt, denen seither sowohl von der Bankenaufsicht als auch von den Banken selbst begegnet wird.
Der Ausblick für den Bankensektor in CESEE ist gemischt: Einerseits ist die momentane Gewinnsituation und Qualität des Kreditportfolios gut, andererseits bringen der vom dynamischen Kreditwachstum angetriebene lange Aufschwung und die einsetzende wirtschaftliche Abschwächung auch zahlreiche Herausforderungen mit sich. 131 Die mittlerweile erhöhte geographische Konzentration des österreichischen Bankengagements in CESEE – insbesondere auf Tschechien und die Slowakei, die die Hälfte der Aktiva auf sich vereinen (per Q4/19) – führt zusätzlich zu einer verstärkten Abhängigkeit von Entwicklungen in diesen Ländern. Obwohl die Mutter- und Tochterbanken nun deutlich besser kapitalisiert sind als vor der globalen Finanzkrise, muss die Bankenaufsicht weiterhin wachsam bleiben.
Die Lehren aus der globalen Finanzkrise sind weiterhin aktuell: Banken, insbesondere wenn sie grenzüberschreitend agieren, sind nur schwer abzuwickeln, und starkes Kreditwachstum birgt nicht nur Möglichkeiten, sondern meist auch Risiken. Insofern sind zumindest zwei offene Herausforderungen für das nächste Jahrzehnt bereits vorgezeichnet: erstens, die Verbesserung der Abwicklungsfähigkeit von Auslandsaktivitäten, die strategische Weichenstellungen erfordert (Entscheidung zwischen multiplem oder singulärem Abwicklungsansatz 132 ); zweitens die nachhaltige Anpassung an ein lang andauerndes Niedrigzinsumfeld, dem nicht nur mit Kreditwachstum begegnet werden sollte, sondern durch das Angebot innovativer und gleichzeitig risikoadäquat bepreister Produkte, die in einem intensiven Wettbewerb mit neuen, agilen Marktteilnehmern (FinTechs) bestehen können. Den in CESEE aktiven Banken und deren Aufsichtsbehörden wird bei der Findung von Antworten auf diese neuen Herausforderungen eine gewichtige Rolle zukommen.
Literaturverzeichnis
Barisitz, S. 2009. Banking Transformation 1980–2006 in Central and Eastern Europe – From Communism to Capitalism. In: South-Eastern Europe Journal of Economics 2 (2009). 161–180.
Barisitz, S. und S. Gardó. 2009. Banking Sector Transformation in CESEE. In: Focus on European Economic Integration. 1989–2009 Twenty years of east-west integration (Special Issue). OeNB. Dezember.
Gruber, M., S. Kavan und P. Stockert. 2017. What drives Austrian banking subsidiaries’ return on equity in CESEE and how does it compare to their cost of equity? In: Financial Stability Report 33. OeNB. Juli. 78–87.
Hubmer, G., W. Müller, F. Novak, T. Reininger, F. Schardax, M. Summer und M. Würz. 2001. Die Entwicklung der Finanzmärkte in den mittel- und osteuropäischen Ländern: eine Bestandsaufnahme. In: Finanzmarktstabilitätsbericht 1. OeNB. Juni.
Kavan, S., G. Ebner, E. Endlich, A. Greiner, M. Gruber, G. Hobl, M. Ohms, V. Redak, A. Schober-Rhomberg, P. Stockert, D. Widhalm und T. Wittenberger. 2016. The profitability of Austrian banking subsidiaries in CESEE: driving forces, current challenges and opportunities. In: Financial Stability Report 32. OeNB. Dezember. 64–79.
OeNB. 2001. Finanzmarktstabilitätsbericht 1. Juni.
Wittenberger, T. 2018. Lending to households in CESEE with regard to Austrian banking subsidiaries and macroprudential measures addressing credit-related risks. In: Financial Stability Report 36. OeNB. November. 82–93.
100 Diese Studie basiert auf Daten und Erkenntnissen per Ende 2019 und umfasst somit nicht die COVID-19-Pandemie und ihre Auswirkungen. Für diesbezügliche Analysen steht Ihnen ab Mitte Juli 2020 der OeNB Financial Stability Report 39 zur Verfügung; siehe https://www.oenb.at/Publikationen/Finanzmarkt/Finanzmarktstabilitaetsbericht.html. Zwischenzeitlich werden Neuigkeiten und Informationen auch auf einer OeNB-Webseite zur Verfügung gestellt: https://www.oenb.at/Publikationen/corona.html.
101 Oesterreichische Nationalbank, Abteilung Finanzmarktstabilität und Makroprudenzielle Aufsicht, stefan.kavan@oenb.at und tina.wittenberger@oenb.at. Die in diesem Artikel vertretenen Meinungen sind ausschließlich jene der Autorin und des Autors und geben nicht notwendigerweise jene der OeNB oder des Eurosystems wieder.
102 In dieser Studie wird die CESEE-Region breit gefasst und schließt Länder wie Russland, Ukraine und Weißrussland ein. Die Begriffe CESEE und Osteuropa werden synonym verwendet.
103 Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn waren Teil der ersten EU-Beitrittsrunde im Jahr 2004; Bulgarien und Rumänien folgten 2007 und Kroatien 2013.
104 In der zentralen Planwirtschaft war das Bankensystem allen voran ein buchhalterisches Instrument zur Erfassung der Mittelzuweisungen durch die Behörden an die verschiedenen Sektoren und Unternehmen.
105 Siehe Hubmer et al. (2001).
106 Für weitere Details zu einzelnen Ländern siehe auch Barisitz (2009) sowie Barisitz und Gardó (2009).
107 Siehe Barisitz (2009).
108 Siehe Hubmer et al. (2001).
109 Für weitere Details siehe Hubmer et al. (2001).
110 Die Refinanzierungsvolumina der österreichischen Tochterbanken durch ihre Mutterbanken spielten zu diesem Zeitpunkt noch keine bedeutende Rolle. Lokale Banken wiesen oftmals einen hohen Anteil „ererbter“ notleidender Kredite auf.
111 Die Geschäftstätigkeit der österreichischen Tochterbanken in Osteuropa war damals noch nicht durch die Monatsausweismeldungen erfasst. Diese Daten wurden zunächst mittels einer quartalsweisen Befragung der OeNB erhoben und waren seit Mitte 1999 verfügbar. Siehe OeNB (2001).
112 Generell ist für die gesamte Studie darauf hinzuweisen, dass die zahlreichen Restrukturierungen vor und nach der Krise dazu führten, dass die Anzahl der in CESEE aktiven Mutter- und Tochterbanken sehr stark schwankte und das Banken-Sample dadurch Veränderungen unterliegt. Das Hauptaugenmerk liegt deshalb auf aggregierten Bestandszahlen zu Stichtagen und deren Veränderungen. Dadurch wird ein akkurates Bild der Gesamtexponierung zu gewissen Zeitpunkten (und deren Veränderung) vermittelt.
113 Quellen: https://www.erstegroup.com/de/ueber-uns/unsere-maerkte und https://www.unicreditgroup.eu/en/press-media/press-releases-price-sensitive/2007/PressRelease0243.html .
114 Für die CESEE-Länder ging die rasche real- und finanzwirtschaftliche Integration in den größeren europäischen Wirtschaftsraum mit dem Aufbau makroökonomischer Ungleichgewichte einher, was sich in hohen Leistungsbilanzdefiziten vor der Krise 2008 widerspiegelte. Da aufholende Volkswirtschaften zur Deckung ihres erhöhten Kapitalbedarfs oft auf grenzüberschreitende Finanzierungsquellen angewiesen sind, stellen solche Defizite zum Teil eine Begleiterscheinung des wirtschaftlichen Aufholprozesses dar. Lang andauernde beziehungsweise übermäßig hohe Leistungsbilanzdefizite können jedoch zum Aufbau einer nicht-nachhaltigen externen Verschuldung führen und erhöhen die Anfälligkeit für internationale Schocks.
115 Die Verschlechterung der Kreditqualität war in CESEE deutlich ausgeprägter als in Österreich, wo die unkonsolidierte Wertberichtigungsquote Anfang 2014 ihren Höhepunkt bei 3,7 % erreichte. NPL-Daten sind erst seit 2009 verfügbar.
116 Für weitere Informationen, siehe den zweiten Teil des Annex zur aufsichtlichen Leitlinie zur Stärkung der Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle international aktiver österreichischer Großbanken unter https://www.oenb.at/dam/jcr:2d16eb19-5df1-4d91-9fc1-e139ac8779fb/Aufsichtliche%20Leitlinie.pdf .
117 Die Coverage Ratio ist der Anteil der bereits wertberichtigten NPL. Je höher dieser Wertberichtigungsgrad ist, desto geringer sind die verbleibenden Verlustrisiken für die Bank. Die verwendete Coverage Ratio berücksichtigt keine potenziellen Rückflüsse aus der Verwertung von Sicherheiten (z. B. Immobilien).
118 Für eine detaillierte Darstellung dieser Kosten siehe Kapitel 4 „Writedowns of subsidiaries’ book values and forced conversion of foreign currency loans led to substantial costs“ in Kavan et al. (2016).
119 Das mit Abstand höchste Schweizer-Franken-Exposure verzeichneten die österreichischen Tochterbanken in Ungarn: Ende 2010 betrug der Anteil der Kredite in Schweizer Franken bei den Haushalten 70%, wovon 95% als Immobilienkredite vergeben waren.
120 Empfehlung betreffend die Kreditvergabe in fremder Währung (ESRB/2011/1): https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/ESRB_2011_1.de.pdf.
121 Beispiele: Zwangskonvertierung von Schweizer Franken Krediten in Kroatien im Jahr 2015; vorzeitige Kredittilgung von FWK zu für Kreditnehmende günstigen Wechselkursen in Ungarn im Jahr 2012.
122 Nähere Details unter https://www.oenb.at/finanzmarkt/finanzmarktstabilitaet/besonderheiten-des-oesterreichischen-bankwesens/nachhaltigkeit-der-geschaeftsmodelle.html .
123 Das sind z.B. EBRD, IWF und Weltbank.
124 Siehe http://vienna-initiative.com/about/vienna-initiative-1-0/overview/. Die OeNB engagierte sich intensiv beim Aufbau der „Vienna Initiative“ und verstärkte zudem die Kooperation mit den von der Finanzkrise besonders betroffenen CESEE-Ländern, wie Rumänien und Ungarn.
125 Im Bereich der großen Restrukturierungen ist zudem jene innerhalb der Unicredit Group im Jahr 2016 zu erwähnen, bei der das von der Bank Austria geführte CESEE-Geschäft zu ihrer italienischen Mutterbank transferiert wurde. Dieser Strukturbruch betraf eine Bilanzsumme von deutlich über 100 Mrd EUR und reduzierte jene des österreichischen Bankensektors in CESEE schlagartig um knapp 40%. Aufgrund dieser Restrukturierung stieg der Anteil der Bilanzsumme jener österreichischen CESEE-Tochterbanken, die in EU-Mitgliedstaaten aktiv sind, auf über vier Fünftel.
126 https://www.fmsg.at.
127 https://www.fmsg.at/publikationen/risikohinweise-und-empfehlungen/2018/empfehlung-2-2018.html.
128 Slowakei: 39%, Kroatien: 29%, Tschechien: 26%, Rumänien: 22% und Ungarn: 14% (per Ende Dezember 2019, gemessen an der Bilanzsumme).
129 Wechselkursbereinigtes Kreditwachstum. Das Banken-Sample wurde mit jenem von Dezember 2019 konstant gehalten.
130 Die erzielte Zinsmarge aber auch die Gesamtkapitalrendite, welche die höheren Kreditrisiken berücksichtigt, lagen bei den österreichischen Tochterbanken in CESEE in den Jahren 2009 bis 2019 durchgehend und deutlich über den (unkonsolidierten) Vergleichswerten des Österreichgeschäfts. Für eine langfristige Analyse der Profitabilität der österreichischen Tochterbanken in CESEE, siehe Kavan et al. (2016).
131 Unter anderem für Banken mit hohem Engagement in der Automobilindustrie, die sich im strukturellen Wandel befindet, und in vielen CESEE-Ländern von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung ist (z. B. in Tschechien, Ungarn und der Slowakei).
132 Im multiplen Abwicklungsansatz können – vereinfacht dargestellt – einzelne Tochterbanken separat von der Gruppe abgewickelt werden, während im singulären Ansatz nur die gesamte Bankengruppe (als Einheit) abgewickelt werden kann.
Das europäische Regelwerk für Bankenaufsicht und sein institutioneller Rahmen seit dem EU-Beitritt Österreichs
Michael Kaden, Michael Boss, Markus Schwaiger 133
Wissenschaftliche Begutachtung: Ernest Gnan, OeNB
Das europäische Rahmenwerk für die Bankenaufsicht hat sich im Laufe der Zeit in Hinblick auf seine Zielsetzungen, seine legistische Herangehensweise, seine institutionelle Ausgestaltung und nicht zuletzt auch auf seine Inhalte grundlegend verändert. Zum Zeitpunkt des österreichischen EU-Beitritts stand vor allem das Ziel der Errichtung eines einheitlichen Binnenmarktes im Vordergrund. Der Fokus war auf den Abbau von Hindernissen für die Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit sowie die Herstellung einheitlicher Wettbewerbsbedingungen in den Mitgliedstaaten gerichtet. Es wurden gezielte europarechtliche Änderungen, verstreut auf mehrere Richtlinien und weitgehend ohne eine komplementäre institutionelle Komponente, normiert. Um rascher auf aktuelle Entwicklungen am Finanzmarkt reagieren zu können und die Vorteile der Euro-Einführung durch eine Integration der Finanzmärkte besser nutzen zu können, wurde zu Beginn dieses Jahrtausends mit der Schaffung spezialisierter europäischer Regulierungsgremien verstärktes Augenmerk auf einen schnelleren und flexibleren Regulierungsprozess gelegt. Gleichzeitig wurde auf Ebene des europäischen Gesetzgebers der empfundenen Normenflut und -vielfalt durch den Ansatz der „Better Regulation“ entgegengetreten. Die Finanzkrise 2007 brachte schließlich eine bedeutende Neufokussierung der gesetzgeberischen Motive und Reichweite mit sich. Die Behebung der durch die Krise aufgedeckten Mängel in der Regulierung und das Ziel, künftig derartige Krisenszenarien möglichst zu vermeiden, dominieren seither die gesetzgeberische Tätigkeit, ohne jedoch den bisher verfolgten Zielen eine völlige Absage zu erteilen. Neben der Stärkung der Krisenfestigkeit von Instituten und des Finanzsektors als Ganzes wurde auch die Vergemeinschaftung behördlicher Tätigkeiten – gestützt auf direkt anwendbare Verordnungen – vorangetrieben und mündete in der (noch unvollendeten) Bankenunion.
JEL classification: G21, G28
Keywords: Bank Regulation, Bank Supervision
Zum Zeitpunkt des EU-Beitritts Österreichs am 1. Jänner 1995 war die EU-weite Bankenregulierung noch sehr fragmentiert und auf zahlreiche Richtlinien verteilt normiert. Entsprechend gering war die EU-weite Harmonisierung in diesem Bereich und somit auch in der Bankenaufsicht. Dies hat sich in den 25 Jahren, die seither vergangen sind, fundamental geändert. Durch das sogenannte Single Rule Book wurde ein nunmehr weitgehend harmonisiertes Regelwerk geschaffen, wobei als Konsequenz aus der Finanzkrise auch die Regelungsdichte deutlich zugenommen hat. Im Zuge der Etablierung der Bankenunion konnte darüber hinaus eine zunehmende Konvergenz in der operativen Bankenaufsicht innerhalb des Euroraums erreicht werden. Durch diese Entwicklungen im Regelwerk und den daraus resultierenden Verbesserungen in der Risikotragfähigkeit und im Risikomanagement in Banken ist der Bankensektor in der EU und somit auch in Österreich heute krisenresistenter als noch vor 25 Jahren. Gleichzeitig haben sich auch die Wettbewerbsbedingungen im europäischen Bankensektor deutlich angeglichen. Wesentlicher Treiber, zumindest aber Katalysator dieser Entwicklung war die Finanzkrise, die nicht nur zu einer Verschärfung der Regulierung, sondern eben auch zu einer Konvergenz in der operativen Bankenaufsicht bis hin zur Gründung der Bankenunion im Euroraum führte.
Der folgende Beitrag gliedert sich in vier Kapitel: im ersten wird die Zeit bis zum Ausbruch der Finanzkrise dargestellt, die in erster Linie vom Harmonisierungsgedanken im Sinne eines einheitlichen Marktes mit zunehmenden Deregulierungstendenzen geprägt war. Das zweite Kapitel geht auf den Paradigmenwechsel in der Bankenregulierung aufgrund der Lehren aus der Finanzkrise ein. Kapitel drei widmet sich schließlich der Gründung der Bankenunion als Reaktion auf die Finanzkrise inklusive eines Ausblicks auf deren noch ausstehende Vollendung. Kapitel vier fasst die wesentlichen Schlussfolgerungen zusammen. Die inhaltliche Abgrenzung der ersten drei Kapitel basiert nicht allein auf der zeitlichen Abfolge der drei genannten Phasen, vielmehr sollen die Kernpunkte der Regulierungsdiskussion in der jeweiligen Phase – einschließlich der Vor- und Nachgeschichte – dargestellt werden, weshalb es in der Darstellung des zeitlichen Ablaufs durchaus zu Überschneidungen kommt.
1 Harmonisierung und Deregulierung bis zum Ausbruch der Finanzkrise
Nachdem Österreich im Juli 1989 seinen Antrag auf Mitgliedschaft in der (damals noch) Europäischen Gemeinschaft (EG) überreicht hatte, musste es in weiterer Folge den Acquis Communautaire 134 der (dann schon) Europäischen Union (EU) in seine nationale Rechtsordnung übernehmen. 135 Im Rahmen der Vorbereitungen Österreichs auf den EU-Beitritt waren insgesamt rund 4.000 direkt anwendbare EU-Verordnungen und etwa 1.000 in nationale Gesetze umzusetzende EU-Richtlinien legistisch zu berücksichtigen. 136 Zu diesem Zweck wurde in Österreich u. a. auch das bis zu diesem Zeitpunkt in Kraft stehende Kreditwesengesetz (KWG) durch das an den Acquis Communautaire angepasste Bankwesengesetz (BWG) ersetzt. 137
Auf europäischer Ebene reichen die ersten Überlegungen zur Erreichung eines gemeinsamen Kapitalmarktes sehr lange zurück – diese wurden bereits in dem von der EWG-Kommission 1966 beauftragten Bericht einer Expertengruppe unter dem Vorsitz von Claudio Segré 138 zum Aufbau eines europäischen Kapitalmarkts angestellt und beinhalteten Empfehlungen zur Beseitigung der einheitlichen Wettbewerbsbedingungen entgegenstehenden Hindernisse. 139 Die damals vorherrschenden Regelungen in den Mitgliedstaaten der EG waren allerdings durchaus noch von den Nachwehen der Weltwirtschaftskrise der Zwischenkriegszeit geprägt. 140
Ab 1973 wurden die Bestrebungen der EG zur Erreichung eines Binnenmarktes für Bankdienstleistungen durch entsprechende europarechtliche Gesetzgebungsakte vorangetrieben, indem der europäische Gesetzgeber erste Richtlinien erließ. Im Vergleich zum heute vorherrschenden bankenaufsichtlichen Regelwerk waren diese Gesetzgebungsakte jedoch vergleichsweise minimalistisch. Ihr Hauptfokus war auf den Abbau der festgestellten Hindernisse für die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit von Banken sowie in weiterer Folge auf die Umsetzung der 1988 beschlossenen Bestimmungen des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht (Basel I) 141 gerichtet. Für die weitere Regulierungsdebatte wesentlich war dabei die Grundsatzentscheidung der EG, die Baseler Vorschriften im Sinne einheitlicher Wettbewerbsvoraussetzungen im Binnenmarkt für alle in der EG tätigen Banken unabhängig von ihrer Größe bzw. Komplexität umzusetzen.
Zum Zeitpunkt des EU-Beitrittes Österreichs waren die im BWG umgesetzten Regelungen aufgrund eines eher punktuellen und schrittweisen Ansatzes zur Harmonisierung der Bankenregulierung über zahlreiche Richtlinien verstreut, die jeweils spezifische Aspekte der Regulierung betrafen (Grafik 1).
Um das Ziel der Verwirklichung eines Binnenmarktes für Finanzdienstleistungen zu erreichen, beschloss die Europäische Kommission mehrere Monate nach der Einführung des Euro im Mai 1999 den „Aktionsplan für Finanzdienstleistungen“ (Financial Services Action Plan, FSAP) 142 . Dieser enthielt 42 beabsichtigte Maßnahmen, darunter allein 25 konkrete Richtlinienvorschläge, um „alle denkbaren Vorteile aus der Einführung des Euro zu ziehen und die Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit der EU-Finanzmärkte zu sichern“.
Der zu diesem Zeitpunkt bereits implementierte europäische Rechtsrahmen wurde im FSAP als ausreichender „Schutzwall gegen den Ausfall von Kreditinstituten und das Systemrisiko“ erachtet und die Absicherung von Einlegern und Versicherten gegen einen Zahlungsausfall als ausreichend befunden. Für den Bereich der Bankenregulierung und -aufsicht waren insbesondere die Umsetzung der im Baseler Rahmenwerk vorgenommenen Änderungen zu den Eigenmittelvorschriften (Basel II) 143 sowie die Richtlinie zur Sanierung und Liquidation von Kreditinstituten, auch bekannt als Bank Insolvency Directive (BID) 144 als relevante anstehende Maßnahmen genannt.
Die Einführung des Euro eröffnete gemäß FSAP die Vision eines „modernen Finanzsystems, welches die Kapital- und Intermediationskosten minimiert“ und wurde gleichzeitig als herausfordernde Situation für Regulierungs- und Aufsichtsbehörden erachtet, die rasches Handeln notwendig macht. Der Fokus wurde dabei auf die Sicherstellung einer ausgeglichenen regionalen Verteilung der Vorteile eines wettbewerbsfähigen und integrierten Marktes für Finanzdienstleistungen gerichtet. Da sich die „Anpassung des EU-Aufsichtsrechts an neue Quellen der Instabilität bzw. die Umstellung auf moderne Regelungs- und Überwachungsverfahren … mühselig und langsam“ gestaltete, rief der Europäische Rat im Juli 2000 einen von Alexandre Lamfalussy geleiteten Ausschuss ins Leben, der insbesondere den Status quo für die Anwendung der Regulierungsmaßnahmen bezüglich der EU-Wertpapiermärkte zu bewerten hatte. Der Ausschuss untersuchte, wie mit EU-Regelungen am besten auf die aktuellen Entwicklungen an den Wertpapiermärkten reagiert und ein effizientes und dynamisches Funktionieren der Märkte gewährleistet werden könnte 145 . Einer der wesentlichen Änderungsvorschläge im „Lamfalussy-Report“ 146 betraf die Einführung eines Vier-Stufen-Modells (Grafik 2) für die Regulierung und die Schaffung neuer in diesen Rechtsetzungsprozess eingebundener Ausschüsse, 2001 zunächst für Wertpapiermärkte und 2004 auch für die Bereiche Banken und Versicherungen 147 .
Mit Einführung dieses Komitologieverfahrens wurde die Grundlage für das heute praktizierte europäische Gesetzgebungsmodell – mit dem Ziel der rascheren und flexibleren Anpassung der aufsichtlichen Rechtsgrundlagen – gelegt. Seit der Gründung der Europäischen Aufsichtsbehörden (European Supervisory Authorities, ESAs) 148 per 1. Jänner 2011 wird somit eine Vielzahl an notwendigen technischen Arbeiten an diese Ebene delegiert und nicht bereits im Primärrecht geregelt 149 . Gleichzeitig war dies auch der Ausgangspunkt für eine bedeutende Ausweitung des Umfangs und der Komplexität des aufsichtlichen Regelwerkes, da nun nicht nur zahlreiche technische Spezifizierungen, sondern auch strittige Punkte zur weiteren Kompromissfindung an die ESAs delegiert wurden. Darüber hinaus sind die ESAs – wie auch schon ihre Vorgängerausschüsse – mit der Herstellung kohärenter, effizienter und wirksamer Aufsichtspraktiken mandatiert, was durch den Erlass von verbindlichen technischen Standards, Leitlinien, Empfehlungen sowie Q&As erfolgt. So enthielten etwa die in den Jahren 2013 und 2014 erlassenen Gesetzespakete zur Umsetzung der globalen Lehren aus der Finanzkrise 150 in der EU den Auftrag für die Erstellung einer dreistelligen Anzahl von technischen Standards bzw. Leitlinien an die EBA.
Im Jahr 2000 erfolgte ein weiterer bedeutender Entwicklungsschritt mit dem Erlass der sogenannten EU-Bankrechtsrichtlinie (Banking Consolidation Directive, BCD) über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit von Kreditinstituten. Diese stellte erstmalig eine Teilkodifizierung des europäischen Regelungsrahmens für Banken dar und ersetzte das bis dahin geltende fragmentierte Regelwerk aus Richtlinien (Grafik 3). Inhaltlich enthielt sie demgegenüber vergleichsweise unbedeutende Neuerungen.
Zur Umsetzung des im Zeitraum von 2004 bis 2006 veröffentlichten Basel-II-Regelwerkes erließ der europäische Gesetzgeber Neufassungen der EU-Bankrechtsrichtlinie sowie der Kapitaladäquanzrichtlinie (Capital Requirements Directive, CRD; sogenanntes CRD-I-Paket) 151 . Die durch Basel II eingeführten Änderungen im Bereich der Bankenregulierung waren umfassend und stellten für die Bankenlandschaft eine entsprechende Herausforderung dar, die zuweilen auch in entsprechender Kritik mündete 152 .
Grundgedanke der Basel-II-Regelungen war freilich die Forderung des Finanzsektors, die Fortschritte in der Quantifizierung und dem Management von Risiken seit Ende der 1980er-Jahre auch im Aufsichtsrecht zu reflektieren. Es wurde den Banken ermöglicht, ihr Mindesteigenmittelerfordernis auf Basis interner Modelle zu berechnen, die vom Aufseher abzunehmen sind. Darüber hinaus wurden die verpflichtenden Mindesteigenmittelvorschriften (Säule 1) um ein aufsichtliches Überprüfungsverfahren zur Berücksichtigung institutsspezifischer Risiken (Säule 2) 153 und um erweiterte Offenlegungsbestimmungen (Säule 3) ergänzt. Soweit die Aufsichtsinstanz bestimmte Risiken nicht (ausreichend) in der Säule 1 abgedeckt sieht, hat sie unter der Säule 2 die Möglichkeit, den Banken eine über dem Mindesterfordernis gemäß Säule 1 liegende Eigenmittelausstattung vorzuschreiben 154 . Dieser Basel-II-Grundsatz ist die Grundlage für die in der EU im Zuge des CRD-I-Pakets eingeführten zusätzlichen Säule-2-Eigenmittelvorschreibungen 155 .
Triebfeder des CRD-I-Pakets war nach wie vor die Erreichung eines integrierten europäischen Marktes für Finanzdienstleistungen und der hierzu erforderliche Abbau der diesem Ziel entgegenstehenden Hindernisse. 156
Mit der Zunahme der Regulierungsaktivitäten der EU vermehrten sich auch ihre Kritiker. Es wurden Stimmen laut, die das – für heutige Begriffe immer noch fragmentarisch anmutende – Regelwerk als überschießend erachteten. So stelle etwa „der unerbittliche Anstieg der Aufsichtsvorschriften … nach Ansicht europäischer und amerikanischer Kreditinstitute das größte bankgeschäftliche Risiko vor allen Marktrisiken dar“. 157 Aufsichtsgremien wurde Überregulierung vorgeworfen, und für die Zukunft wurde eine Trendwende gefordert, da „sich Europa … zur Geisel seines eigenen Harmonisierungsdogmas gemacht“ 158 habe. Dies hatte unter anderem auch damit zu tun, dass Basel II in den einzelnen Jurisdiktionen durchaus unterschiedlich umgesetzt wurde – und zwar sowohl im Hinblick auf die Anzahl der betroffenen Banken 159 als auch in Bezug auf die konkrete Aufsichtspraxis 160 . Zudem waren die heute üblichen breiten Konsultationen sowie Folgenabschätzungsstudien in Hinblick auf Kosten und Nutzen der Regulierung zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gängiger Standard.
Nachdem diese Stimmen bis Mitte der 2000er-Jahre eine bedeutende Anzahl und Lautstärke erreicht hatten, reflektierten sie sich zunehmend auch in entsprechenden Gesetzesinitiativen. Als Antwort wurde von der Europäischen Kommission das Konzept der „Better Regulation“ in den Vordergrund gerückt und sowohl Gold-Plating als auch die Regulierungsdichte als Hindernisse für den Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen erkannt 161 . Bereits die CRD I aus 2004 trug erste zaghafte Anzeichen des auf „Better Regulation“ ausgerichteten Regulierungsansatzes 162 .
In ihrem „Weißbuch zur Finanzdienstleistungspolitik für die Jahre 2005 bis 2010“ 163 wird das Thema „Better Regulation“ demnach auch zu dem Leuchtturmthema der Kommission. Offene und transparente Konsultationen, Folgenabschätzungen, in deren Mittelpunkt Kosten- und Nutzenüberlegungen stehen, strenge Überwachung der Um- und Durchsetzung des EU-Regulierungsrahmens durch die Mitgliedstaaten und seine Behörden, die Ex-post-Bewertung des gesamten FSAP sowie die Vereinfachung und Kodifizierung des Regulierungswerkes sind die hierunter fallenden Schlagworte.
Flankierend dazu sollen die Regulierungs- und Aufsichtsstrukturen unter Berücksichtigung des Lamfalussy-Prozesses angepasst und die Regulierungskosten, wo immer möglich, gesenkt werden 164 . Neben der Kompetenzklärung von Home- und Host-Aufsehern sowie der Minimierung von doppelten Berichtspflichten stand insbesondere auch der Ausbau einer europäischen Aufsichtskultur auf der Agenda der Kommission.
2 Paradigmenwechsel in der Bankenregulierung infolge der Finanzkrise
Mit dem Ausbruch der globalen Finanzkrise 2007 kam es zu einem fundamentalen Richtungswechsel im der Regulierungsdebatte zugrundeliegenden Diskurs. Nicht mehr „Better Regulation“, sondern vielmehr die Fragen, wie eine derartige Krise angesichts des existierenden Regelwerks entstehen konnte und wie die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung deutlich reduziert werden kann, traten in den Vordergrund: Waren in der Vergangenheit die Erwägungsgründe der erlassenen Richtlinien der „Erleichterung der Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute“, dem Abbau „der störendsten Unterschiede zwischen den Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten“ und der „Verwirklichung des Binnenmarktes“ gewidmet 165 , rückten die in der Folge erlassenen Gesetzesvorhaben „…Schritt[e] zur Behebung der durch die Finanzkrise aufgedeckten Mängel“ 166 in den Mittelpunkt.
Im November 2008 beauftragte die Europäische Kommission eine Expertengruppe unter dem Vorsitz von Jaques de Larosière mit der Erstellung von Empfehlungen für einen Weg aus der Krise sowie zur Vermeidung zukünftiger Krisen. In ihrem im Februar 2009 vorgelegten Schlussbericht, dem „De-Larosière-Report“ 167 , werden die Ursachen der Krise analysiert und insgesamt 31 Empfehlungen für die Behebung der Mängel im europäischen Regulierungs- und Aufsichtsrahmen unterbreitet. Diese verfolgen zwei strategische Zielsetzungen: Einerseits sollen die Banken krisenresistenter gemacht und damit die Wahrscheinlichkeit von Bankenkrisen reduziert werden. Andererseits sollte der systemische Schaden von Bankenkrisen möglichst begrenzt und damit deren Kosten für die öffentliche Hand minimiert werden. Dies sollte insbesondere durch – auf EU-Ebene und im Rahmen des Baseler Regelwerks global harmonisierte – verschärfte Eigenmittel- und (erstmals auch) Liquiditätsvorschriften 168 sowie die Etablierung eines Regulierungsrahmens für Krisenintervention und für die Abwicklung für Banken und andere Finanzintermediäre erreicht werden. In institutioneller Hinsicht empfiehlt der „De-Larosière-Report“ die schrittweise Etablierung eines dezentralen Netzwerks zuständiger Aufsichtsbehörden bei gleichzeitiger Harmonisierung von deren Kernaufgaben und -kompetenzen sowie unter Einbeziehung der EZB zur Behandlung makroprudenzieller Risiken. 169
Im September 2009 wurde das CRD-II-Paket 170 verabschiedet, mit dem – neben bereits zuvor und unabhängig vom „De-Larosière-Report“ geplanten Vorhaben 171 – erste Antworten auf die Krise gegeben wurden 172 .
Im November 2010 erließ der europäische Gesetzgeber die CRD III (2010) 173 als weitere Teilantwort auf die Krise 174 sowie die Richtlinien, mit denen die ESAs (EBA, EIOPA und ESMA als Nachfolger der ehemaligen "Level-3-Ausschüsse") 175 sowie der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (European Systemic Risk Board, ESRB) errichtet wurden. Der ESRB, die ESAs und deren Joint Committee bilden zusammen mit den zuständigen Aufsichtsbehörden das Europäische System der Finanzaufsicht (European System of Financial Supervision, ESFS, Grafik 4) 176 . Auch diese Gesetzgebungsakte werden mit den Lehren aus der Krise begründet und im „De-Larosière-Report“ empfohlen. 177 Im Juni 2013 wurde mit der Eigenkapitalverordnung (Capital Requirements Regulation, CRR, 2013) und der CRD IV (2013) die europäische Umsetzung des unter dem Eindruck der Krise grundlegend überarbeiteten Baseler Rahmenwerks (Basel III) 178 verabschiedet, die den durch die Finanzkrise bedingten Paradigmenwechsel auch in der Wahl der gewählten Rechtsetzungsmittel widerspiegelte. Erstmals wurden bankenaufsichtliche Regelungen im Zuge einer Verordnung umgesetzt, um so mittels direkter Anwendbarkeit und unter dem Grundsatz der Maximalharmonisierung eine stärkere Vereinheitlichung des Rechtsrahmens und somit eine verbesserte Angleichung der Wettbewerbsbedingungen für die Geschäftstätigkeit der Banken zu erreichen. Neben der Zweiteilung in eine direkt anwendbare Verordnung 179 sowie eine durch die Mitgliedstaaten umzusetzende Richtlinie 180 stach insbesondere die Fülle an – zum Teil mit ambitionierten Vorlagefristen versehenen – Aufträgen an die EBA ins Auge. Die Verschränkung maximal harmonisierter Grundregeln mit den diese ergänzenden Tätigkeiten der EBA sollte dazu beitragen, das von der Kommission ab 2009 expressis verbis angestrebte Ziel des Single European Rulebooks – also eines einheitlich anzuwendenden Regelwerkes harmonisierter aufsichtlicher Anforderungen an Kreditinstitute 181 – zu verwirklichen. Inhaltliche Neuerungen des CRR/CRD-IV-Paktes stellten insbesondere die Einführung makroprudenzieller Aufsichtsinstrumente und spezifischer Liquiditätsanforderungen sowie einer Verschuldungsquote (diese vorerst lediglich als Meldeverpflichtung) dar. Bereits bestehende Regelungsfelder wurden insbesondere mit der Zielsetzung einer im Hinblick auf die Verlusttragungsfähigkeit und Risikoadäquanz verbesserten Eigenmittelausstattung der Kreditinstitute weiterentwickelt.
Im April 2014 wurden mit Erlass der Einlagensicherungsrichtlinie (Deposit Guarantee System Directive, DGSD) 182 weitere Vorschläge aus dem „De-Larosière-Report“ umgesetzt. Insbesondere wurde die Verpflichtung zur Etablierung eines vom Bankensektor gespeisten Ex-ante-Einlagensicherungsfonds sowie die Möglichkeit zur Verwendung der von den Einlagensicherungen vorgehaltenen Finanzmittel zur Verhinderung des Ausfalls eines Kreditinstituts geschaffen.
Im Mai 2014 wurde mit Erlass der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Banken (Banking Restructuring and Resolution Directive, BRRD) 183 ein weiteres neues Kapitel in der europäischen Bankenregulierung aufgeschlagen. Die BRRD brachte einerseits neue Möglichkeiten der Krisenprävention für die Aufsichtsbehörden, denen im Rahmen der Frühintervention – also bereits zu einem Zeitpunkt, zu dem noch keine akute Krise vorliegt – Möglichkeiten zur Korrektur eingeräumt werden. Daneben schafft die BRRD im Falle des Ausfalles eines Institutes unter bestimmten Voraussetzungen 184 die Möglichkeit für die – mit der Richtlinie neu geschaffene – Abwicklungsbehörde, ausgefallene Kreditinstitute möglichst systemschonend abzuwickeln. Als ein wesentliches Instrument zur Abwicklung wurde die Beteiligung der Gläubiger bei der Verlustabdeckung eingeführt (Bail-In). Zudem wurde ein von Seiten der Banken aufzubauender Abwicklungsfonds eingerichtet. Die Maßnahmen und Instrumente der BRRD sollen sicherstellen, dass hinkünftig möglichst kein Steuergeld mehr für die Rettung von in Schieflage geratenen Instituten aufgewendet werden muss (Bail-Out). Durch dieses Prinzip, den Bail-Out zukünftig durch einen Bail-In zu ersetzen, soll die insbesondere für sehr große Banken bestehende implizite Staatsgarantie („Too-Big-to-Fail“) eliminiert und die mit ihr verbundene Moral-Hazard-Problematik adressiert werden. Die Lehren aus der Krise und die Sicherung der Finanzmarktstabilität dominieren somit auch bei der BRRD die in den Erwägungsgründen zu Tage tretende Motivlage. 185
Als vorerst letzter relevanter Gesetzgebungsakt wurde im Mai 2019 das europäische Bankenpaket, bestehend aus Novellen des derzeitigen Regelwerkes – woraus die Bezeichnungen CRR II (2019), CRD V (2019), BRRD II (2019) resultieren – verabschiedet. Mit diesem geht eine Fülle von Neuerungen einher 186 , wobei in den Erwägungsgründen die aus der Krise gezogenen Lehren neuerlich einen zentralen Platz einnehmen 187 . Die Stärkung der Finanzmarktstabilität, die vorherrschende unsichere wirtschaftliche Aussicht, die Implementierung international vereinbarter Standards und gezielte Deregulierungsmaßnahmen durch proportionale Anwendung von Aufsichtsanforderungen werden als weitere Triebfedern der Gesetzesinitiative genannt. 188
Durch den Umfang und die Komplexität der seit der Finanzkrise erlassenen Regelungen, sowohl in Form des Primärrechts als auch nachgelagerter verpflichtender technischer Standards, kam es in den letzten Jahren zu einer Debatte über die Notwendigkeit eines proportionalen Aufsichtsansatzes. 189 Insbesondere das Bankenpaket von 2019 stellte diesbezüglich einen wesentlichen Schritt dar. Erstmals wurde eine Kategorie kleiner, wenig komplexer Banken eingeführt, für die bestimmte Regelungen, etwa im Bereich Vergütung oder Offenlegung nicht oder nur teilweise anwendbar sind.
3 Gründung der Bankenunion als Reaktion auf die Staatsschuldenkrise
Die Diskussionen über die aus einem integrierten Finanzmarkt resultierende Notwendigkeit eines grenzüberschreitend zuständigen Aufsehers wurden bereits seit langer Zeit geführt. Insbesondere mit Einführung des Euro wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit eine Währungsunion zur Entfaltung ihres vollen Potenzials auch einer Bankenunion im Sinne einer einheitlichen Bankenaufsicht bedarf. So wies beispielsweise der Internationale Währungsfonds (IWF) bereits 1998 auf mögliche Probleme bei der Bewältigung einer Bankenkrise im damaligen institutionellen Rahmen des Euroraums hin, und auch die EZB forderte eine gemeinsame Bankenaufsicht für den Euroraum. 190 Auch über den Euroraum hinaus gab es zahlreiche weitere Vorschläge, die nationalen Aufsichten von grenzüberschreitend tätigen Banken in der EU stärker zu koordinieren. Unterschiedliche Konzepte – vom für eine grenzüberschreitende Gruppe zuständigen Lead Supervisor 191 bis zum umfassend zuständigen Allfinanzaufseher 192 – wurden in die Diskussion eingebracht, wobei die grundsätzlich bestehende Problematik – nämlich national beschränkte örtliche Zuständigkeit und Verantwortung für grenzüberschreitend tätige Institute – allgemein anerkannt war 193 . So legte der IWF noch vor Ausbruch der Finanzkrise einen Vorschlag für eine europäische Bankenaufsicht vor, der zwei identifizierte Probleme lösen sollte: das Fehlen einheitlicher Voraussetzungen für die Geschäftstätigkeit und Fragen der grenzüberschreitenden Finanzstabilität. 194 Aus heutiger Sicht stellte insbesondere die Schaffung der Aufsichtskollegien 195 durch die CRD II einen wesentlichen Schritt dar und kann als eine erste Lehre aus der Krise angesehen werden.
Auswirkung der EU-Vorgaben auf die österreichische Bankenregulierung
Aus Anlass der Verpflichtung Österreichs zur Übernahme des Acquis Communautaire in den nationalen Rechtsbestand wurde das seinerzeitige Kreditwesengesetz (KWG) am 1. Jänner 1994 durch das Bankwesengesetz (BWG) abgelöst. Neben der Übernahme des europäischen Rechtsbestandes wurden zahlreiche Rechtsbereinigungen vorgenommen, sodass insgesamt eine grundlegende Neufassung des österreichischen Bankenaufsichtsrechtes resultierte. Die anschließenden europäischen Weiterentwicklungen wurden in Österreich vorrangig über entsprechende Novellen des BWG bzw. der auf Basis entsprechender Ermächtigungen im BWG erlassenen Verordnungen umgesetzt (so waren vor Inkrafttreten der CRR rund 20 auf Ermächtigungen des BWG beruhende Verordnungen in Kraft).
Im Rahmen der Umsetzung der BRRD entschied sich der österreichische Gesetzgeber dazu, diese in einem gesonderten Gesetz – dem Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (BaSAG) – umzusetzen.
Die Umsetzung der DGSD wurde ebenfalls in einem eigenen Gesetz – dem Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (ESAEG) – vorgenommen und die bis dahin im BWG geregelten Bereiche der Einlagensicherung und Anlegerentschädigung bei Kreditinstituten in diesem einer Neuregelung zugeführt (Grafik 5). Ende Kasten 1.
Dennoch benötigte es die europäische Staatsschuldenkrise als letzten Anstoß für die Errichtung der Bankenunion. Im Rahmen des EU-Gipfels im Juni 2012 beschlossen die Staats- und Regierungschefs der Union die Errichtung eines einheitlichen Aufsichtsmechanismus unter Einbeziehung der EZB als Voraussetzung für die Möglichkeit zur direkten Rekapitalisierung von Banken durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus (European Stability Mechanism, ESM). Sie beauftragten die Kommission mit der Präsentation eines geeigneten Aufsichtsmechanismus. Im März 2013 erzielten Europäische Kommission, Parlament und Rat schließlich eine Einigung zur Errichtung des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism, SSM) 196 , im März 2014 zur Errichtung des Einheitlichen Abwicklungsmechanismus (Single Resolution Mechanism, SRM) 197 . Im November 2015 legte die Kommission einen Vorschlag zur Vollendung der Bankenunion inklusive eines Legislativvorschlags für die Errichtung einer einheitlichen Einlagensicherung (European Deposit Insurance System, EDIS) 198 vor, über den bislang jedoch nach wie vor kein Kompromiss erzielt werden konnte. SSM, SRM und EDIS stellen die drei Säulen der Bankenunion im Euroraum dar. Wesentlich für die Bankenunion im Sinne einheitlicher Geschäftsvoraussetzungen in der gesamten EU ist dabei die Möglichkeit von EU-Mitgliedstaaten, ohne Angehörigkeit zum Euroraum der europäischen Bankenunion beizutreten. Während diese sogenannte „enge Zusammenarbeit“ in den Anfangsjahren des SSM wenig Bedeutung erlangte, stellten jüngst sowohl Bulgarien (2018) als auch Kroatien (2019) einen Beitrittsantrag. In Schweden hat das Finanzministerium 2019 eine Analyse über die Auswirkungen eines potenziellen Beitritts Schwedens zur Bankenunion veröffentlicht 199 , und auch in Dänemark gibt es dazu Überlegungen 200 .
Bereits vor Errichtung des SSM war die EZB über den Ausschuss für Bankenaufsicht (Banking Supervision Committee, BSC) 201 regelmäßig mit den nationalen Aufsichtsbehörden in Kontakt. Das BSC beriet zu Aspekten, die im gemeinsamen Interesse sowohl der EZB als auch nationaler Aufsichtsbehörden lagen, und führte Studien zu den nationalen Finanzsystemen durch. Die operative Einbindung der EZB in die Bankenaufsicht erfolgte jedoch erst mit der Errichtung des SSM, in dessen Rahmen die EZB seit November 2014 die operative Aufsicht über die rund 120 „bedeutenden Kreditinstitute“ 202 des Euroraums unter Mitwirkung der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten ausübt. Die Aufsicht über „weniger bedeutende Kreditinstitute“ wird von den jeweils zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden ausgeübt, wobei die EZB in erster Linie die Verantwortung für die wirksame und einheitliche Funktionsweise des SSM trägt. Auch in den Mitgliedstaaten haben die aus der Finanzkrise gezogenen Lehren aus institutioneller Sicht dazu geführt, dass Zentralbanken stärker in die Bankenaufsicht einbezogen wurden. So wurde in Belgien, in Irland und im Vereinigten Königreich die Bankenaufsicht in die Zentralbank rücküberführt, in Luxemburg wurde sie mit der Liquiditätsaufsicht betraut. Im Jahr 2020 ist somit in 16 von 19 Ländern des Euroraums die Notenbank im Rahmen der nationalen Zuständigkeitsverteilung in die Bankenaufsicht eingebunden. 203
Die zweite Säule der Bankenunion, der SRM, nahm seine Arbeit am 1. Jänner 2015 auf. Ähnlich dem SSM, handelt es sich hierbei um ein System der Zusammenarbeit zwischen einem zentral zuständigen Abwicklungsausschuss – dem neu geschaffenen Einheitlichen Abwicklungsausschuss (Single Resolution Board, SRB) – und den nationalen Abwicklungsbehörden, der durch einen einheitlichen Abwicklungsfonds unterstützt wird. Die Zuständigkeitsverteilung zwischen dem SRB und den nationalen Abwicklungsbehörden, insbesondere auch hinsichtlich der direkt dem SRB unterstehenden Banken, deckt sich größtenteils mit jener des SSM.
Für die dritte Säule der Bankenunion, der Einlagensicherung (EDIS) sah die Kommission in ihrem Legislativvorschlag eine Einführung in drei Stufen vor. In der ersten Phase der Rückversicherung würden die Risiken weitgehend auf nationaler Ebene verbleiben und vergemeinschaftete Mittel erst nach Ausschöpfung der national verfügbaren Mittel – und in begrenztem Ausmaß – ausgeschüttet werden. Ab der zweiten Phase (Mitversicherung) würde es zu einer gemeinschaftlichen Verlusttragung kommen, wobei der seitens EDIS beigesteuerte Teil jährlich graduell zunehmen würde. Phase 3 würde die vollständige Vergemeinschaftung der Verlusttragung darstellen. 204
Die Verhandlungen über die konkrete Ausgestaltung von EDIS – insbesondere über den Grad der Vergemeinschaftung von Verlusten – verlaufen seit der Veröffentlichung des Legislativvorschlages der Kommission schleppend. Verschiedenste Modelle, insbesondere im Hinblick auf die ersten beiden Phasen, sowie die Voraussetzungen für die Übergänge zur jeweils anschließenden Phase wurden angedacht und diskutiert. Am Euro-Gipfel am 13. Dezember 2019 wurde die Eurogruppe beauftragt, weiter an allen Elementen zur Stärkung der Bankenunion zu arbeiten 205 – die konkrete Ausgestaltung von EDIS steht jedoch ebenso wie der konkrete Zeitplan zu seiner Implementierung noch nicht fest.
4 Schlussfolgerungen
An den Entwicklungen der letzten 25 Jahre in der Bankenregulierung und -aufsicht ist gut erkennbar, dass Motive und Ziele der Rechtsetzung in diesem Bereich im Zeitverlauf unterschiedlich gewichtet waren. Zum Zeitpunkt der Verfassung des „Segré-Berichts“ (1966) waren die vorherrschenden Regelungen in den seinerzeitigen Mitgliedstaaten noch von den Nachwehen der Weltwirtschaftskrise in der Zwischenkriegszeit geprägt. Die von 1970 bis Mitte der 2000er-Jahre vorherrschende Regulierungspraxis zielte vorrangig auf eine Harmonisierung zur Herstellung einheitlicher Bedingungen für die Geschäftstätigkeit der Banken, zur Vollendung eines Binnenmarktes für Finanzdienstleistungen sowie auf die Umsetzung international etablierter Aufsichtsstandards ab. Insbesondere in den 2000er-Jahren erfuhr auch das Thema der richtigen Balance in der Regulierungsintensität unter dem Schlagwort „Better Regulation“ verstärkt Berücksichtigung.
Mit Ausbruch der Finanzkrise 2007 hat sich die Gewichtung der Zielvorgaben neuerlich maßgeblich verlagert, jedoch ohne zu einer völligen Absage gegenüber zuvor verfolgten Zielen zu führen. Die Sicherung der Finanzmarktstabilität, die Minderung von Risiken und die Entlastung der öffentlichen Hand in Krisenfällen rückten ins Zentrum. Dabei wurden jedoch sowohl der Level-Playing-Field-Ansatz (Angleichung der regulatorischen und aufsichtlichen Bedingungen für die Geschäftstätigkeit der Banken in den verschiedenen Mitgliedstaaten) als auch der Better-Regulation-Ansatz nach wie vor weiterverfolgt wurden. Von Letzterem zeugt auch die Diskussion um eine proportionale Anwendung des Single Rulebook in den vergangenen Jahren, die auch im Bankenpaket 2019 ihren Niederschlag gefunden hat.
Nicht nur die Zielsetzungen, auch die legistische Herangehensweise an die Bankenregulierung haben sich im Zeitablauf verändert. Während zu Beginn mit tendenziell fragmentierten europarechtlichen Normierungen in Einzelbereichen gearbeitet wurde, wurde mit der EU-Bankrechtsrichtlinie (Banking Consolidation Directive, BCD) im Jahr 2000 sowie mit der nachfolgenden Kapitaladäquanzrichtlinie (sogenanntes CRD-I-Paket) ein verstärkt gesamthafter Ansatz verfolgt. Dieser wurde in weiterer Folge zudem von einer großen Zahl an Mandaten für technische Arbeiten durch die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) begleitet. 2013 folgte im Sinne des einheitlichen Binnenmarktes die Umsetzung bankenaufsichtlicher Normen mit einer in allen Mitgliedstaaten direkt anwendbaren Verordnung.
Auch institutionell entwickelte sich der europäische Aufsichtsrahmen weiter, wobei wesentliche Veränderungen kriseninduziert waren. Hier sind insbesondere die Schaffung des Europäische Finanzaufsichtssystem (European System of Financial Supervisors, ESFS) und die Gründung der ersten beiden Säulen der Bankenunion mit dem Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism, SSM) sowie dem Einheitlichen Bankenabwicklungsmechanismus (Single Resolution Mechanism, SRB) zu nennen. Daneben hat der verstärkte Fokus auf makroprudenzielle Aspekte der Aufsicht und die Krisenbewältigung zu einer stärkeren Einbindung der Notenbanken in die Bankenaufsicht geführt, die sich auch in der Übertragung der Verantwortung für die Beaufsichtigung der Kreditinstitute des Euroraumes auf die EZB widerspiegelt.
Aus inhaltlicher Perspektive hat sowohl der Umfang als auch die Komplexität des Regelwerks markant zugenommen. Dies ist einerseits auf einen notwendigen Lückenschluss in den aufsichtlichen Regeln infolge der Finanzkrise zurückzuführen. Andererseits ist ein Teil der Ausweitung des Regelwerks auch durch die Berücksichtigung nationaler Ausnahmen im Zuge der Umsetzung internationaler Standards in europäisches Recht bedingt. Eine Komplexitätsreduktion darf im Lichte der Erfahrungen der Finanzkrise daher nicht über eine Rücknahme inhaltlich wichtiger und stabilitätsfördernder Regelungen erfolgen, sondern durch die gezielte Anwendung von mehr Proportionalität sowie den Abbau historisch gewachsener, überwiegend nationaler Ausnahmeregelungen im Sinne eines einheitlichen und konsistenten Regelwerks für die gesamte EU, dem Single European Rulebook.
Literaturverzeichnis
Angeloni, I. 2018. Another look at proportionality in banking supervision. Speech delivered on February 28. https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2018/html/ssm. sp180228.en.html.
Bärenfänger, J., A. Pfingsten und M. Ricke. 2006. Wirken die neuen Baseler Eigenkapitalvorschriften (Basel II) krisenverstärkend? In: ÖBA – Österreichisches Bankenarchiv. 2006. 397ff.
BCBS. 1988. Basel Committee on Banking Supervision. International convergence of capital measurement and capital standards (Basel I).
BCBS. 2004. Basel Committee on Banking Supervision. (Basel II). Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework.
BCBS. 2006. Basel Committee on Banking Supervision. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework – Comprehensive Version.
BCBS. 2011. Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems.
BCD. 2000. Richtlinie 2000/12/EG über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (Banking Consolidation Directive).
BID. 2001. Richtlinie 2001/24/EG über die Sanierung und Liquidation von Kreditinstituten (Banking Insolvency Directive).
Boss, M., G. Lederer, N. Mujic und M. Schwaiger. 2018. Proportionality in banking regulation. In: Monetary Policy & the Economy. Q2/18. 51–70.
BRRD I. 2014. Richtlinie 2014/59/EU zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen.
BRRD II. 2014. Richtlinie (EU) 2019/879 zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU in Bezug auf die Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und der Richtlinie 98/26/EG.
Castro Carvalho, A., S. Hohl, R. Raskopf and S. Ruhnau. 2017. Proportionality in banking regulation: a cross-country comparison. In: FSI Policy Implementation Insight 1. Financial Stability Institute. https://www.bis.org/fsi/publ/insights1.pdf.
Čihák, M. and J. Decressin. 2007. The Case for a European Banking Charter. In: IMF Working Paper, WP/07/173. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/The-Case-for-a-European-Banking-Charter-21158.
Christl, J. 2005. Zur Europäischen Aufsichtsfrage – Ist die Zentralisierung eine sinnvolle Antwort? In: ÖBA – Österreichisches Bankenarchiv. 2005. 71ff.
CRD I. 2006a. Richtlinie 2006/48/EG über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (Neufassung).
CRD I. 2006b. Richtlinie 2006/49/EG über die angemessene Eigenkapitalausstattung von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten (Neufassung).
CRD II. 2009a. Richtlinie 2009/111/EG zur Änderung der Richtlinien 2006/48/EG, 2006/49/EG und 2007/64/EG hinsichtlich Zentralorganisationen zugeordneter Banken, bestimmter Eigenmittelbestandteile, Großkredite, Aufsichtsregelungen und Krisenmanagement (Text von Bedeutung für den EWR).
CRD II. 2009b. Richtlinie 2009/27/EG zur Änderung bestimmter Anhänge der Richtlinie 2006/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich technischer Vorschriften für das Risikomanagement.
CRD II. 2009c. Richtlinie 2009/83/EG zur Änderung bestimmter Anhänge der Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates mit technischen Bestimmungen über das Risikomanagement.
CRD III. 2010. Richtlinie 2010/76/EU zur Änderung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG im Hinblick auf die Eigenkapitalanforderungen für Handelsbuch und Wiederverbriefungen und im Hinblick auf die aufsichtliche Überprüfung der Vergütungspolitik.
CRD IV. 2013. Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen.
CRD V. 2019. Richtlinie (EU) 2019/878 zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf von der Anwendung ausgenommene Unternehmen, Finanzholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften, Vergütung, Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse und Kapitalerhaltungsmaßnahmen.
CRR I. 2013. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen.
CRR II. 2019. Verordnung (EU) 2019/876 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und der Verordnung (EU) Nr. 648/2012.
Danish Ministry for Industry, Business and Financial Affairs. 2019. Report from the Working Group on possible Danish Participation in the Banking Union. https://eng.em.dk/news/2019/december/report-from-the-working-group-on-possible-danish-participation-in-the-banking-union/.
DGSD. 2014. Richtlinie 2014/49/EU über Einlagensicherungssysteme.
De Rynck, S. 2016. Banking on a union: the politics of changing eurozone banking supervision. In: Journal of European Public Policy 23(1). 119–135. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13501763.2015.1019551?needAccess=true.
Euro-Gruppe. 2012. Gipfelerklärung der Mitglieder des Euro-Währungsgebiets https://www.consilium.europa.eu/media/21383/20120629-euro-area-summit-statement-de.pdf.
Europäische Kommission. 1999. Aktionsplan für Finanzdienstleistungen.
Europäische Kommission. 2005a. Grünbuch zur Finanzdienstleistungspolitik 2005 bis 2010.
Europäische Kommission. 2005b. Weißbuch – Weißbuch zur Finanzdienstleistungspolitik für die Jahre 2005–2010.
Europäische Kommission. 2015a. Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zur Vollendung der Bankenunion“.
Europäische Kommission. 2015b. Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 im Hinblick auf die Schaffung eines europäischen Einlagenversicherungssystems.
ESAR. 2010. Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission.
ESRBR. 2010. Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 über die Finanzaufsicht der Europäischen Union auf Makroebene und zur Errichtung eines Europäischen Ausschusses für Systemrisiken.
Government Offices of Sweden. 2019. Sverige och bankunionen, English Summary of SOU 2019.52. https://www.government.se/legal-documents/2019/12/sweden-and-the-banking-union---summary/
Hlawati E. und M. Calice. 1994. Das Bankwesengesetz. In: ecolex 1994. 270ff.
Holzinger G. 1992 EG-Beitritt und Rechtsangleichung. In: NZ 1992. 177ff.
International Monetary Fund.1998. International Capital Markets: Developments, Prospects, and Key Policy Issues. https://www.imf.org/external/pubs/ft/icm/icm98/.
Jansen, S. 2002. Auswirkungen von Basel II auf Kreditinstitute und Mittelstand. In: ÖBA – Österreichisches Bankenarchiv. 2002, 787ff.
Karpf, A., C. Weidinger-Sosdean and K. Zartl. 2007. Die Integration der Finanzmärkte der EU – Die Rolle von CESR, CEBS und CEIOPS im Lamfalussy-Prozess. In: ZFR 2007, 3. https://lesen.lexisnexis.at/_/die-integration-der-finanzmaerkte-der-eu-die-rolle-von-cesr-cebs/artikel/zfr/2007/1/ZFR_2007_01_0003.html
Lamfalussy, A., C. Herkströter, L. Rojo, B. Ryden, L. Spaventa, N. Walter and N. Wicks. 2001. Final Report of the Committee of Wise Men on the Regulation of European Securities Markets. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/lamfalussy_report.pdf.
Ladler, M.P. 2014. Finanzmarkt und institutionelle Finanzaufsicht in der EU.
Lembeck, E. D. 2009. Von Basel II zur CRD II: Zur Änderung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG. In: ZFR 2009/139. https://lesen.lexisnexis.at/_/von-basel-ii-zur-crd-ii-zur-aenderung-der-richtlinien-200648eg-u/artikel/zfr/2009/6/ZFR_2009_06_139.html.
McCreevy C. 2005. Rede von Charlie McCreevy, European Commissioner for Internal Market and Services, Exchange of Views on Financial Services Policy 2005–2010. Brussels, 18 July 2005. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_05_448.
Nowotny, E. 2019. Bedeutung einer zweigeteilten Bankenaufsicht für die Finanzstabilität. In Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (ZfgK), Ausgabe vom 12.07.2019, 688ff.
Padoa-Schioppa, T. 1999. EMU and banking supervision. Speech delivered on 24 February. https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/1999/html/sp990224.en.html.
Pichler H. 2005. Kosten und Nutzen von Regulierungen. In: ÖBA – Österreichisches Bankenarchiv 2005, 739.
Pisani-Ferry, J., A. Sapir, N. Véron and G. B. Wolff. 2012. What kind of European banking union? In: Bruegel Policy Contribution. 2012/12. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/72098/1/718461290.pdf.
Putz, T. 2006. Basel II-Implementierung: Synergien im Risiko- und Finanzbereich relativieren die Kosten. In: ÖBA – Österreichisches Bankenarchiv 2006. 258ff.
Schackmann-Fallis, K.-P. 2007. Auswirkungen der Post-FSAP-Maßnahmen. Der Regulierungswettbewerb der Zukunft wird ein Deregulierungswettbewerb sein. In: ÖBA – Österreichisches Bankenarchiv 2007. 6ff.
Segré-Group. 1966. Kommission (EWG). Der Aufbau eines Europäischen Kapitalmarktes (Segré-Bericht). Brüssel 1966. http://aei.pitt.edu/31823/1/Dev_Eur_Cap_Mkt_1966.pdf
SSMR. 2013. Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 zur Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank.
SRMR I. 2014. Verordnung (EU) Nr. 806/2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010.
SRMR II. 2019. Verordnung (EU) 2019/877 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 in Bezug auf die Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen.
The de Larosière Group. 2009. The high-level group of financial supervision in the EU, Report. https://ec.europa.eu/info/system/files/de_larosiere_report_en.pdf.
Tumpel-Gugerell, G. 1999. Die neuen Eigenkapitalbestimmungen und ihre Auswirkungen auf das österreichische Kreditwesen aus der Sicht der OeNB. In: ÖBA – Österreichisches Bankenarchiv 1999. 931ff. https://360.lexisnexis.at/d/artikel/die_neuen_eigenkapitalbestimmungen_und_ihre_auswir/z_o_ba_1999_12_oeba_1999_ausg12_931_eedc1505e0?origin=rl.
Weismann, P. 2011. Die neue EU-Finanzmarktaufsicht – Kann sie künftige Krisen verhindern? In: ÖBA – Österreichisches Bankenarchiv 2011. 807ff. https://360.lexisnexis.at/d/artikel/die_neue_eu_finanzmarktaufsicht_kann_sie_kunftige/z_o_ba_2011_11_oeba_2011_11_0807_7d5a22f487?origin=rl.
133 Oesterreichische Nationalbank, Abteilung Europäische Aufsichtsgrundsätze und Strategie, michael.boss@oenb.at; michael.kaden@oenb.at; markus.schwaiger@oenb.at. Die von den Autoren in diesem Beitrag zum Ausdruck gebrachte Meinung gibt nicht notwendigerweise die Meinung der Oesterreichischen Nationalbank oder des Eurosystems wieder. Die Autoren danken Ernest Gnan und Karin Turner-Hrdlicka (beide Oesterreichische Nationalbank) für hilfreiche Kommentare und für wertvolle Diskussionsbeiträge.
134 Unter dem Begriff Acquis Communautaire (gemeinschaftlicher Besitzstand) versteht man sämtliche geltende Rechtsvorschriften in der EU, die für alle Mitgliedstaaten verbindlich sind. Er besteht aus dem Primärrecht der EU-Verträge, dem Sekundärrecht (sämtliche EU-Rechtsakte wie Verordnungen und Richtlinien) und den Urteilen des Europäischen Gerichtshofes sowie allen internationalen Verträgen über Angelegenheiten der EU. Um Mitglied der EU zu werden, sind beitrittswillige Staaten verpflichtet, den Acquis Communautaire anzunehmen und den gemeinschaftlichen Rechtsbesitzstand vorab in nationales Recht umzusetzen und ihn nach dem Beitritt anzuwenden (vgl. https://www.parlament.gv.at/PERK/GL/EU/).
135 Aufgrund der aus dem ab 1. Jänner 1994 in Kraft getretenen EWR-Abkommen resultierenden Verpflichtungen war der Acquis Communautaire seitens der Republik Österreich tatsächlich bereits ein Jahr vor dem (dann am 1. Jänner 1995 erfolgten) Beitritt zur EU zu implementieren.
136 Holzinger 1992, S. 177.
137 Hlawati et al. 1994, S. 270.
138 Segré-Group 1966.
139 So wird insbesondere eine Harmonisierung der Vorschriften zur Zusammensetzung von Aktiva und Passiva sowie zu den Beteiligungsregeln vorgeschlagen.
140 “In most countries the present arrangements concerning the working and supervision of banks date from measures taken to palliate the effects of the great economic crisis of the inter-war period”, Segré-Group (1966) S. 269 ff.
141 Der Baseler Ausschuss legte dabei erstmals global koordinierte Mindesterfordernisse für das Eigenkapital von Banken auf Basis risikogewichteter Aktiva und (je nach Risiko der betreffenden Aktiva) abgestufter Risikogewichte fest (siehe BCBS 1988).
142 Europäische Kommission 1999. Folgende Zitate aus ebenda.
143 Die Verhandlungen zur Überarbeitung des Basel-I-Rahmenwerkes gemäß BCBS (1988) wurden 1999 aufgenommen und schlussendlich ab 2004 als Basel-II-Rahmenwerk veröffentlicht (siehe BCBS, 2004 und 2006). Zu den wesentlichen Änderungen durch Basel II siehe Kapitel 2.
144 Die in weiterer Folge am 4. April 2001 erlassen wurde. Siehe BID, 2001.
145 Karpf et al., 2007, S. 6.
146 Lamfalussy et al., 2001.
147 Namentlich des Ausschusses der Europäischen Bankaufsichtsbehörden (Committee of European Banking Supervisors, CEBS), des Ausschusses der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, CEIOPS) sowie des Ausschusses der Europäischen Wertpapierregulierungsbehörden (Committee of European Securities Regulators, CESR). Für eine detaillierte Darstellung siehe Karpf et al. 2007.
148 Bestehend aus den Nachfolgeorganisationen der in Fußnote 15 genannten Ausschüsse, der European Banking Authority (EBA), der European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) und der European Securities and Markets Authority (ESMA). Diese wurden als unabhängige Behörden mit eigener Rechtspersönlichkeit eingerichtet und mit weitreichenderen Befugnissen als ihre Vorgängerausschüsse ausgestattet. Siehe auch Kapitel 2. Für eine detailliertere Darstellung siehe beispielsweise Ladler, 2014, S. 185ff.
149 Und zwar im Wege verbindlicher technischer Standards, wobei die ESAs selbst keine Rechtsetzungsbefugnis haben, sodass diese lediglich Entwürfe technischer Standards erarbeiten, die in weiterer Folge von der europäischen Kommission erlassen werden. Vgl. hierzu z. B. Art 10ff ESAR, 2010.
150 Siehe Kapitel 2.
151 CRD I, 2006a und CRD I, 2006b.
152 Siehe etwa Putz, 2006; Jansen, 2002 oder Bärenfänger et al., 2006 für eine umfangreichere Darstellung.
153 Bestehend aus einem internen Kapitaladäquanzverfahren (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) und dem aufsichtlichen Überprüfungs- und Evaluierungsverfahren (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).
154 Vgl. BCBS, 2006, S. 239, Grundsatz 3 der aufsichtlichen Überprüfung
155 Vgl. Art 136, CRD I, 2006a.
156 Vgl. etwa Erwägungsgrund 2 der CRD I, 2006a.
157 Vgl. Pichler (2005) der seinerseits eine nicht näher genannte PriceWaterhouse-Studie zitiert.
158 Schackmann-Fallis 2007, S. 9.
159 Während in der EU aus Level-Playing-Field-Gründen die Baseler Vorschriften für alle Banken umgesetzt wurden, war dies in den USA beispielsweise nur für Großbanken der Fall, auch weil dort bereits vor Basel II zusätzliche Eigenmittelerfordernisse (Leverage Ratio, Kapitalpuffer) außerhalb des Baseler Rahmenwerks für alle Kreditinstitute verpflichtend einzuhalten waren.
160 So kennen etwa die USA oder Japan keine der in der EU üblichen Säule-2-Eigenmittelvorschreibungen für Banken.
161 Vergleiche etwa die Rede von Charlie McCreevy, European Commissioner for Internal Market and Services, McCreevy (2005).
162 Neben zahlreichen der Kommission eingeräumten, im Komitologieverfahren mit CEBS zu erarbeitenden, Durchführungsbefugnissen wird die Kommission an mehreren Stellen zur Erstellung eines Berichtes über die Anwendung bestimmter Vorschriften verpflichtet. Zu einigen Regelungsbereichen wird die Kommission zur Vorlage von Änderungsvorschlägen auf Basis von Fortschrittsberichten der Mitgliedstaaten verpflichtet und letztendlich auch zur Berichterstattung über die Anwendung des gesamten Regelwerkes und seiner Auswirkung auf den Konjunkturzyklus. Siehe dazu z. B. Art 150 CRD I (2006a) sowie Art 41 CRD I (2006b) und Art 119 CRD I (2006a) sowie Art 28 CRD I (2006b), zudem Art 62 CRD I (2006a) und Art 12 CRD I (2006b), sowie Art 51 CRD I (2006b) und Art 156 CRD I (2006a).
163 Europäische Kommission, 2005b.
164 Europäische Kommission, 2005b, S. 10.
165 Erwägungsgründe 2 CRD I (2006b) und 4 der BCD (2000)
166 Vgl. erster Erwägungsgrund CRD II (2009a).
167 The de Larosière Group, 2009.
168 Vgl. dazu sowie zu weiteren Empfehlungen zu verschärften Regelungen in der Bankenaufsicht deren konkrete Umsetzung gemäß Fußnoten 49, 50, 61 und 62.
169 Die im Folgenden in diesem Abschnitt beschriebenen Änderungen des europäischen Regulierungs- und Aufsichtsrahmens beruhen ausnahmslos auf dem „De-Larosière-Report“, womit der überwiegende Teil der Vorschläge umgesetzt wurde.
170 CRD II (2009a), CRD II (2009b) und CRD II (2009c).
171 Wie etwa zu Großkrediten oder hybriden Finanzinstrumenten, vgl. Lembeck (2009).
172 Schwerpunkte der CRD II bildeten insbesondere die Überarbeitung des Großveranlagungsregimes, die Stärkung der grenzüberschreitenden Aufsicht, die Festlegung strengerer Anforderungen für die Verwendung verbriefter Produkte sowie die Festlegung einheitlicher Kriterien für die Anerkennung hybrider Finanzinstrumente als Eigenmittel.
173 Schwerpunkt der CRD III (2010) bildeten die Einführung von Regeln für die Vergütungspraktiken, erhöhte Eigenkapitalanforderungen für verbriefte Forderungen im Handelsbuch, erhöhte Risikogewichte für Wiederverbriefungen und erweiterte Offenlegungsbestimmungen und die Gewährleistung wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender finanzielle und nicht-finanzieller Sanktionen- und Maßnahmenmöglichkeiten der Behörden.
174 „Die übermäßige und unvorsichtige Übernahme von Risiken im Bankensektor hat in den Mitgliedstaaten und weltweit zum Ausfall einzelner Finanzinstitute und zu Systemproblemen geführt.“, Erwägungsgrund 1, 1. Satz, CRD III (2010).
175 Vgl. Seite 5, insbesondere Fußnoten 15 und 16.
176 Für Details zu den Aufgaben und Zielen des EFSF, des ESRB sowie der ESAs siehe Weismann (2011).
177 „Die Finanzmarktstabilität ist eine unerlässliche Voraussetzung für die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Bereitstellung von Krediten und das Erzeugen von Wachstum in der Realwirtschaft. Die Finanzkrise hat erhebliche Mängel bei der Finanzaufsicht offenbart, die es versäumt hat, nachteilige Entwicklungen auf der Makroebene vorherzusehen und die Häufung unvertretbar hoher Risiken im Finanzsystem zu verhindern.“ Siehe Erwägungsgrund 1 der ESRBR, 2010.
178 BCBS, 2011.
179 In der CRR I (2013) werden insbesondere die verschärften Regelungen zur Qualität der Eigenmittel, zum Mindesteigenmittelerfordernis, zu den Liquiditätsanforderungen, zur Leverage Ratio, zur Offenlegung sowie das Großkreditregime festgeschrieben.
180 In der CRD IV (2013) finden sich insbesondere die Regelungen zur Konzession, zur grenzüberschreitenden Tätigkeit, zu den Instrumenten der Aufsicht, zu den makroprudenziellen Instrumenten, zur Corporate Governance sowie zur Säule 2.
181 Siehe https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook.
182 DGSD, 2014.
183 BRRD I, 2014.
184 Insbesondere bei Vorliegen eines entsprechenden öffentlichen Interesses.
185 Vgl. hierzu die ersten drei Erwägungsgründe der BRRD I (2014).
186 Diese Maßnahmen umfassen u. a. verbindliche Vorgaben zur Verschuldungsquote (Leverage Ratio, LR) und zur Strukturellen Liquiditätsquote (Net Stable Funding Ratio, NSFR), Einführung gezielter Vereinfachungen für kleine nicht-komplexe Institute (Proportionalität), Nachschärfung der Regelungen zur Anrechenbarkeit von Eigenmitteln, Etablierung der Säule-2-Guidance, Überarbeitung des Zusammenspiels von Säule 2 und makroprudenziellen Instrumenten, Nachschärfungen zu den Anforderungen im Zusammenhang mit dem Handelsbuch, Überarbeitung der Berechnungsgrundlagen für den Mindestbetrag an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities, MREL), etc.
187 “(1) Im Zuge der Finanzkrise, die 2007/2008 ihren Anfang nahm, hat die Union eine grundlegende Reform des Regulierungsrahmens für Finanzdienstleistungen durchgeführt, mit der die Widerstandsfähigkeit der im Finanzsektor tätigen Institute gestärkt werden soll…(2) Auch wenn die Reform das Finanzsystem stabiler und widerstandsfähiger gegen vielerlei mögliche künftige Schocks und Krisen gemacht hat, wurden damit doch nicht alle festgestellten Probleme angegangen…(3) In ihrer Mitteilung vom 24. November 2015 „Auf dem Weg zur Vollendung der Bankenunion“ hat die Kommission anerkannt, dass eine weitere Risikominderung erforderlich ist, und sich dazu verpflichtet, einen Gesetzgebungsvorschlag vorzulegen, der sich auf international vereinbarte Standards stützt.“, Erwägungsgründe 1–3, CRR II (2019).
188 Vgl. Erwägungsgründe 4–8, CRR II (2019).
189 Siehe Angeloni 2018, Boss et al. 2018, bzw. Castro Carvalho et al. 2017.
190 Siehe International Monetary Fund (1998, S. 106), Padoa-Schioppa (1999) sowie de Rynck (2016) für einen breiteren Überblick dieser Diskussion.
191 Siehe. z. B. Christl, 2005.
192 Siehe z. B. Čihák et. al., 2007.
193 Vgl. für viele z.B. Pisani-Ferry et al. (2012).
194 Čihák et. al. (2007).
195 Bei einem Aufsichtskollegium handelt es sich im Wesentlichen um ein Gremium bestehend aus Aufsehern der zuständigen Behörden aus dem Herkunfts- und dem Aufnahmestaat einer grenzüberschreitend tätigen Bank, das auf Dauer eingerichtet ist. Aufsichtskollegien tragen dazu bei, ein besseres Verständnis für das Risikoprofil und die Schwachstellen einer grenzüberschreitend tätigen Bank zu entwickeln und bieten zudem den mit der Beaufsichtigung dieser Bank befassten Behörden einen Rahmen für die Behandlung zentraler, aufsichtlich relevanter Themen. Vgl. https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/ssmexplained/html/supervisory_colleges.de.html.
196 Siehe SRMR I (2014).
197 Siehe SRMR I (2014), die im Zuge des oben beschriebenen Bankenpakets als SRMR II (2019) bereits erstmalig novelliert wurde.
198 Siehe Europäische Kommission (2015a) und Europäische Kommission (2015b).
199 Government Offices of Sweden (2019).
200 Danish Ministry for Industry, Business and Financial Affairs (2019).
201 Dieses wurde in weiterer Folge durch das Financial Stability Committee (FSC) ersetzt; vgl. hierzu Ladler (2014), S. 162.
202 Vgl. Art 6 SSMR (2013).
203 Vgl. Nowotny, 2019.
204 Für eine nähere Darstellung siehe Europäische Kommission (2015b).
205 Eurogruppe, 2012.
Wettbewerbspolitik in Österreich im europäischen Kontext – Rückblick und Ausblick 25 Jahre nach dem EU-Beitritt
Michael Böheim 206
Wissenschaftliche Begutachtung: Walpurga Köhler-Töglhofer, OeNB
Wettbewerbspolitik stellt eine der wichtigsten Kernaufgaben der Europäischen Union dar, um die Funktionsfähigkeit des gemeinsamen Marktes nachhaltig zu gewährleisten. Im Gegensatz zu Deutschland, wo sich schon früh eine wettbewerbspolitische Tradition in Wissenschaft und Praxis entwickelte, spielte in Österreich Wettbewerbspolitik lange Zeit keine nennenswerte Rolle. Erst der Beitritt zur Europäischen Union brachte für Österreich wichtige Impulse zur Wettbewerbsbelebung. Die Übernahme des wettbewerbsrechtlichen Acquis Communautaire und der Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts erzeugten den notwendigen Druck von außen, der mit einiger Verzögerung zur Angleichung des österreichischen materiellen Wettbewerbsrechts an das Gemeinschaftsrecht und zu einer Neugestaltung der wettbewerbspolitischen Institutionenlandschaft führte. Der vormals große Einfluss der Sozialpartner wurde deutlich reduziert, ihre Mitwirkungs- und Antragsrechte in Wettbewerbsfällen beschränkt. Das Kartellgericht blieb als Entscheidungsinstanz erhalten und mit der Bundeswettbewerbsbehörde wurde 2002 eine neue Verwaltungsbehörde mit umfassenden Ermittlungs- und Aufgriffskompetenzen geschaffen. Während sich diese in der Zwischenzeit als zentrale Drehscheibe im Institutionengefüge positionieren konnte, blieb die zeitgleich etablierte Wettbewerbskommission mangels Interesses der Politik an unabhängiger wettbewerbspolitischer Beratung bisher weitgehend bedeutungslos. Gerade durch eine Stärkung der Wettbewerbskommission könnten sich allerdings wichtige Impulse zur Entwicklung einer eigenständigen wettbewerbspolitischen Gesamtstrategie („Grand Design“) in Österreich ergeben.
JEL classification: D40, K21, L40
Keywords: Antitrust, competition, competition law, competition policy, Austria, European Union, Acquis Communautaire
Der Beitritt zur Europäischen Union am 1. Jänner 1995 brachte für die Wettbewerbspolitik in Österreich einen Paradigmenwechsel mit sich. Mit der Übernahme des Acquis Communautaire wurde nicht nur das materielle Wettbewerbsrecht und dessen Vollzug, sondern auch – mit etwas Verspätung – die wettbewerbspolitische Institutionenlandschaft durch innerstaatliche Reformen auf neue Grundlagen gestellt und das innerstaatliche Recht dem Gemeinschaftsrecht angeglichen.
Der vorliegende Beitrag zeichnet die Entwicklung der Wettbewerbspolitik im Licht der Änderungen des wettbewerbsrechtlichen Rahmens in Österreich vor und nach dem EU-Beitritt in groben Zügen 207 inklusive eines Ausblicks in die Zukunft in fünf Phasen nach. Die Struktur des Artikels folgt dieser historischen Phaseneinteilung. Das einleitende Kapitel 1 widmet sich der Zeit von den Anfängen des Wettbewerbsrechts in der Zweiten Republik bis zum EU-Beitritt am 1. Jänner 1995, der eine entscheidende Zäsur darstellte und als der wesentlichste Treiber der Weiterentwicklung des Wettbewerbsrechts in Österreich bezeichnet werden kann. Die Kapitel 2 (1995–2001), 3 (2002–2004) und 4 (2005 bis heute) behandeln drei, durch wichtige Reformprojekte gekennzeichnete Perioden. Kapitel 5 widmet sich der Bedeutung einer einheitlichen europäischen Wettbewerbspolitik für die wirtschaftliche Integration der Europäischen Union auf der Grundlage von Kooperation und Subsidiarität. In Kapitel 6 werden Schlussfolgerungen gezogen, und es wird ein Ausblick inklusive wettbewerbspolitischer Empfehlungen gegeben.
1 Wir Sozialpartner werd’n kan Kartellrichter brauchen (1945–1994)
Im Gegensatz zur, durch die liberale ordnungspolitische Tradition geprägten, Bundesrepublik Deutschland, die schon früh mit dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) eine Rechtsgrundlage für eine wettbewerbsorientierte Marktwirtschaft geschaffen hatte, war das halbe Jahrhundert vom Zweiten Weltkrieg bis zum EU-Beitritt (1945–1995) in Österreich nicht von einer ausgeprägten Wettbewerbsgesinnung geprägt.
Das GWB aus dem Jahr 1957 ist die zentrale Norm des deutschen Wettbewerbsrechts. Es bezweckt die Erhaltung eines funktionierenden, ungehinderten und möglichst vielgestaltigen Wettbewerbs; es reglementiert und bekämpft daher vor allem die Akkumulation und den Missbrauch von Marktmacht sowie die Koordination und Begrenzung des Wettbewerbsverhaltens unabhängiger Marktteilnehmer. Als zentrale Institution zum Vollzug des Wettbewerbsrechts wurde in Deutschland das Bundeskartellamt etabliert, das sowohl mit umfassenden Ermittlungs- und Aufgriffskompetenzen, als auch mit der Entscheidungskompetenz in erster Instanz ausgestattet wurde. Für Berufungen gegen erstinstanzliche Entscheidungen des Bundeskartellamts steht der Weg zum Oberlandesgericht Düsseldorf offen, sodass der gerichtliche Rechtschutz gewährleistet ist.
Für Österreich lässt sich am Beispiel des Bundesgesetzes vom 19. Oktober 1988 über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz 1988 – KartG 1988) pars pro toto die wettbewerbsrechtliche Nachkriegsordnung treffend beschreiben. Im Gegensatz zu Deutschland ist die nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzende Kartellgesetzgebung in Österreich von der Vorstellung ausgegangen, dass das Kartell(un)wesen eine nicht nur weit verbreitetet, sondern auch unvermeidliche Erscheinung des Geschäftslebens ist und allenfalls nach (großzügiger) Genehmigung von Kartellen durch das Kartellgericht zum Ausgleich begleitender Maßnahmen bedarf. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die „Verwaltung“ genehmigter Kartelle unter kartellgerichtlicher Aufsicht. 208
Charakteristisches Merkmal des österreichischen Systems, das bis zum Jahr 2002 – also sieben (sic) Jahre über den EU-Beitritt hinaus – in Kraft war, ist im Vergleich zu Deutschland der umfassende und umfangreiche Einfluss der sozialpartnerschaftlichen Institutionen auf den kartellrechtlichen Vollzug. So genossen die Sozialpartner als Amtsparteien (zusätzlich zum Bund über die Finanzprokuratur) umfangreiche Antragsrechte bei kartellgerichtlichen Verfahren, hatten in den Senaten des Kartellgerichts mit den von ihnen entsandten fachkundigen Laienrichterinnern und -richter die absolute Mehrheit und konnten weiters über den Paritätischen Ausschuss für Kartellangelegenheiten über Gutachten Einfluss auf Kartellfälle nehmen.
2 Zaghaft in die neuen Zeiten (1995–2001)
Da das europäische Wettbewerbsrecht unmittelbare Anwendbarkeit in allen Mitgliedstaaten genießt, war eine sofortige inhaltliche Anpassung des österreichischen Kartellrechts an die Wettbewerbsregeln anlässlich des EU-Beitritts nicht erforderlich. Der österreichische Gesetzgeber hatte es daher mit der Angleichung des österreichischen an das europäische Wettbewerbsrecht („Harmonisierung“) nicht besonders eilig.
Die KartG-Nov 1999 brachte neben einigen geringfügigen Anpassungen als wesentliche Neuerung die Amtswegigkeit in Kartellverfahren. Als entscheidende Schwachstelle des bis dahin geltenden Kartellrechts wurde erkannt, dass das Kartellgericht grundsätzlich nur auf Antrag einer Partei tätig werden konnte. Zwar hatten die Amtsparteien (damals der Bund über die Finanzprokuratur und die Sozialpartner) die Möglichkeit, in fast allen kartellrechtlichen Angelegenheiten die Einleitung eines Verfahrens zu veranlassen. Es gab jedoch Fälle, wie konkret die Fusion der Nachrichtenmagazine Profil, News und Format, in denen sich die Amtsparteien aus verschiedenen Gründen (vor allem wegen des Vorliegens einer Interessenkollision oder aus politischen Rücksichten) scheuten, einen Antrag zu stellen, obwohl dies nach den Zielsetzungen des Kartellgesetzes angezeigt gewesen wäre. 209
Besonders einschneidend wirkte sich dies im Hinblick auf die Zusammenschlusskontrolle aus, da angemeldete Zusammenschlüsse vom Kartellgericht nur dann geprüft und gegebenenfalls untersagt werden konnten, wenn eine Amtspartei einen Prüfungsantrag gestellt hatte. Ein individuelles Antragsrecht von Unternehmen, deren rechtliche oder wirtschaftliche Interessen durch den Zusammenschluss berührt gewesen waren, war im Unterschied zu den anderen kartellgerichtlichen Verfahren nicht vorgesehen. Diese Lücke wurde durch eine Ausweitung der Befugnis des Kartellgerichts zum amtswegigen Einschreiten geschlossen (§ 44a KartG 1988 idF KartG-Nov 1999). 210
3 Neue Institutionen braucht das Land (2002–2004)
Mit Wirkung vom 1. Juli 2002 trat in Österreich eine umfassende institutionelle Reorganisation der wettbewerbspolitischen Institutionenstruktur in Kraft (Abbildung 1). Die Kartellgesetznovelle 2002 ist als unmittelbare Reaktion des Gesetzgebers auf den europäischen Reformdruck zu interpretieren (Böheim, 2002). Wichtigste Intention war die längst überfällige institutionelle Professionalisierung des wettbewerbsrechtlichen Vollzugs in Österreich (Böheim, 2003).
Gekennzeichnet ist das Reformwerk primär durch eine weitgehende Zurückdrängung des vielfach – teilweise auch zu Unrecht – kritisierten umfassenden Einflusses der Sozialpartner auf die kartellrechtliche Entscheidungsfindung. Während das Antragsrecht der Sozialpartner im Fall von Kartellen und Marktmachtmissbrauch erhalten blieb, ging es bei der Prüfung von Unternehmenszusammenschlüssen durch den Verlust von der Amtsparteienstellung der Sozialpartner auf zwei neu eingerichtete staatliche Institutionen − die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) und den Bundeskartellanwalt (BKAnw) − über. Weiters wurde in den Senaten des Kartellgerichts und des Kartellobergerichts die Mehrheit der von den Sozialpartnern entsandten fachkundigen Laienrichterinnen und -richter beseitigt, indem zusätzliche Berufsrichterinnen und -richter eingesetzt wurden.
In dieser neuen institutionellen Ordnung ist die Bundeswettbewerbsbehörde als zentrale Drehscheibe im wettbewerbsrechtlichen Vollzug positioniert. Sie ist zwar organisatorisch und damit auch budgetär beim Wirtschaftsministerium angesiedelt, die Behördenleitung (mit dem Amtstitel Generaldirektor/in für Wettbewerb) ist aber hinsichtlich der Erfüllung ihrer Aufgaben per Verfassungsbestimmung weisungsfrei und unabhängig (§ 1 Abs. 3 WettbG). Hauptaufgabe der BWB ist die Untersuchung und Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen aller Art (vgl. § 2 Abs. 1 WettbG). Zu diesem Zweck wurde ihr der Status einer Amtspartei mit Parteienstellung in allen kartellrechtlichen Verfahren mit umfassenden Ermittlungs- und Aufgriffsrechten zugestanden.
Ergänzend zur Bundeswettbewerbsbehörde wurde beim Justizministerium der Bundeskartellanwalt eingerichtet. In konsequenter Umsetzung des Anklageprinzips ist der Bundeskartellanwalt (ähnlich einem Staatsanwalt/einer Staatsanwältin im Strafverfahren) zur Vertretung der öffentlichen Interessen in Angelegenheiten des Wettbewerbsrechts beim Kartellgericht berufen (§ 112 KartG). Der Bundeskartellanwalt ist unmittelbar der Bundesministerin/dem Bundesminister für Justiz unterstellt und an deren/dessen Weisungen gebunden. Als zweite Amtspartei verfügt er über die gleichen Aufgriffskompetenzen wie die Bundeswettbewerbsbehörde. Obwohl beide Amtsparteien zum Zusammenwirken angehalten sind (§ 117 KartG), sind Prüfungsanträge an das Kartellgericht nicht an eine übereinstimmende Vorgangsweise gebunden. Eine gegenseitige Blockade der beiden Institutionen ist somit nicht möglich, da beide Amtsparteien unabhängig voneinander agieren können.
Diese Parallelkonstruktion von Bundeswettbewerbsbehörde und Bundeskartellanwalt und die damit einhergehender Zersplitterung der Kompetenzen bei gleichzeitig – damals (nicht heute) – zu Recht beklagtem Ressourcenmangel wurde wegen der Duplizierung von Zuständigkeiten als "One-Stop-Shop auf Österreichisch" karikiert (Ablasser und Hemetsberger, 2002). Die Intention des Gesetzgebers war, dass die beiden Institutionen „keine parallel agierenden, einander konkurrierenden Einrichtungen sein, sondern sich in ihrer Aufgabenerfüllung ergänzen sollen" 211 . Obgleich aus einem politischen Tauschgeschäft geboren, liegt die (wohl nicht intendierte) Relevanz des Bundeskartellanwalts darin, die Bundeswettbewerbsbehörde implizit kontrollieren zu können. Dies ist vor allem dann von großer Bedeutung, wenn die Bundeswettbewerbsbehörde nicht tätig wird, weil der Bundeskartellanwalt durch sein Einschreiten (ggf. auch über Weisung der Justizministerin/des Justizministers) das „Schubladieren“ eines Falles verhindern kann. In der Praxis passiert ein eigenständiges Vorgehen des Bundeskartellanwalts allerdings nur in (zu) seltenen Ausnahmefällen. 212
Der Bundeswettbewerbsbehörde und der Bundesministerin/dem Bundesminister für Wirtschaft wurde vom Gesetzgeber die Wettbewerbskommission (WBK) als beratendes Organ beigegeben (§ 16 WettbG). Ihre Mitglieder werden von der Wirtschaftsministerin/dem Wirtschaftsminister für eine Funktionsperiode von vier Jahren ernannt. Jeweils vier ihrer acht Mitglieder (und Ersatzmitglieder) werden von der Wirtschaftsministerin/dem Wirtschaftsminister bzw. von den sozialpartnerschaftlichen Institutionen nominiert. In Fusionskontrollfällen kann die WBK Empfehlungen an die Bundeswettbewerbsbehörde zur Stellung eines Prüfungsantrags abgeben. Eine solche Empfehlung ist für die BWB allerdings nicht bindend, sondern kann begründet abgelehnt werden. Darüber hinaus kann die WBK (aus eigenem Antrieb oder im Auftrag der Wirtschaftsministerin/des Wirtschaftsministers) Gutachten zu allgemeinen wettbewerbspolitischen Fragestellungen erstellen und tritt damit an die Stelle des abgeschafften Paritätischen Ausschusses in Kartellangelegenheiten.
Die WBK, die obwohl nach den (ursprünglichen, freilich nicht realisierten) Intentionen des Gesetzgebers nach dem Vorbild der deutschen Monopolkommission eingerichtet hätte werden sollen, verfügt anders als ihr deutsches Pendant weder über eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, noch über ein eigenes Budget. Ihre Stellung im wettbewerbspolitischen Institutionengefüge ist äußerst schwach, da sie in ihrem Wirken vollkommen vom "guten Willen" der BWB abhängig ist.
In der Praxis gibt die WBK ihre Empfehlung zur Stellung eines Prüfungsantrags bei Unternehmenszusammenschlüssen aufgrund der ihr zur Verfügung gestellten Anmeldeunterlagen ab. Ein darüberhinausgehender, umfassenderer Informationsaustausch und eine vertiefte Einbindung der WBK in die Untersuchung von Fusionsfällen sind ex lege nicht vorgesehen und erfolgen in der Praxis nur auf Drängen der WBK. Die WBK bietet sich in ihren Stellungnahmen zu den Tätigkeitsberichten der BWB seit vielen Jahren als beratende Kooperationspartnerin an, was auf Seite der BWB aber nur auf äußerst verhaltene Resonanz stößt. Auch das Wirtschaftsministerium hat von der Möglichkeit, bei der WBK wettbewerbsökonomische Gutachten durch die Bundesministerin/den Bundesminister zu beauftragen in 18 Jahren nur zweimal (sic) Gebrauch gemacht: 2008 beim „Inflationsgutachten“ und 2009 beim „Treibstoffpreisgutachten“ (Wettbewerbskommission 2008, 2009).
Die Entscheidungskompetenz liegt auch nach der Kartellrechtsreform 2002 in erster und zweiter Instanz nach wie vor beim Kartellgericht bzw. beim Kartellobergericht. Geändert wurden lediglich die Zusammensetzung der Richtersenate des Kartellgerichts und die Modalitäten betreffend die Einleitung von Prüfungsverfahren. In den Senaten des Kartellgerichts und des Kartellobergerichts haben nun die von den Sozialpartnern nominierten fachkundigen Laienrichterinnen und -richter keine Mehrheit mehr, sodass ein Überstimmen der Berufsrichterinnen und -richter nicht mehr möglich ist. Die aus rechtsdogmatischen Gründen (Identität von Ankläger und Richter) heftig kritisierte amtswegige Einleitung eines Prüfungsverfahrens (vormals § 44a KartG idF KartG-Nov 1999) wurde wieder abgeschafft. Diese Aufgriffskompetenz aus öffentlichem Interesse ging auf den Bundeskartellanwalt über.
Die einschneidendsten Änderungen ergaben sich durch die Kartellrechtsnovelle 2002 in der Fusionskontrolle, in der die Sozialpartner ihr unmittelbares Recht auf Stellung eines Prüfungsantrags verloren. Sie sind nun auf die Abgabe von Stellungnahmen (§ 49 KartG) und die Mitwirkung in der WBK über die von ihnen nominierten Mitglieder beschränkt. Weiters brachte die KartG-Nov 2002 eine verstärkte Einbindung der Regulierungsbehörden (Telekom-Control-Kommission, Energie-Control-Austria, Schienen-Control), um deren Fachwissen zu nutzen (Antragsbefugnisse und Möglichkeit der Einholung von Stellungnahmen durch Gerichte und die BWB). Schließlich wurde das Sanktionensystem bei Verstößen gegen das Kartellgesetz von strafgesetzlichen Maßnahmen auf Geldbußen umgestellt, die vom Kartellgericht auf Antrag der BWB verhängt werden können.
4 Endlich in Europa angekommen!? (2005 bis heute)
Während das Kartellgesetz im Jahr 2002 bloß novelliert wurde, also der Grundbestand des KartG 1988 unverändert blieb, entschloss sich der Gesetzgeber drei Jahre später zu einer umfassenden Neukodifikation des Kartellgesetzes. Das 2002 novellierte Kartellgesetz 1988 trug den Titel “Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen”, wohingegen das neu erlassene Kartellgesetz 2005 den Titel „Bundesgesetz gegen Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen“ erhielt. Mit diesem kleinen, aber wichtigen Detail wird schon im Titel deutlicher als bisher der Zweck des Gesetzes zum Ausdruck gebracht. Damit wird auch endlich sprachlich– immerhin sind damals bereits zehn Jahre seit dem EU-Beitritt vergangen – ein Bruch mit der kartellfreundlichen „Wettbewerbs“ politik der Nachkriegsjahre vollzogen. 213
Der Gesetzesentwurf gleicht das materielle Kartellrecht weitgehend an die in den Art. 81 und 82 EGV (heute 101 und 102 AEUV) enthaltenen Wettbewerbsregeln und an die zur Durchführung dieser Regeln erlassene Verordnung (VO) Nr. 1/2003 an. Die institutionellen Regelungen, die erst drei Jahre davor umfassend neugestaltet wurden und die Verfahrensvorschriften blieben weitgehend unverändert. Es wurden nur geringfügige technische Anpassungen vorgenommen.
Die wesentlichen Neuerungen der VO 1/2003 gegenüber der Vorgängerverordnung waren die Umdeutung des Art. 81 Abs. 3 EGV in eine Legalausnahme 214 , die dezentrale Anwendung des Art. 81 EGV über das Verbot von Wettbewerbsbeschränkungen und des Art. 82 EGV über das Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung. Die Zusammenschlusskontrolle wird durch die VO 1/2003 nicht berührt.
Da die VO 1/2003 unmittelbar in den Mitgliedstaaten gilt, wäre Österreich zur Angleichung des innerstaatlichen Kartellrechts an das Gemeinschaftsrecht grundsätzlich nicht verpflichtet gewesen. Sie wirkt sich jedoch grundsätzlich positiv auf das Zusammenwirken der beiden Rechtsordnungen aus, weshalb dieser Schritt vom österreichischen Gesetzgeber freiwillig gesetzt wurde. 215
Es ist sowohl für die rechtsanwendenden Organe wie auch für die dem Kartellrecht unterworfenen Unternehmen von Vorteil, wenn sie sich nicht nach zwei nebeneinander geltenden, völlig unterschiedlichen Systemen richten müssen. Auch würde es einen Wertungswiderspruch bedeuten, wenn Wettbewerbsbeschränkungen von gemeinschaftsweiter Bedeutung innerhalb der Grenzen der Legalausnahme ohne Befassung einer Behörde durchgeführt werden dürften, während wirtschaftlich weniger bedeutende Wettbewerbsbeschränkungen, die nur dem innerstaatlichen Kartellrecht unterliegen, weiterhin nur nach Genehmigung durch das Kartellgericht durchgeführt werden dürften (OGH, 2005).
Auch wenn das damals geltende System der „Kartellverwaltung“ im Laufe der Zeit weiterentwickelt wurde, war es doch in seinen wesentlichen Grundzügen durch die wirtschaftlichen und politischen Bedingungen der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt und somit nicht mehr zeitgemäß. Die Angleichung an das Gemeinschaftsrecht und der damit einhergehende Entfall bisheriger „Austriaca“ (OGH, 2005), bedeutet daher auch einen Modernisierungsschritt, der den am Wettbewerb beteiligten Unternehmen zwar mehr eigene Verantwortung zumutet, sie gleichzeitig aber von bürokratischen Belastungen befreit.
Während die Institutionenreform der KartG-Nov 2002 und die Bestimmungen über den Marktmachtmissbrauch unverändert blieben und die Bestimmungen über die Zusammenschlusskontrolle mit geringfügigen rechtstechnischen Modifikationen 216 übernommen wurden, betrafen die wesentlichsten Neuerungen des KartG 2005 vor allem Kartelle. Sie sind die nachfolgend synoptisch dargestellt: 217
- Die einzelnen Kartellarten und die darauf aufbauende differenzierte Regelung über das Verbot ihrer Durchführung werden durch ein allgemeines Verbot von Wettbewerbsbeschränkungen nach dem Vorbild des Art. 101 AEUV (vormals 81 EGV) ersetzt. Damit fällt auch die Sonderbehandlung für vertikale Wettbewerbsbeschränkungen weg.
- Die einschlägigen Bestimmungen, die der „Kartellverwaltung“ dienten, werden durch das allgemeine Kartellverbot (§ 1 KartG 2005) gegenstandslos. Neben der Institution der/des Kartellbevollmächtigen und dem Kartellregister entfallen deshalb auch die im KartG 1988 noch enthaltenen kartellvertragsrechtlichen (§§ 28 bis 30 KartG 1988) und zivilprozessualen Bestimmungen (§ 122 bis 124 KartG 1988), sowie die Regelungen über die Untersagung unverbindlicher Preisempfehlungen und über unverbindliche Verbandsempfehlungen, die nicht mehr in das neue System passen.
- Über Art. 101 AEUV (vormals 81 EGV) hinausgehend wird das Kartellverbot auf einseitige Wettbewerbsbeschränkungen ausgedehnt, um einen Rückschritt gegenüber der geltenden Rechtslage zu vermeiden.
- Darüber hinaus wird durch eine Verfassungsbestimmung die Anwendung des Kartellgesetzes auch auf diejenigen Sachverhalte ausgedehnt, die bisher wegen der Zuständigkeit der Länder davon ausgenommen waren.
Die wichtigste Neuerung im materiellen Recht betraf nicht das Kartellgesetz, sondern das Wettbewerbsgesetz. Dabei handelt es sich um die Einführung eines Kronzeugenprogrammes, das für die Aufdeckung von Kartellen unverzichtbar geworden ist. Kartelle sind in hohem Maße schädlich für die Volkswirtschaft. Da sie daher als schwerwiegende Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht gelten und mit gravierenden Sanktionen im Gemeinschaftsrecht und in den nationalen Rechtsordnungen belegt sind, werden sie in der Regel im Geheimen und äußerst konspirativ vereinbart. Die Aufklärung, Beendigung und Sanktionierung solcher Rechtsverletzungen hängt deshalb entscheidend von Hinweisen aus dem Kreis bzw. aus dem Umfeld der Kartellmitglieder ab.
Deshalb verfügten bereits im Jahr 2005 die Europäische Kommission und 17 andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union über ein so genanntes Kronzeugenprogramm („Leniency programme“). Diesen Programmen ist bei allen Unterschieden im Detail gemeinsam, dass „als Gegenleistung für die uneingeschränkt aus freien Stücken erfolgte Offenlegung von Informationen zu dem Kartell, die vor oder während der Ermittlungsphase des Verfahrens bestimmten Kriterien genügt, entweder völlige Straffreiheit oder eine wesentliche Reduzierung der Strafen gewährt wird, die andernfalls gegen einen Kartellbeteiligten verhängt worden wären“ (Europäische Kommission 2004, Fußnote 14).
Es ist unbestritten, dass Kronzeugenprogramme für die Aufdeckung von Kartellen den alles entscheidenden Beitrag leisten, indem für die Kartellmitglieder jederzeit die Gefahr des Ausstiegs von in der Folge mit den Behörden kooperierenden Kartellmitgliedern gegeben ist. Darüber hinaus sind Kronzeugenprogramme eine zusätzliche Abschreckung gegen die Beteiligung an unrechtmäßigen Kartellen, sodass auch in Österreich ein solches Programm implementiert wurde. In der wettbewerbsrechtlichen Vollzugspraxis hat sich das Kronzeugenprogramm sehr bewährt. So gehen alle seit Einführung des Kronzeugenprogrammes in Österreich aufgedeckten Kartelle auf die Initiative einer Kronzeugin/eines Kronzeugen zurück. Mit anderen Worten: Ohne Kronzeugenprogramm hätte kein einziges Kartell enttarnt werden können. Mit dieser Angleichung an die europäischen Standards ist das österreichische Wettbewerbsrecht – zumindest auf dem Papier – endlich in Europa angekommen.
5 Divide et impera: Kooperation und Subsidiarität in der EU
Das europäische Wettbewerbsrecht funktioniert nach zwei Leitprinzipen, dem Kooperationsprinzip einerseits und dem Subsidiaritätsprinzip andererseits. Kooperation und Subsidiarität stellen die tragenden Säulen der europäischen Wettbewerbspolitik dar.
Durch den Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts ist die unmittelbare Anwendbarkeit des (wettbewerbsrechtlichen Teils des) Acquis Communautaire in allen Mitgliedstaaten sichergestellt. Auf dieser Rechtsgrundlage entfaltet sich die europäische Wettbewerbspolitik in allen Mitgliedstaaten gleich, da widersprechende nationale Wettbewerbsbestimmungen „overruled“ werden. Eine sofortige inhaltliche Anpassung des österreichischen Kartellrechts an die europäischen Wettbewerbsregeln anlässlich des EU-Beitritts war daher auch nicht erforderlich. Der wettbewerbspolitische Geist der EU diffundiert durch die von der Europäischen Kommission erlassenen Verordnungen, Leitlinien und Entscheidungen sowie die einschlägige Spruchpraxis der europäischen Gerichte „mit (un)sichtbarer Hand“ in die Mitgliedstaaten. Dieser antreibende Effekt hat sich auf die Entwicklung von Wettbewerbsrecht und -politik in Österreich äußerst positiv ausgewirkt, da sich die Institutionen und Politik nicht den europäischen Vorgaben entziehen können. Österreich konnte auf diese Weise innerhalb von zweieinhalb Jahrzehnten vom wettbewerbspolitischen Entwicklungsland zum europäischen Standard aufschließen. Faktum ist: Diese positive Entwicklung im Bereich des Wettbewerbs ist (fast) ausschließlich dem exogenen Druck durch die EU-Mitgliedschaft zu verdanken. Im Rahmen der von der EU gesetzten „Leitplanken“ besteht aufgrund lenkender Vorgaben ausreichend Freiheit für eigene nationalstaatliche Initiativen (ggf. in Kooperation mit anderen Ländern), die von Österreich in Zukunft in stärkerem Ausmaß als in der Vergangenheit genützt werden sollten.
Kooperation bedeutet im wettbewerbspolitischen Kontext auch, dass sich die nationalen Wettbewerbsbehörden bei grenzüberschreitenden Verfahren unterstützen und eng mit der Europäischen Kommission zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit ist dabei breit gefächert und reicht von Arbeitsgruppen und gemeinsamen Positionspapieren bis hin zur Teilnahme und Mitarbeit in gemeinsamen Netzwerken, wie bspw. dem European Competition Network (ECN) 218 , und der praktischen Unterstützung bei Hausdurchsuchungen. Gerade vergleichsweise neu etablierte Wettbewerbsbehörden, wie die Bundeswettbewerbsbehörde (Gründung 2002), profitieren sehr stark von dieser Zusammenarbeit mit eingesessenen Institutionen, wie bspw. dem deutschen Bundeskartellamt (Gründung 1958), indem sie über das Wettbewerbsbehördennetzwerk auf deren umfassende Wissensbasis und langjährige Erfahrung zurückgreifen können.
Subsidiarität bedeutet im wettbewerbspolitischen Kontext, dass die Kompetenzen der nationalen Wettbewerbsbehörden dort beginnen, wo jene der Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission enden. Auf Österreich bezogen regelt bspw. die Fusionskontrollverordnung (FKVO) 219 die Kompetenzverteilung zwischen Europäischer Kommission und der Bundeswettbewerbsbehörde bzw. dem Kartellgericht, indem Schwellenwerte für die ausschließliche Zuständigkeit der Kommission angeführt werden. Unternehmenszusammenschlüsse, die diese Kriterien nicht, jedoch die Voraussetzungen für die Anmeldepflicht nach KartG erfüllen, unterliegen der nationalen österreichischen Fusionskontrolle durch die Bundeswettbewerbsbehörde bzw. den Bundeskartellanwalt in Phase I und durch das Kartellgericht in Phase II.
Unternehmenszusammenschlüsse von gemeinschaftsweiter Bedeutung
Gemeinschaftsweite Bedeutung hat eine Fusion, wenn …
… entweder folgende zwei Kriterien kumulativ erfüllt sind (Art. 1 Abs. 2 Buchstabe a und b Fusionskontrollverordnung (FKVO)):
- alle am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen haben zusammen einen weltweiten Gesamtumsatz von mehr als 5 Mrd EUR und
- mindestens zwei der beteiligten Unternehmen erzielen einen gemeinschaftsweiten Umsatz von jeweils mehr als 250 Mio EUR,
… oder folgende vier Kriterien (Art. 1 Abs. 3 Buchstabe a bis d leg. cit.) kumulativ erfüllt sind
- alle am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen haben zusammen einen weltweiten Gesamtumsatz von mehr als 2,5 Mrd EUR und
- alle am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen erzielen zusammen in mindestens drei Mitgliedstaaten einen Gesamtumsatz von jeweils mehr als 100 Mio EUR und
- mindestens zwei der beteiligten Unternehmen erzielen in jedem dieser drei Mitgliedstaaten einen Umsatz von jeweils mehr als 25 Mio EUR und
- und mindestens zwei der beteiligten Unternehmen erzielen einen gemeinschaftsweiten Umsatz von jeweils mehr als 100 Mio EUR.
In die Zuständigkeit der Europäischen Kommission fallen alle Unternehmenszusammenschlüsse von gemeinschaftsweiter Bedeutung (Kasten 1), während alle anderen Fusionen von den nationalen Wettbewerbsbehörden abzuhandeln sind (Subsidiaritätsprinzip). Erzielen die beteiligten Unternehmen jeweils mehr als zwei Drittel ihres gemeinschaftsweiten Umsatzes in ein und demselben Mitgliedstaat, ist auch bei Überschreiten der Schwellenwerte der FKVO keine Zuständigkeit der Europäischen Kommission gegeben (Art. 1 Abs. 2 und Abs. 3 letzter Satz FKVO). Mit dieser Einschränkung sollen Zusammenschlüsse, die sich ganz überwiegend in einem Mitgliedstaat auswirken, in der Zuständigkeit der nationalen Behörde verbleiben. Damit soll sichergestellt werden, dass Unternehmenszusammenschlüsse von jener Wettbewerbsbehörde bearbeitet werden, in deren Einflusssphäre die Fusion die größten Auswirkungen hat.
Neben Unternehmenszusammenschlüssen, die eine marktbeherrschende Stellung verstärken oder entstehen lassen, sind in Österreich gemäß § 1 KartG die Bildung von Kartellen (Preis-, Mengen- und Gebietsabsprachen etc.) sowie gemäß § 5 KartG der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung wettbewerbsrechtlich untersagt. Im Sinne einer „competition intelligence“ werden von der Bundeswettbewerbsbehörde auch nach eigenem Gutdünken wettbewerbsökonomische Branchenuntersuchungen 220 durchgeführt, um wettbewerbswidrigem Verhalten auf die Spur zu kommen. Neben den bekanntermaßen hochkonzentrierten Märkten wie Lebensmitteleinzelhandel, der Erzeugung von Zement und Beton sowie Strom, Gas und Treibstoffe wurden in diesem Rahmen bereits Bankomatgebühren, Mobiltelekommunikation und Apotheken analysiert. Gemäß § 2 Abs. 1 Zif 8 WettbG ist die Bundeswettbewerbsbehörde auch zur Durchführung eines Wettbewerbsmonitorings, insbesondere über die Entwicklung der Wettbewerbsintensität in einzelnen Wirtschaftszweigen oder wettbewerbsrechtlich relevanten Märkten, verpflichtet (Böheim, 2013). Bis auf ein Positionspapier (Erharter, 2015) wurden seitens der Bundeswettbewerbsbehörde diesbezüglich aber keine weitergehenden Aktivitäten in Richtung eines systematisches Wettbewerbsmonitorings gesetzt. Stattdessen fungieren die Branchenuntersuchungen offensichtlich als (unvollkommenes) Substitut für das Wettbewerbsmonitoring, was dem Willen des Gesetzgebers eindeutig widerspricht. 221
6 Schlussfolgerungen, Reformoptionen und Ausblick
Die Erfahrungen der vergangenen 25 Jahre haben gezeigt, dass für die Umsetzung wettbewerbspolitischer Visionen ein langer politischer Atem notwendig ist. Wesentlicher Treiber für die positive Entwicklung in Österreich war die Wettbewerbspolitik auf europäischer Ebene. Obgleich sich in Österreich aufgrund exogenen Drucks viel verbessert hat, besteht in Einzelbereichen nach wie vor Nachbesserungsbedarf. Nachfolgend werden deshalb noch immer bestehende bedeutende Schwachstellen, die einer Beseitigung harren, in Erinnerung gerufen.
Trotz zahlreicher Maßnahmen zur Verbesserung des Wettbewerbsrechts („Know-how“) im Detail mangelt es in Österreich insgesamt nach wie vor an einer entsprechenden Wettbewerbspolitik als Überbau („Know-why“). Wettbewerbspolitik ist mehr als das bloße Abarbeiten von konkreten Kartellrechtsfällen. Eine moderne Wettbewerbspolitik setzt eine mit anderen Politikbereichen (Regulierungs-, Industrie-, Infrastruktur-, Energie- und Umweltpolitik usw.) abgestimmte Gesamtstrategie („Grand Design") voraus. Eine solche wettbewerbspolitische Gesamtstrategie ist, obgleich dringend erforderlich, in Österreich auch 25 Jahre nach dem EU-Beitritt nicht erkennbar.
Die politischen Verantwortungstragenden scheinen sich – außer in „Sonntagsreden“ – nicht besonders dafür zu interessieren, und den operativ tätigen Wettbewerbsbehörden bleibt neben der Einzelfallbearbeitung zu wenig Zeit für strategische Überlegungen. Eine bloß kasuistisch agierende Wettbewerbspolitik läuft allerdings Gefahr, wesentliche gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge zu übersehen, weshalb mit Nachdruck ein „Grand Design" für die österreichische Wettbewerbspolitik (Wettbewerbspolitik in einer kleinen offenen Volkswirtschaft) zu entwickeln wäre.
Eine wesentliche Rolle dabei könnte eine aufgewertete Wettbewerbskommission, deren Potenzial nicht einmal annähernd ausgenützt wird, spielen. Die Bundeswettbewerbsbehörde und das Wirtschaftsministerium verzichten bisher weitgehend auf eine fundierte Beratung und einen regen Meinungsaustausch (über das gesetzlich vorgesehene Minimum hinaus) mit dem ihr zugeordneten Fachgremium. Gerade einer monokratisch eingerichteten Verwaltungsbehörde stünde es gut an, diesen inhaltlichen Austausch proaktiv zu suchen, statt ihn widerwillig über sich ergehen zu lassen. In diesem Klima der intellektuellen Abschottung erscheint der Bundeskartellanwalt als Korrektiv zur Bundeswettbewerbsbehörde unverzichtbar. Das aktuelle Regierungsprogramm (Bundesregierung 2020, 17) sieht (wieder einmal) eine Zusammenführung der beiden Institutionen zum „Heben von Synergien“ vor. Aus Sicht des Autors sollte darauf verzichtet werden, allerdings unter der Bedingung, dass der Bundeskartellanwalt seine Tätigkeit stärker als bisher proaktiv und öffentlichkeitswirksam nach klaren Vorgaben gestaltet.
Da es der Bundeswettbewerbsbehörde offensichtlich kein besonderes Anliegen ist, über die von ihr hinter verschlossenen Türen ausverhandelten Vereinbarungen der Öffentlichkeit ausführlich Rechenschaft abzulegen, wäre es die vornehmste und wichtigste Aufgabe des Bundeskartellanwalts dieses Vakuum ganz gemäß seiner Stellenbeschreibung aus „öffentlichem Interesse“ zu füllen. Dies betrifft insbesondere die Fälle, die im Rahmen der Zusammenschlusskontrolle nicht vor das Kartellgericht (Phase II) kommen, weil im Vorfeld Absprachen getroffen und Vereinbarungen („Deals“) geschlossen werden. Eine Entscheidung von BWB und BKAnw einen Fall nicht vor das Kartellgericht zu bringen, sondern diesen in Phase I zu erledigen, ist auch eine Entscheidung, allerdings ohne gerichtliche Überprüfung und ohne entsprechende Möglichkeit Rechtsmittel einzubringen.
Während in den vergangenen Jahren die Anzahl der Zusammenschlussanmeldungen in Österreich deutlich gestiegen ist, ist die Anzahl der von BWB und BKAnw gestellten Prüfungsanträge beim Kartellgericht stark rückläufig (Tabelle 1), was im eklatanten Gegensatz zur Entwicklung auf europäischer Ebene steht (Wettbewerbskommission, 2019).
| Unternehmenszusammenschlüsse in Österreich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anmeldungen |
Prüfanträge
(Phase II) |
Prüfquote (Phase II) | |||
| Anzahl | Anzahl | in % |
Index (2015 = 100)
absolut |
Veränderung | |
| Jahr | |||||
| 2015 | 366 | 4 | 1,09 | 100,0 | n.v. |
| 2016 | 420 | 3 | 0,71 | 65,4 | –34,6 |
| 2017 | 439 | 2 | 0,46 | 41,7 | –58,3 |
| 2018 | 481 | 1 | 0,21 | 19,0 | –81,0 |
| Quelle: Wettbewerbskommission (2019), eigene Berechnungen. | |||||
Wenn es die Absicht des Gesetzgebers gewesen wäre, die Bundeswettbewerbsbehörde mit Entscheidungskompetenzen in erster Instanz auszustatten, wären Kartell- und Wettbewerbsgesetz diesbezüglich entsprechend zu ändern gewesen. Im Umkehrschluss gilt: Da das bis dato nicht der Fall ist, bleibt die Entscheidungskompetenz erster Instanz (einstweilen noch) beim Kartellgericht. Es ist deshalb wettbewerbsrechtlich nicht akzeptabel, dass immer weniger Fälle vom Kartellgericht entschieden werden können, weil die beiden Amtsparteien auf Prüfungsanträge verzichten. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auch die Rolle des Bundeskartellanwalts als „Hüter des Kartellrechts“ kritisch zu hinterfragen, umso mehr als sein tatsächliches Agieren in diesem Punkt seinem Leitbild 222 widerspricht. Hinzu kommt, dass die Öffentlichkeit über die nicht vor das Kartellgericht gebrachten Fälle so gut wie nichts Substanzielles erfährt. Weder BWB noch BKAnw kommen ihrer diesbezüglichen Informationspflicht in ausreichendem Maße nach. Transparenz und Kontrolle erscheinen aus öffentlichem Interesse dringend und substanziell ausbaufähig.
Über das operative wettbewerbsrechtliche Tagesgeschäft hinaus könnte eine Aufwertung der Wettbewerbskommission den wettbewerbspolitischen Fokus schärfen helfen. Um die Bedeutung der Wettbewerbskommission zu erhöhen, sollte diese zumindest alle zwei Jahre ein eigenständiges Wettbewerbsgutachten verfassen. Zu diesem Zweck wäre ihr ein eigenes Budget (in vergleichsweise geringer Höhe), über das sie autonom verfügen können sollte, zuzuweisen. Eigene (von der BWB unabhängige) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erscheint hingegen nicht unbedingt erforderlich, obgleich das natürlich hilfreich wäre. Die Mitglieder der Wettbewerbskommission, die ausschließlich aus wirklich (sic) unabhängigen 223 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Forschung und Praxis rekrutiert werden sollten, könnten die Gutachten selbst verfassen und für ihren Zeitaufwand angemessen entschädigt werden (Böheim, 2008).
Solange die Remuneration der Tätigkeit der Wettbewerbskommission jedoch auf das almosenartige Sitzungsgeld 224 beschränkt bleibt, wird die wettbewerbspolitische Grundlagenarbeit in Form von Gutachten über allgemeine wettbewerbspolitische Fragen, die den Haupt- und Sondergutachten der deutschen Monopolkommission vergleichbar sind, weitgehend totes Recht bleiben − und die Wettbewerbskommission als wettbewerbspolitisches Expertengremium wie bisher nahezu bedeutungslos sein. Um ihre Grundlagenarbeit gesetzeskonform erfüllen zu können, würde die Wettbewerbskommission finanzielle Ressourcen in der Höhe von zumindest 5% bis 10% der Mittel der Bundeswettbewerbsbehörde benötigen. Die mit der rezenten KartG-Nov 2019 realisierte partielle Zweckwidmung der Geldbußen für Zwecke der BWB 225 könnte eine solide budgetäre Basis für die Aufwertung der Wettbewerbskommission nach dem Vorbild der deutschen Monopolkommission wie ursprünglich intendiert bieten. Der politische Wille und das Interesse an unabhängiger wettbewerbspolitischer Grundlagenarbeit und Beratung scheint dazu in Österreich aber leider nach wie vor nicht in ausreichendem Maße vorhanden zu sein.
Obgleich ein gutes Stück des Weges zurückgelegt wurde, ist es offensichtlich für die österreichische Wettbewerbspolitik doch noch ein längerer Weg nach Europa. Möge dieser nicht weitere 25 Jahre dauern!
Literaturverzeichnis
Ablasser, A. und W. Hemetsberger, W. 2002. Fusionskontrolle neu oder One-Stop-Shop auf Österreichisch. ecolex (6). 412–416.
Arbeiterkammer. 2002. Fusionen und Übernahmen. Wettbewerbsbericht der AK-Wien. Teil 1 – Wettbewerbsrecht und -politik. Wien.
Böheim, M. 2002. Austrian Competition Policy: Quo Vadis? In: Austrian Economic Quarterly 7(4). 176–190.
Böheim, M. 2003. Wettbewerbspolitik unter neuen Rahmenbedingungen. Zwischenbilanz und Ausblick. In: WIFO-Monatsberichte 76(7). 515–528.
Böheim, M. 2008. Reformoptionen zur Wettbewerbspolitik in Österreich. In: WIFO-Monatsberichte 81(6). 449–459.
Böheim, M. 2013. Wettbewerbsmonitoring im Spannungsfeld zwischen ökonomischen Gestaltungsmöglichkeiten und wettbewerbspolitischen Erwartungen. In: WIFO-Monatsberichte 86(3). 225–236.
Bundesregierung. 2020. Aus Verantwortung für Österreich. Regierungsprogramm 2020–2024. Wien.
Erharter, D. 2015. Arbeitspapier Wettbewerbsmonitoring. Bundeswettbewerbsbehörde, Wien. https://www.bwb.gv.at/fileadmin/user_upload/Downloads/publikationen/Arbeitspapier%20der%20BWB%20zu%20Wettbewerbsmonitoring.pdf
Europäische Kommission. 2004. Bekanntmachung der Kommission über die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes der Wettbewerbsbehörden. ABl. 2004, C 101/03.
OGH. 2005. Stellungnahme des Obersten Gerichtshofes im Begutachtungsverfahren über den Entwurf eines Bundesgesetzes gegen Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen. Präs. 1610-3/05. Wien.
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/SNME/SNME_04428/fname_035878.pdf
Wettbewerbskommission. 2008. Gutachten der Wettbewerbskommission vom 14.7.2008 gemäß § 16 Abs 1 WettbG an den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit. Wien.
https://www.bwb.gv.at/fileadmin/user_upload/Gutachten_der_WettbewerbskommissionPDFs/WBKGutachten20080728Erg%C3%A4nzung.pdf
Wettbewerbskommission. 2009. Gutachten der Wettbewerbskommission vom 29.6.2009 gemäß § 16 Abs 1 WettbG an den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend. Wien.
https://www.bwb.gv.at/fileadmin/user_upload/Gutachten_der_WettbewerbskommissionPDFs/GutachtenWBK_Treibstoffpreise.pdf
Wettbewerbskommission. 2019. Stellungnahme der Wettbewerbskommission zum Tätigkeitsbericht der Bundeswettbewerbsbehörde für den Zeitraum 1.1.2018 – 31.12.2018 gemäß § 2 Abs 4 WettbG, Wien. https://www.bwb.gv.at/fileadmin/user_upload/SchwerpunktempfehlungenPDFs/WBK_Stellungnahme_BWB_TB2018.pdf
206 Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), michael.boeheim@wifo.ac.at. Der Autor versucht die objektive Position des Wettbewerbsökonomen (seit 1997 am WIFO mit dem Themenbereich Wettbewerb und Regulierung befasst) mit der subjektiven Perspektive des teilnehmenden Beobachters (Mitglied der Wettbewerbskommission 2002–2018; gerichtlich beeideter Sachverständiger in Kartellangelegenheiten seit 2002) zu verbinden. Aufgrund dieser intellektuellen Gratwanderung ist besonders zu betonen, dass der Inhalt dieses Beitrags ausschließlich die private Meinung des Autors darstellt. Der Autor dankt Walpurga Köhler-Töglhofer und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des OeNB-Autorenworkshop vom 24. Jänner 2020 für hilfreiche Kommentare und Anregungen sowie Nicole Schmidt für wissenschaftliche Assistenz. Gewidmet ist dieser Artikel schließlich Dr. Alfred Mair, dem kürzlich, viel zu früh verstorbenen Bundeskartellanwalt.
207 Aufgrund der Längenbeschränkung können nur die wettbewerbspolitisch wichtigsten Schwerpunkte thematisiert werden.
208 Siehe dazu Regierungsvorlage – 926 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XXII. GP.
209 Vgl. Regierungsvorlage – 1775 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XX. GP.
210 Mit der Etablierung der Bundeswettbewerbsbehörde und des Bundeskartellanwalts als Amtsparteien durch die KartG-Nov. 2002 wurde die amtswegige Einleitung von kartellrechtlichen Verfahren durch das Kartellgericht wieder abgeschafft. Für Details dazu siehe Kapitel 3.
211 Vgl. Materialien des Vorhabens (Vorblatt, Erläuterungen, Textgegenüberstellungen) 1005 der Beilagen (XXI. GP des Nationalrates), Erläuterungen - Allg. Teil lit b, 17f.
212 Vgl. Tätigkeitsberichte BKAnw: https://www.justiz.gv.at/html/default/8ab4a8a422985de30122a92c3e89637f.de.html.
213 Vgl. 926 der Beilagen XXII. GP des Nationalrates – Regierungsvorlage – Materialien, 4.
214 Nach Art. 101 AEUV (vormals 81 EGV) Abs. 1 sind bestimmte Wettbewerbsbeschränkungen verboten; gemäß Abs. 3 leg. cit. kann dieses Verbot unter bestimmten Voraussetzungen für nicht anwendbar erklärt werden und zwar einerseits in Einzelfällen, andererseits für Gruppen von solchen Fällen. Wettbewerbsbeschränkungen im Sinn des 101 AEUV (vormals 81 EGV) Abs. 1, welche die Voraussetzungen des Abs. 3 erfüllen, sind erlaubt, ohne dass dies einer vorherigen Entscheidung der Europäischen Kommission bedarf (Art. 1 Abs. 2 VO 1/2003).
215 Vgl. 926 der Beilagen XXII. GP des Nationalrates – Regierungsvorlage – Materialien, 2.
216 Einbeziehung von kooperativen Gemeinschaftsunternehmen in die Zusammenschlusskontrolle, Erhöhungen im Bereich der Aufgriffsschwellen, Ausnahmen für bestimmte Zusammenschlüsse ohne spürbare Auswirkungen auf den inländischen Markt, Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens nicht mehr beim Kartellgericht, sondern bei der Bundeswettbewerbsbehörde.
217 Vgl. 926 der Beilagen XXII. GP des Nationalrates – Regierungsvorlage – Materialien, 3.
218 Für Details siehe https://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html.
219 Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen.
220 Siehe https://www.bwb.gv.at/branchenuntersuchungen/.
221 Die Aufgaben der Bundeswettbewerbsbehörde umfassen u. a. Branchenuntersuchungen (§ 2 Abs. 1 Zif 3 WettbG) und das Wettbewerbsmonitoring (leg. cit. Zif 8) als getrennt angeführte Tätigkeiten. Ein (vereinfachtes) Wettbewerbsmonitoring ausschließlich in Form von Branchenuntersuchungen ist deshalb gesetzlich nicht gedeckt, da damit das Wettbewerbsmonitoring als eigene Aufgabe ihres Sinnes entleert wird.
222 https://www.justiz.gv.at/file/8ab4a8a422985de30122a92c3e89637f.de.0/leitbild_bkanw.pdf?forcedownload=true.
223 Obgleich die Ernennung der Mitglieder der WBK ad personam erfolgt, um (theoretisch) unabhängig agieren zu können, schlägt (freilich wenig überraschend) mitunter in der Praxis eine starke Bindung zur Institution, der die Mitglieder nahestehen, durch. Durch die rezente Berufungspolitik des Wirtschaftsministeriums wird dieses Problem noch verstärkt. So stehen mehr Mitglieder den je (aktuell fünf von acht) den großen Interessensvertretungen nahe, während weniger denn je (lediglich ein Ersatzmitglied) einen hauptberuflichen Hintergrund in Wissenschaft und Forschung vorweisen können. Auch diesbezüglich könnte sich Österreich an der deutschen Monopolkommission ein Vorbild nehmen.
224 Aufgrund der Geringfügigkeit der Remuneration (gedeckelt mit ca. 2.000 EUR pro Mitglied und Jahr) kann die Mitgliedschaft in der Wettbewerbskommission als Ehrenamt qualifiziert werden.
225 § 32 Abs. 2 (neu) KartG: „Von den Geldbußen sollen jährlich 1,5 Millionen Euro für Zwecke der Bundeswettbewerbs-behörde verwendet werden.“
Langfristige Determinanten der österreichischen Inflation – die Rolle des EU-Beitritts
Teresa Messner, Fabio Rumler 226
Wissenschaftliche Begutachtung: Helmut Hofer, Institut für Höhere Studien (IHS)
In dieser Studie beschäftigen wir uns mit der Frage, ob und wie sich der Inflationsprozess in Österreich durch die Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den letzten Jahrzehnten, wie etwa aufgrund des EU-Beitritts, der Bildung der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU), der Globalisierung sowie der Finanz- und Wirtschaftskrise, verändert hat. Zu diesem Zweck werden verschiedene Spezifikationen einer erweiterten Phillips-Kurve zuerst auf Strukturbrüche getestet und anschließend für verschiedene Subperioden sowie mit zeitvariablen Koeffizienten unter Verwendung von statistischen Glättungstechniken geschätzt. Dabei werden drei signifikante Strukturbrüche gefunden: einer Mitte der 1980er-Jahre, den wir mit dem Beginn der Great Moderation – einer Phase geringer makroökonomischer Volatilität – in Verbindung bringen, ein weiterer im Jahr 1995, der mit dem EU-Beitritt Österreichs zusammenfällt und ein dritter im Jahr 2000, der den Beginn der WWU markiert. Die Subperioden- und zeitvariablen Koeffizientenschätzungen ergeben, dass es in Österreich die meiste Zeit in den vergangenen 40 Jahren eine stabile Phillips-Kurve gab. Es bestand somit ein positiver Zusammenhang zwischen Inflations- und Konjunkturentwicklung, der aber in den 1990er-Jahren vorübergehend schwächer wurde. In dieser Phase dürften externe Faktoren, wie der EU-Beitritt, die Errichtung der WWU und die Globalisierung einen stärkeren Einfluss auf die österreichische Inflation bekommen haben. Interessanterweise hatte die Geldpolitik erst ab dem Beginn der WWU einen messbaren Einfluss auf die laufende Inflationsentwicklung, was darauf hindeutet, dass die Transmission der stabilitätsorientierten Geldpolitik des Eurosystems in Österreich gut funktioniert.
JEL classification: E31, E32, E52, F15
Keywords: Langfristige Inflationsdeterminanten, Österreich, Phillips-Kurven-Schätzung, Schätzung mit zeitvariablen Koeffizienten
Die Inflationsentwicklung in Österreich unterlag seit den 1970er-Jahren verschiedensten internationalen und nationalen Einflussfaktoren. 227 Mitte der 1970er-Jahre und Anfang der 1980er-Jahre führten die historischen Ölpreisschocks zu Inflationsraten jenseits der 5% (Grafik 1). Ab dem Jahr 1982 setzte eine Disinflationsphase ein, die ihren Ursprung in einer besonders restriktiven Geldpolitik der Federal Reserve Bank unter ihrem damaligen Vorsitzenden Paul Volcker („Volcker Disinflation“, vgl. Goodfriend und King, 2005, oder Hetzel, 2008) hatte und nach und nach alle Industrieländer erfasste. Diese Disinflationsphase wirkte bis etwa 1987 fort und ist in wirtschaftshistorischer Betrachtung Teil der sogenannten „Great Moderation“, einer in den 1980er-Jahren einsetzenden Phase rückläufiger makroökonomischer Volatilität (vgl. Stock und Watson, 2003 oder Bernanke, 2004). Zu Beginn der 1990er-Jahre stieg die Inflation in Österreich wieder leicht, bevor sie in der Phase unmittelbar vor und auch nach dem österreichischen EU-Beitritt bis etwa zum Beginn der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) Ende der 1990er-Jahre erneut zurückging. Neben der Integration Österreichs in den EU-Binnenmarkt wirkten in dieser Phase wohl auch die einsetzende Digitalisierung und die fortschreitende Globalisierung 228 der Wirtschaft inflationsdämpfend. Zu Beginn der 2000er-Jahre und erneut in den Jahren unmittelbar vor der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007–2008 nahm die Inflation aufgrund gestiegener Öl- und Nahrungsmittelpreise wieder zu, bevor sie aufgrund der durch die Finanz- und Wirtschaftskrise ausgelösten Rezession 2009 massiv einbrach. Mit dem Aufschwung nach der Krise erholte sich auch die österreichische Inflation wieder und bewegt sich seither um die 2%-Marke.
In dieser historischen Beschreibung sind bereits die wichtigsten langfristigen Determinanten der österreichischen Inflationsentwicklung enthalten: der geldpolitische Regimewechsel in den 1980er-Jahren in den USA und in den späten 1990er-Jahren in Europa, außenwirtschaftliche Rohstoffpreisschocks, vor allem Ölpreisschocks, Integrations- und Globalisierungseffekte, die heimische Konjunktur und Veränderungen der Produktivität. Im Folgenden werden diese Inflationsdeterminanten im Rahmen eines erweiterten Phillips-Kurven-Modells für Österreich geschätzt, wobei insbesondere untersucht wird, ob und wie sich der Inflationsprozess in den letzten 40 Jahren durch den EU-Beitritt oder durch andere wichtige Ereignisse (WWU, deutsche Wiedervereinigung, Finanz- und Wirtschaftskrise) verändert hat. In Grafik 1 ist die langfristige Inflationsentwicklung in Österreich nach dem nationalen Verbraucherpreisindex (VPI) und dem Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) dargestellt. In den 1970er-Jahren war die Inflation aufgrund wiederholter massiver Ölpreisschocks sehr hoch und volatil, weshalb unsere ökonometrische Untersuchung – in Übereinstimmung mit vielen anderen Studien zu diesem Thema (vgl. Hindrayanto et al., 2019, für Euroraumländer oder Nicolini et al., 2013, für die USA) – erst mit dem Jahr 1980 beginnt (umrandeter Teil in Grafik 1). Der HVPI, der zur besseren internationalen Vergleichbarkeit der Inflation innerhalb der EU geschaffen wurde, wurde in Österreich mit dem EU-Beitritt eingeführt und ist rückgerechnet ab 1988 verfügbar. Da sich die VPI- und HVPI-Inflationsraten jedoch kaum voneinander unterscheiden und der HVPI nicht für den gesamten Untersuchungszeitraum zur Verfügung steht, basieren wir die empirische Untersuchung unserer Studie auf der VPI-Inflationsrate.
Im folgenden Kapitel wird die empirische Methode unserer Studie vorgestellt und dabei auf die Spezifikationen der Phillips-Kurven-Schätzungen eingegangen. Kapitel 2 enthält die Präsentation und Diskussion der Resultate unserer Schätzungen sowohl für die Modelle mit konstanten Koeffizienten als auch für die zeitvariablen Koeffizienten, bevor schließlich in Kapitel 3 mögliche wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen gezogen werden.
1 Methode: Phillips-Kurven-Schätzungen für Österreich
Die Phillips-Kurve ist das gebräuchlichste makroökonomische Modell zur Erklärung der Inflationsrate in der kurzen bis mittleren Frist (vgl. Gordon, 2011, für die traditionelle Phillips-Kurve sowie Galí, 2008, für die Neukeynesianische Phillips-Kurve). Sie formalisiert den kurz- bis mittelfristigen Zusammenhang zwischen Inflation und der realwirtschaftlichen Entwicklung und wurde in empirischen Anwendungen häufig um weitere Variablen, die ebenfalls einen messbaren Einfluss auf die heimische Inflation haben, wie z. B. Importpreise, Arbeitsmarktvariablen, etc., erweitert. Mithilfe der erweiterten Phillips-Kurve untersuchen wir die Frage, ob es in Österreich einen stabilen Zusammenhang zwischen Inflation und realwirtschaftlicher Entwicklung gibt und ob sich dieser Inflationsprozess durch den EU-Beitritt verändert hat. Zu diesem Zweck wird das Phillips-Kurven-Modell auf Strukturbrüche getestet und in der Folge für verschiedene Subperioden sowie mit zeitvariablen Koeffizienten geschätzt.
In unserer Standardspezifikation schätzen wir folgendes Phillips-Kurven-Modell für den Zeitraum vom ersten Quartal 1980 bis zum dritten Quartal 2019:
(1)
Dabei stellt
π
die VPI-Inflationsrate im Quartalsabstand,
229
μ
eine Konstante,
gap
die inflationstreibende realwirtschaftliche Variable – in unserem Fall ein Maß für die Produktionslücke,
230
X
einen Vektor mit Kontrollvariablen, mit denen die Phillips-Kurve erweitert wird, und
ϵ
einen Vektor mit identischen und unabhängig verteilten (i.i.d.) Zufallsfehlern dar. Als Kontrollvariablen verwenden wir (i) die Veränderung des Rohölpreises, um für rohstoffpreisbedingte, importierte Inflation zu kontrollieren,
231
(ii) die Veränderungen der Arbeitsproduktivität, um für die im Untersuchungszeitraum erfolgte Digitalisierung der Produktionstechnologien zu kontrollieren, (iii) ein Maß für die Offenheit der Volkswirtschaft
um für die wirtschaftliche Integration Österreichs und Globalisierung zu kontrollieren, (iv) den geldpolitischen Zinssatz und in einer Spezifikation auch die deutsche Inflationsrate.
232
Zusätzlich, um die Anpassungsgüte (fit) der Regression zu verbessern, nehmen wir verzögerte Werte der Inflationsrate in die Schätzung auf und auch die Kontrollvariablen können kontemporär oder zeitverzögert in die Schätzung eingehen.
Im ersten Schritt wird die beschriebene Spezifikation linear geschätzt, d. h. mit konstanten Koeffizienten für den gesamten Zeitraum (1980–2019), um festzustellen, ob für Österreich ein langfristig stabiler Phillips-Kurven-Zusammenhang existiert. Da in den betrachteten 40 Jahren einige fundamentale Änderungen des wirtschaftlichen Umfelds stattgefunden haben, die mutmaßlich auch Einfluss auf den Inflationsprozess hatten, untersuchen wir im nächsten Schritt unsere Phillips-Kurven-Schätzung auf Strukturbrüche. Wir verwenden dazu die Testmethode von Bai und Perron (2003), die mithilfe einer sequenziellen Prozedur multiple Strukturbrüche mit unbekanntem Datum in der Schätzgleichung sucht. In der Folge präsentieren wir die Schätzungen für die auf den gefundenen Strukturbrüchen basierenden Subperioden. Alle Gleichungen werden mittels Ordinary Least Squares (OLS) geschätzt. Die Standardfehler der Koeffizienten sind robust gegenüber Heteroskedastizität und Autokorrelation (HAC-robuste Standardfehler).
Zeitreihen mittels linearer Modelle zu schätzen, hat den Vorteil, dass die Implementierung relativ einfach ist und die Resultate leicht interpretierbar sind. Allerdings werden hierbei zeitinvariante Zusammenhänge unterstellt. Um einen kontinuierlichen Pfad der Koeffizienten untersuchen zu können, wird das zuvor spezifizierte lineare Modell in Gleichung (1) auch mit zeitvariablen Koeffizienten geschätzt. Hierbei wird unterstellt, dass die Modellkoeffizienten eine unbekannte Funktion der Zeit sind, wodurch die Regressionsgleichung wie folgt angepasst wird:
(2)
Hier stellt y t die abhängige Variable dar, X' t enthält die oben erwähnten erklärenden Variablen und die Koeffizienten β t =(β 0t , β 1t ,…β dt )' werden nun als zeitvariabel angenommen (vgl. Casas und Fernandez-Casal, 2019). Da wir keine funktionale Form über den Pfad der Koeffizienten über die Zeit annehmen, greifen wir auf lokale Regressionsmethoden mit einem nicht-parametrischen Schätzer, den Nadaraya-Watson-Schätzer zurück (vgl. Nadaraya, 1964, und Watson, 1964). Die zugrunde liegende Idee ist, für jedes Zeitintervall ( t ± h ) eine lokal konstante Schätzung durchzuführen. Jenen Beobachtungen, die näher beim untersuchten Zeitpunkt t liegen, wird dabei ein größeres Gewicht gegeben, als weiter entfernten. Der Nadaraya-Watson-Schätzer ist somit ein lokaler Durchschnitt der β 1 ,…, β n um den untersuchten Zeitpunkt herum. Zentral für diese Methode ist die Wahl des Zeitfensters, h („bandwidth“), die den Grad der Glättung der Koeffizienten bestimmt. Ein größeres Fenster impliziert zwar eine kleinere Varianz, allerdings ist die Schätzung verzerrt. Im Extremfall wird der Koeffizient derart geglättet, sodass dieser wieder seinem konstanten Gegenstück aus der linearen Regression gleicht. 233 Da derartige Methoden bei geringer Beobachtungszahl bzw. hoher Dimensionalität zunehmend schwächer werden, werden die in der linearen Schätzung verwendeten zusätzlichen Lag-Variablen der Inflationsrate (zweiter und dritter Lag) aus der Regressionsgleichung ausgeschlossen.
2 Produktionslücke, Ölpreise, Produktivitätsentwicklung, wirtschaftliche Integration und Geldpolitik beeinflussen die Inflationsentwicklung in Österreich
Ein Hauptergebnis unserer Untersuchung ist, dass wir einen langfristig bestehenden Phillips-Kurven-Zusammenhang zwischen Inflation und Konjunkturentwicklung in Österreich finden. In der ersten Spalte der Tabelle 1 sind die Ergebnisse unserer Standardspezifikation für den gesamten Untersuchungszeitraum (Q1 80–Q3 19) angeführt. Die heimische Produktionslücke hatte und hat demnach einen positiven und signifikanten Einfluss auf die österreichische Inflationsrate, d.h. eine positive Produktionslücke wirkt inflationstreibend, eine negative inflationsdämpfend. Der angeführte Koeffizient von 0,08 bedeutet, dass bei einer Ausweitung der (positiven) Produktionslücke um einen Prozentpunkt, die Inflation im Durchschnitt um 8 Basispunkte zunimmt. Die Schätzung enthält weiters auch drei Lags der Inflationsrate als erklärende Variablen, die notwendig sind, um Autokorrelation in den Residuen zu vermeiden. Alle drei Lags sind statistisch signifikant, was auf eine starke Autokorrelation der abhängigen Variablen – der österreichischen Inflation – hindeutet. Von den Kontrollvariablen haben das Wachstum des Ölpreises sowie der Grad der Offenheit einen signifikanten positiven bzw. negativen Einfluss auf die Inflationsrate. Die Veränderung der Produktivität und der geldpolitische Zinssatz zeigen hingegen über den gesamten Untersuchungszeitraum betrachtet keinen signifikanten Einfluss auf die Inflationsrate.
Eine Schätzung der Phillips-Kurve über 40 Jahre verdeckt allerdings die Tatsache, dass sich die wirtschaftlichen Zusammenhänge in diesem langen Zeitraum sehr wahrscheinlich verändert haben. Insbesondere aufgrund der Veränderungen der wirtschaftlicher Rahmenbedingungen (wie bereits erwähnt: EU-Beitritt, WWU, Finanz- und Wirtschaftskrise) dürfte sich der Inflationsprozess in Österreich über die Zeit verändert haben. Um dies zu testen, führen wir im nächsten Schritt Strukturbruchtests nach Bai und Perron (2003) 234 für unsere Phillips-Kurven-Spezifikation durch und finden dabei drei signifikante Strukturbrüche im Untersuchungszeitraum: erstes Quartal 1986, erstes Quartal 1995 und drittes Quartal 2000. Der erste Strukturbruch beschreibt das Ende des trendmäßigen Rückganges der Inflation in den 1980er-Jahren und fällt mit der in der Einleitung beschriebenen Great Moderation zusammen. Der zweite Strukturbruch trifft genau den Zeitpunkt des EU-Beitritts und liefert erste Evidenz dafür, dass sich der österreichische Inflationsprozess nach dem – und möglicherweise auch durch den – EU-Beitritt verändert hat. Der dritte gefundene Strukturbruch markiert etwa den Beginn der WWU und deutet ebenso darauf hin, dass die Bildung der Währungsunion einen Effekt auf den Inflationsprozess in Österreich hatte.
| Schätzperioden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 80–Q3 19 | Q1 80–Q4 85 | Q1 86–Q4 94 | Q1 95–Q2 00 | Q3 00–Q3 19 | |
| Erklärende Variablen | |||||
| Inflation (-1) | 0,3159*** | 0,0325 | –0,4493*** | –0,0954 | 0,2373** |
| (0,0796) | (0,1395) | (0,1657) | (0,1813) | (0,0957) | |
| Inflation (-2) | 0,1761*** | 0,0409 | –0,5207*** | 0,3382** | –0,0258 |
| (0,0652) | (0,1171) | (0,1594) | (0,1693) | (0,0930) | |
| Inflation (-3) | 0,1448* | 0,1018 | –0,0451 | 0,1426 | 0,0381 |
| (0,0804) | (0,1686) | (0,1786) | (0,2822) | (0,0812) | |
| Produktionslücke | 0,0819*** | 0,4178*** | –0,0163 | 0,3451*** | 0,1248*** |
| (0,0313) | (0,1140) | (0,0221) | (0,0614) | (0,0308) | |
| Δ Rohölpreis | 0,0071*** | –0,0341*** | –0,0020 | –0,0033 | 0,0083*** |
| (0,0012) | (0,0112) | (0,0043) | (0,0020) | (0,0013) | |
| Δ Produktivität | –0,0419 | –0,5203*** | 0,0444 | –0,0828 | –0,0705* |
| (0,0406) | (0,1452) | (0,0497) | (0,0530) | (0,0382) | |
| Grad der Offenheit2 | –0,0040* | 0,0081 | 0,0353*** | –0,0296*** | –0,0160*** |
| (0,0022) | (0,0226) | (0,0102) | (0,0094) | (0,0060) | |
| Geldpolitischer Zinssatz (-2) | –0,0173 | 0,1830*** | 0,1391*** | –0,0867 | –0,1015** |
| (0,0193) | (0,0677) | (0,0364) | (0,1151) | (0,0405) | |
| Konstante | 0,0014** | 0,0072*** | 0,0265*** | –0,0064*** | 0,0037*** |
| (0,0006) | (0,0152) | (0,0070) | (0,0022) | (0,0006) | |
| Angepasstes R2 | 0,54 | 0,45 | 0,44 | 0,38 | 0,58 |
| Anzahl der Beobachtungen | 159 | 24 | 36 | 22 | 77 |
| Quelle: Eigene Berechnungen. | |||||
| 1 Abhängige Variable: Österreichische VPI-Inflation (quartalsweise); Drei signifikante Strukturbrüche: Q1 86, Q1 95, Q3 00. | |||||
| 2 (Exporte+Importe)/BIP. | |||||
| Anmerkung: *** p-Wert<0,01, ** p-Wert<0,05, * p-Wert<0,1; Bai-Perron (2003) Test für multiple unbekannte Strukturbrüche, sequenzielle Testprozedur; OLS Subperiodenschätzungen gemäß den gefundenen Strukturbrüchen, HAC-robuste Standardfehler in Klammern. | |||||
Die Schätzergebnisse für die aus diesen Strukturbrüchen hervorgehenden Subperioden sind in der rechten Hälfte von Tabelle 1 angeführt: Für die erste Subperiode (Q1 80–Q4 85) – die Phase der einsetzenden Great Moderation – hatte die Produktionslücke aufgrund der in dieser Zeit stärker ausgeprägten Konjunktur- und Inflationszyklen einen sehr großen Einfluss auf die Inflation in Österreich. In dieser Phase könnte auch der verzeichnete Anstieg der Produktivität – gemessen als Arbeitsproduktivität pro Beschäftigtem – zum Rückgang der Inflationsrate beigetragen haben. In der darauffolgenden Subperiode vor dem EU-Beitritt (Q1 86–Q4 94) ist der Koeffizient der Produktionslücke insignifikant, bevor dann in der Phase nach dem EU-Beitritt wieder ein starker und signifikanter Phillips-Kurven-Zusammenhang für Österreich verzeichnet wird. Nach dem EU-Beitritt trägt zudem die zunehmende wirtschaftliche Integration Österreichs in Europa zum Inflationsrückgang bis Ende der 1990er-Jahre bei, was in der Schätzung durch den negativen und signifikanten Koeffizienten unseres Indikators für die Offenheit der Volkswirtschaft angezeigt wird. In der letzten Subperiode (Q3 00–Q3 19), die etwa den Zeitraum seit Beginn der WWU umfasst, übt nicht nur der mit der Globalisierung einhergehende Anstieg der Offenheit der Volkwirtschaft einen signifikanten Einfluss auf die österreichische Inflationsrate aus, sondern auch die Geldpolitik des Eurosystems. Ein negatives Vorzeichen unseres Indikators für die Geldpolitik – des zweiten Lags des geldpolitischen Zinssatzes 235 – bedeutet, dass ein Anstieg des Zinssatzes mit einem (verzögerten) Rückgang der Inflationsrate einhergeht. In der letzten Subperiode hatte auch die Veränderung des Ölpreises wieder einen stärkeren Einfluss auf die Inflationsrate. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ab etwa 2005 wieder stärkere Ölpreisschwankungen aufgetreten sind, die in der Folge zu Schwankungen der Inflationsrate geführt haben. 236
Die Ergebnisse für die Subperioden legen bereits nahe, dass die Determinanten der österreichischen Inflationsentwicklung über die Zeit variieren. Aus diesem Grund führen wir als nächsten Schritt eine Schätzung der Phillips-Kurve mit zeitvariablen Koeffizienten durch, deren Ergebnisse in Grafik 2 dargestellt werden. Diese bestätigen bzw. ergänzen großteils die Subperiodenschätzungen, wobei die Koeffizienten der ersten drei Subperiodenschätzungen, die auf relativ wenigen Beobachtungen beruhen, teilweise etwas abweichen (was Vorzeichen und Signifikanz betrifft). 237 Die Ergebnisse für die zeitvariablen Koeffizientenschätzungen zeigen, dass die Stärke des Phillips-Kurven-Zusammenhangs insbesondere in der Zeit der Great Moderation deutlich abgenommen hat, aber dennoch immer (mit Ausnahme einiger kurzer Phasen in der Mitte der Zeitreihe) signifikant blieb (Grafik 2, Abbildung rechts oben). 238 Damit zeigen die Ergebnisse dieser Studie, dass es entgegen der Diskussion in der internationalen Literatur (Powell, 2018; Haldane, 2018; Hall, 2013) für Österreich – insbesondere für die Zeit nach der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise – keinen Beleg für den Zusammenbruch der Phillips-Kurve gibt.
In Bezug auf die Wirkung der Produktivität sowie des Offenheitsgrades auf die Inflation (Grafik 2, Abbildung Mitte und unten links) stimmen die Ergebnisse mit dem in der Einleitung diskutierten Phänomen der globalen Disinflation in den 1980er-Jahren überein. In den Jahren vor und nach dem EU-Beitritt ist der preisdämpfende Effekt der Produktivität und der Offenheit der Volkswirtschaft allerdings nicht mehr klar ersichtlich. Erst ab Mitte der 2000er-Jahre bzw. mit dem Einsetzen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise scheinen diese strukturellen Faktoren wieder eine signifikante Rolle für die Inflationsentwicklung in Österreich gespielt zu haben. Die nicht-parametrische Analyse deutet außerdem auf den geldpolitischen Regimewechsel Ende der 1990er-Jahre (Abbildung Mitte rechts) bzw. die möglicherweise unterschiedliche Zentralbankreaktionsfunktion vor und nach Schaffung der Währungsunion hin. Der positive Zusammenhang zwischen geldpolitischem Zinssatz und Inflationsrate in den Jahren vor der Bildung der WWU könnte auf eine beeinträchtigte geldpolitische Transmission während wirtschaftspolitisch turbulenteren Zeiten (deutsche Wiedervereinigung, Schwierigkeiten im Europäischen Währungssystem, etc.) hindeuten. Zudem war die österreichische Geldpolitik vor der WWU auf eine Hartwährungspolitik ausgerichtet, die weniger die geldpolitische Transmission als die strikte Wechselkursbindung zur Deutschen Mark im Fokus hatte. Auch der zeitvariable Koeffizient der Änderung des Ölpreises (Abbildung rechts unten) stimmt mit dem Ergebnis der Subperiodenschätzung überein und deutet auf einen in der zweiten Hälfte des Untersuchungszeitraumes stärkeren Einfluss der Ölpreise auf den heimischen Inflationsprozess hin, der aus stärkeren Ölpreisschwankungen in diesem Zeitraum resultieren dürfte.
3 Schlussfolgerungen
In dieser Studie werden die langfristigen Determinanten der österreichischen Inflationsentwicklung untersucht und wir gehen insbesondere der Frage nach, ob die Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den letzten 40 Jahren den Inflationsprozess in Österreich beeinflusst hat. Zu diesen Rahmenbedingungen gehören die EU-Integration Österreichs, die deutsche Wiedervereinigung, die Zentralisierung der Geldpolitik in der WWU, die Globalisierung und die Finanz- und Wirtschaftskrise. Der Einfluss dieser Faktoren auf die Inflation wird empirisch mithilfe einer Phillips-Kurven-Schätzung u.a. mit zeitvariablen Koeffizienten untersucht.
Insgesamt liefern die Schätzergebnisse einen Beleg dafür, dass sich die langfristigen Determinanten der österreichischen Inflation über die Zeit verändert haben. Der Zusammenhang zwischen Produktionslücke und Inflation – das Kernstück der Phillips-Kurve – ist zwar die meiste Zeit im Untersuchungszeitraum positiv und signifikant, schwächte sich aber während der 1990er-Jahre vorübergehend ab. In dieser Phase dürften zunehmend externe Faktoren, wie der EU-Beitritt, die Errichtung der WWU und die Globalisierung einen stärkeren Einfluss auf die österreichische Inflation ausgeübt haben. Nach der Jahrtausendwende und insbesondere in der großen Rezession nach der Finanz- und Wirtschaftskrise nimmt der Einfluss der heimischen Konjunktur auf die Inflationsentwicklung aber wieder deutlich zu. Die durch die Krise induzierte höhere Volatilität der Konjunktur- und Inflationsentwicklung dürfte sich in einem stärkeren Zusammenhang dieser beiden Variablen niedergeschlagen haben. Davon abgesehen hatte auch der Rohölpreis während des gesamten Untersuchungszeitraums einen dauerhaft starken Einfluss auf die österreichische Inflation, der mit den ab 2005 verzeichneten Ölpreisschwankungen sogar noch zugenommen hat. Was den Einfluss der Geldpolitik auf die Inflation betrifft, so zeigt sich ein eindeutiger und signifikanter Effekt im Sinne des geldpolitischen Transmissionsmechanismus. Das bedeutet einen verzögerten Rückgang der Inflation infolge eines Zinsanstieges und vice versa in den letzten 15 bis 20 Jahren. Dies lässt den Schluss zu, dass der Einfluss der Geldpolitik des Eurosystems auf die österreichische Inflationsentwicklung nun stärker ist als in Zeiten der österreichischen Hartwährungspolitik vor der WWU.
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Österreich werden sich auch in der Zukunft weiter verändern: Die fortschreitende Binnenmarktintegration durch die EU-Erweiterung (insbesondere um die für den österreichischen Außenhandel wichtigen Balkanländer) sowie die künftige Entwicklung der Digitalisierung (Zunahme des Online-Handels), der Globalisierung und die Auswirkungen des Klimawandels dürften den Inflationsprozess in Österreich in den nächsten Jahren beeinflussen. Die Abschätzung dieser Effekte sowie anderer derzeit dynamischer Entwicklungen wie zum Beispiel die Effekte der COVID-19-Pandemie wird eine Herausforderung für die österreichische Inflationsforschung darstellen.
Literaturverzeichnis
Bai, J. und P. Perron. 2003. Computation and analysis of multiple structural change models. In: Journal of Applied Econometrics 18(1). 1–22.
Beer, C., E. Gnan und M. T. Valderrama. 2016. Die wechselvolle Geschichte der Inflation in Österreich. Monetary Policy & the Economy Q3-Q4/16. OeNB. 6–35.
Bernanke, B. S. 2004. The Great Moderation. Remarks at the meetings of the Eastern Economic Association. Washington DC. 20 Februar.
Bernoth, K. und B. Erdogan. 2010. Sovereign bond yield spreads: A time-varying coefficient approach. DIW Discussion Papers 1078. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Berlin.
Casas I. und R. Fernandez-Casal. 2019. TvReg: Time-Varying Coefficients Linear Regression for Single and Multi-Equations in R. SSRN. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3363526.
Galí, J. 2008. Monetary Policy, Inflation and the Business Cycle. An Introduction to the New Keynesian Framework and Its Applications. Princeton University Press.
Glatzer, E., E. Gnan und M.T. Valderrama. 2006. Globalization, Import Prices and Producer Prices in Austria. Monetary Policy & the Economy Q3/06. OeNB. 24–43.
Gnan, E. und M.T. Valderrama. 2006. Globalization, Inflation and Monetary Policy. Monetary Policy & the Economy Q4/06. OeNB. 37–54.
Goodfriend, M. und R. G. King. 2005. The incredible Volcker disinflation. In: Journal of Monetary Economics 52 (2005). 981–1015.
Gordon, R. J. 2011. The history of the Phillips curve: consensus and bifurcation. In: Economica. 78. 10–50.
Hall, R. E. 2013. The Routes into and out of the Zero Lower Bound. Rede für Federal Reserve Bank of Kansas City’s Jackson Hole Symposium: Global Dimensions of Unconventional Monetary Policy. 23. August.
Haldane, A. 2018. Pay Power. Acas “Future of Work” Conference Congress Centre. London.10. Oktober.
Hetzel, R. J. 2008. The Volker Disinflation. In: The Monetary Policy of the Federal Reserve. A History. Cambridge University Press. 150–171.
Hindrayanto, I., A. Samarina und I. M. Stanga. 2019. Is the Phillips curve still alive? Evidence from the euro area. In: Economics Letters 174(C). 149–152.
Jobst, C. und H. Kernbauer. 2016. Die Bank. Das Geld. Der Staat. Nationalbank und Währungspolitik in Österreich 1816–2016. Campus.
Moretti, L., L. Onorante und S. Z. Saber. 2019. Phillips curves in the euro area. ECB Working Paper 2295. European Central Bank.
Nadaraya, E. A. 1964. On Estimating Regression. Theory of Probability and Its Applications. 9 (1): 141–142.
Nicolini, J. P., B. Holtemeyer und T. J. Fitzgerald. 2013. Is there a stable Phillips Curve after all? Economic Policy Paper 13-6. Federal Reserve Bank of Minneapolis.
Powell, J. 2018. Monetary Policy and Risk Management at a Time of Low Inflation and Low Unemployment. Rede für Revolution or Evolution? Reexamining Economic Paradigms. 60th Annual Meeting of the National Association for Business Economics. Boston. Massachusetts. 2. Oktober.
Stock, J. H. und M. W. Watson. 2003. Has the Business Cycle Changed? Paper presented at the Federal Reserve Bank of Kansas City. Monetary Policy and Uncertainty: Adapting to a Changing Economy. Symposium Jackson Hole WY. 28. bis 30. August.
Wassermann, L. 2006. All of Nonparametric Statistics. In: Springer Texts in Statistics. Springer-Verlag New York.
Watson, G. S. 1964. Smooth regression analysis. Sankhyā. In: The Indian Journal of Statistics. Series A. 26 (4). 359–372.
Wu, C. F. J. 1986. Jackknife, bootstrap and other resampling methods in regression analysis (with discussions). Annals of Statistics. 14: 1261–1350.
226 Oesterreichische Nationalbank, Abteilung für die Analyse wirtschaftlicher Entwicklungen im Ausland, teresa.messner@oenb.at; Abteilung für volkswirtschaftliche Analysen, fabio.rumler@oenb.at. Die im Papier wiedergegebenen Meinungen und Ansichten stellen die persönlichen Meinungen der Autorin und des Autors dar und spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung der OeNB oder des Eurosystems wider. Sie danken den Teilnehmenden des Workshops zum Monetary Policy & the Economy Sonderheft „25 Jahre EU-Mitgliedschaft Österreichs“, insbesondere Doris Prammer sowie Helmut Hofer für hilfreiche Kommentare und wertvolle Anregungen.
227 Für eine langfristige wirtschaftshistorische Betrachtung der Inflationsentwicklung in Österreich siehe Jobst et al. (2016) und Beer et al. (2016).
228 Glatzer et al. (2006) sowie Gnan und Valderrama (2006) untersuchen die Auswirkungen der Globalisierung auf die Inflationsentwicklung in Österreich und im Euroraum.
229 In empirischen Untersuchungen der Inflation im Euroraum (siehe etwa Moretti et al., 2019) wird oft die Kerninflationsrate als Maß für die heimische Inflation bevorzugt, aus der die zum Großteil importierte Energie sowie Nahrungsmittel herausgerechnet werden. Die Kerninflation steht allerdings für den VPI erst ab 2005 zur Verfügung, weshalb wir die Gesamtinflation als abhängige Variable wählen und in der Schätzung für die importierte Inflation kontrollieren.
230 Die Produktionslücke wurde als Abweichung des österreichischen realen BIP (saisonbereinigt) von seinem mittels Hodrick-Prescott-Filter (HP-Filter) geschätzten Trend berechnet. Eine positive Abweichung signalisiert einen Nachfrageüberhang und übt damit Preisdruck nach oben aus, während eine negative Abweichung einen Angebotsüberhang anzeigt und gegensätzlich wirkt. Zusätzlich zu dieser Produktionslücke haben wir auch mit den Produktionslücken von internationalen Organisationen (Europäische Kommission, Internationaler Währungsfonds, OECD) für Österreich, mit der Wachstumsrate des realen BIP, mit der Arbeitslosenquote, dem Arbeitslosen-Gap (Differenz zwischen Arbeitslosenquote und der NAIRU) und den Lohnstückkosten als inflationstreibende Variable in der Phillips-Kurve experimentiert. Von diesen Variablen lieferte jedoch die auf dem HP-Filter basierende Produktionslücke das beste Ergebnis im Sinne der Regressionsgüte.
231 Die Verwendung der Veränderung der gesamten Importpreise anhand des Importdeflators sowie der Veränderung der gesamten Rohstoffpreise anstatt der Ölpreise als Kontrollvariable für importierte Inflation führt zu sehr ähnlichen Ergebnissen.
232 Häufig werden in Phillips-Kurven-Schätzungen auch die Inflationserwartungen als erklärende Variable inkludiert. In unserer Schätzung ist dies für den betrachteten Zeitraum leider nicht möglich, da quantitative Inflationserwartungen – etwa von Consensus Economics – für Österreich erst ab 1999 zur Verfügung stehen.
233 Die Größe der „bandwidth“ wird in unserem Fall mithilfe der sogenannten „leave-one-out“ Cross-Validation-Methode errechnet und beträgt rund 0,4 (vgl. Wassermann, 2006; Bernoth und Erdogan, 2010).
234 Bai und Perron (2003) schlagen sequenziell durchgeführte Strukturbruchtests vor, bei denen zuerst die Hypothese getestet wird, dass es einen unbekannten Strukturbruch im Modell gibt. Dieser Test wird rekursiv durgeführt, d. h. der Test wird immer mit einer zusätzlichen Beobachtung wiederholt. Wird ein Strukturbruch gefunden, wird als nächste Hypothese getestet, ob es einen weiteren Strukturbruch gibt. Dieser Ablauf wird solange wiederholt, bis kein zusätzlicher signifikanter Strukturbruch mehr gefunden wird.
235 Aufgrund der Wirkungsverzögerung der Geldpolitik auf Inflation und Realwirtschaft geht der geldpolitische Zinssatz nicht kontemporär, sondern mit dem zweiten Lag in die Schätzgleichung ein, was eine Wirkungsverzögerung von mindestens einem halben Jahr unterstellt.
236 Aufgrund der starken wirtschaftlichen Verflechtung zwischen Österreich und Deutschland und zur Untersuchung möglicher Übertragungseffekte von der deutschen auf die österreichische Inflationsentwicklung schätzen wir eine weitere Spezifikation, in der zusätzlich die deutsche Inflationsrate als erklärende Variable enthalten ist. Die Ergebnisse dieser Schätzung zeigen einen durchgehend signifikanten und positiven Effekt der deutschen auf die österreichische Inflationsrate, der allerdings Mitte der 1990 etwas abnahm. Dies legt nahe, dass mit dem EU-Beitritt Österreichs und der nachfolgenden Diversifizierung des Außenhandels innerhalb der EU die deutsche Inflation für Österreich weniger relevant geworden ist. Bei dieser Phillips-Kurven-Schätzung finden wir interessanterweise auch einen weiteren Strukturbruch im Jahr 1992, dem Jahr der deutschen Wiedervereinigung. Die Schätzergebnisse sind auf Nachfrage erhältlich.
237 Kernel-Glättungstechniken sind an den Start- und Endpunkten der Schätzperiode ungenauer, da die Parameterschätzer dort auf weniger Datenpunkten beruhen (abgeschnittenes Kernel).
238 Die Konfidenzintervalle werden aufgrund der Zeitvariabilität der Koeffizienten mittels „wild bootstrap residual resampling“ berechnet (vgl. Wu, 1986).
Die Entwicklung des EU-Haushalts und die Auswirkungen auf Österreich
Walpurga Köhler-Töglhofer, Lukas Reiss
239
Wissenschaftliche Begutachtung: Maria Auböck, Bundeskanzleramt
Der EU-Haushalt bildet die finanziellen Verflechtungen der EU mit den einzelnen EU-Mitgliedstaaten und die politischen Prioritäten der EU ab. Die Prioritäten haben sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Dies zeigt sich vor allem im sinkenden Anteil der Ausgaben für die Agrarpolitik an den Gesamtausgaben der EU. Auch die Einnahmenstruktur hat sich im Laufe der Zeit verschoben und ist aufgrund diverser Rabatte auf die Mitgliedsbeiträge komplex. Österreich ist seit seinem Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 1995 durchgehend ein Nettozahler ins EU-Budget. Als einer der größten Nettozahler profitiert Österreich allerdings seit dem Finanzrahmen 2001–2007 von einem Rabatt auf seine Mitgliedsbeiträge. Gleichzeitig erhält Österreich vergleichsweise mehr Rückflüsse aus Mitteln der Agrarpolitik als zahlreiche andere EU-Mitgliedstaaten mit hohem Bruttonationaleinkommen pro Kopf. Der – politisch noch nicht ausverhandelte – mehrjährige Finanzrahmen der EU für die Periode 2021–2027 bringt ebenfalls eine durch die neue EU-Kommission veränderte Prioritätensetzung mit sich und wird darüber hinaus stark vom Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU beeinflusst. Die bislang von der Europäischen Kommission zur Diskussion gestellten Vorschläge signalisieren insbesondere einen zunehmenden Druck auf die EU-Agrar- und Regionalpolitik zugunsten anderer Politikbereiche wie dem Wiederaufbau der EU-Volkswirtschaften nach der COVID-19-Krise und dem Klimawandel.
JEL classification: H87, F53
Keywords: EU-Haushalt, mehrjähriger Finanzrahmen der EU, EU-Eigenmittel, Rückflüsse aus dem EU-Haushalt, Nettobeiträge
Österreich trat – gleichzeitig mit Schweden und Finnland – am 1. Jänner 1995 der Europäischen Union (EU) bei. Diese Einbindung in die EU und insbesondere in den europäischen Binnenmarkt brachte tiefgreifende Veränderungen der ökonomischen Rahmenbedingungen für die österreichische Volkswirtschaft. Die Anpassungen an den institutionellen Rahmen der EU betrafen weite Bereiche, vom Rechtsystem bis hin zur Wettbewerbs-, Steuer- und Budgetpolitik sowie den Arbeitsmarkt. Die Öffnung der Grenzen, die Liberalisierung der Faktor- und Gütermärkte und die zunehmende Mobilität der Steuerbasen reduzierten den steuerpolitischen Handlungsspielraum des Staates (Katterl und Köhler-Töglhofer, 2005). Darüber hinaus verpflichtete sich Österreich, seine Budgetpolitik im Einklang mit dem Europäischen Fiskalrahmen zu gestalten, d. h. mit den Vorgaben des Vertrags von Maastricht sowie dem 1997 beschlossenen Stabilitäts- und Wachstumspakt (Köhler-Töglhofer et al., 2019).
Mit dem Beitritt zur EU entstanden auch umfangreiche finanzielle Verflechtungen mit dem EU-Haushalt. Jeder Mitgliedstaat (MS) der EU ist verpflichtet, Mitgliedsbeiträge sowie gewisse zentral geregelte Abgaben (v.a. Zölle) an den EU-Haushalt abzuführen. Über Transferzahlungen bzw. Rückflüsse erhält Österreich jedoch einen Teil seines EU-Beitrags in Form von Förderungen an Unternehmen, Erasmus-Stipendien oder z. B. in Form einer Beteiligung der Union an den Kosten des Basisbrennertunnels zurück. Aufgrund seiner relativen ökonomischen Stärke gehört Österreich jedoch seit seinem Beitritt 1995 zu den Nettozahlern. Die Nutzung des EU-Binnenmarkts, des gegenwärtig weltweit wirtschaftlich bedeutendsten einheitlichen Binnenmarkts (Mion und Ponattu, 2019), brachte für Österreich erhebliche ökonomische Vorteile in Form eines vergleichsweise höheren Bruttoinlandsprodukts bzw. Einkommensniveaus. Dies zeigen sowohl die empirischen Untersuchungen der letzten Jahre 240 als auch Beiträge in dieser Publikation (siehe Breuss, 2020, in diesem Heft).
Finanzielle Verflechtungen im Zusammenhang mit der EU-Mitgliedschaft gibt es auch über die Instrumente der erweiterten Finanzarchitektur der EU, die über den EU-Haushalt per se hinausgehen. Sie umfasst einige Einheiten außerhalb des EU-Budgets, die mit diesem durch Garantien und/oder Transfers verbunden sind, wie den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) und diverse durchs EU-Budget besicherte Kreditfazilitäten. Zu Letzteren zählen unter anderem die Zahlungsbilanzfazilität sowie der Europäische Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM), der Irland und Portugal im Rahmen ihrer Anpassungsprogramme infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise Kredite gewährte. Dieser erweiterten Finanzarchitektur zugehörig ist auch die Europäische Investitionsbank (EIB), die zusätzliche Mittel zur Erreichung diverser Ziele der Europäischen Union (Finanzierung von KMUs, Infrastrukturprojekte, der EU-Klimawende, EIB-Außenmandat, …) aufbringt; das Eigenkapital der EIB wird aber nicht aus dem EU-Budget, sondern direkt von den MS zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden Finanzmittel auf Basis spezifischer zwischenstaatlicher Übereinkommen der EU mit den MS aufgebracht, wie etwa die Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei oder der Europäische Entwicklungsfonds (EDF). Der erweiterten EU-Finanzarchitektur zuzurechnen sind auch einige – primär – der Europäischen Währungsunion dienende Institutionen, wie die Europäische Zentralbank (EZB), der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) sowie der Einheitliche Abwicklungsfonds (Single Resolution Fund). Das neue Euroraum-Budget (Budgetary Instrument for Convergence and Competitiveness, BICC), das grundsätzlich aus dem EU-Haushalt finanziert werden soll, wäre mit jenem Finanzierungsanteil, der auf einer freiwilligen zwischenstaatlichen Vereinbarung von MS beruhen könnte, ebenso der erweiterten Finanzarchitektur der EU zuzurechnen.
Der vorliegende Artikel setzt sich mit den Besonderheiten des EU-Haushalts im engeren Sinn und seiner Verflechtung mit Österreich seit 1995 auseinander. Das erste Kapitel gibt einen Überblick über einige Spezifika des EU-Haushalts. Anschließend werden die Interdependenzen des EU-Haushalts mit Österreich seit dem Beitritt 1995 beleuchtet. Das dritte Kapitel bildet eine kurze Erörterung des künftigen – politisch noch nicht ausverhandelten – mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) der EU für die Periode 2021–2027 und der damit angestrebten Neuausrichtung der wirtschaftspolitischen Prioritäten der Union unter Bedachtnahme auf das Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU. Danach werden noch kurze Schlussfolgerungen getroffen.
1 EU-Haushalt: Schwerpunkte, Besonderheiten und Transferzahlungen
Der EU-Haushalt spiegelt zum einen die politischen Prioritäten der Union wider, zum anderen die finanziellen Verflechtungen der EU mit den einzelnen MS. Er gibt Auskunft über die Mittelherkunft in Form der der EU zugewiesenen Finanzmittel sowie über die Mittelverwendung in Form der Förderungen/Kofinanzierungen (Rückflüsse an die MS) entsprechend den Zielsetzungen bzw. politischen Prioritäten der EU. Letztere finden ihren Ausdruck insbesondere im mehrjährigen Finanzrahmen der EU. Die EU hat weder Finanzhoheit, d.h. sie hat kein Recht zur Erhebung eigener Steuern und Abgaben, noch darf sie ihre Ausgaben mittels Schuldaufnahme finanzieren, d.h. der EU-Haushalt muss grundsätzlich ausgeglichen sein.
Der EU-Haushalt wird jährlich nach Einigung im Europäischen Parlament und im Rat (mit Einstimmigkeit) auf Basis eines Vorschlags der Europäischen Kommission verabschiedet, muss aber jeweils die im mehrjährigen Finanzrahmen der EU gesteckten maximalen Ausgabenobergrenzen für die verschiedenen Ausgabenbereiche der Union respektieren. Die EU legt ihren jährlichen EU-Haushaltsplan in der Regel auf einem Niveau unterhalb der Obergrenzen fest, um erforderlichenfalls unvorhergesehene Ausgaben tätigen zu können. Damit Ausgabendisziplin gewährleistet ist, legt der Eigenmittelbeschluss (EMB), der die im Abschnitt 1.2 beschriebenen Einnahmen der EU regelt, verbindliche Obergrenzen fest, die nicht überschritten werden dürfen. Derzeit beträgt diese Grenze für die Zahlungsermächtigungen 1,20% 241 des Bruttonationaleinkommens 242 (BNE) der EU.
1.1 Ausgabenschwerpunkte sind Agrarpolitik, Regional- und Kohäsionspolitik
Die Ausgaben der EU basieren auf dem mehrjährigen (gegenwärtig siebenjährigen) Finanzrahmen (MFR) der EU, der die Ausgabenprioritäten und -plafonds für den gesamten Planungszeitraum festlegt. Der jeweils geltende mehrjährige Finanzrahmen fußt auf einer Verordnung zur Festlegung des MFR, die – nach der Zustimmung des Europäischen Parlaments – einstimmig vom Rat zu beschließen ist.
Der MFR sieht sowohl jährliche Obergrenzen für die EU-Ausgaben insgesamt als auch für die großen Ausgabenblöcke (Rubriken) vor. Diese müssen von der EK bei den jeweiligen Vorschlägen für den nächsten Jahreshaushalt – bzw. vom Europäischen Parlament und dem Rat – berücksichtigt werden. Die jährlichen Obergrenzen determinieren sowohl den maximalen Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen (rechtlich bindende Zusagen über Ausgaben, die nicht unbedingt im selben Jahr erfolgen müssen, und sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken können) in den einzelnen Rubriken als auch eine Gesamtobergrenze für Zahlungsermächtigungen. Letztere bezieht sich auf jene Beträge, deren Auszahlungen in einem bestimmten Jahr tatsächlich genehmigt werden. 243 Da der MFR die finanzielle Maximal-Ausstattung für die verschiedenen Politikbereiche vorgibt, verkörpert er die in Zahlen gegossene Politik der EU für sieben Jahre. Grafik 1 veranschaulicht die bis Mitte der 1990er-Jahre zunehmende und seitdem im Verhältnis zum Bruttonationaleinkommen stabile Größe des EU-Budgets; gleichzeitig zeigt sie die relativen Gewichtsverschiebungen der Ausgabenbereiche – und damit die Veränderung in der wirtschaftspolitischen Prioritätensetzung der EU – seit 1976.
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ist seit jeher der größte Einzelausgabenposten. Die gemeinsame Agrarpolitik wurde 1962 ins Leben gerufen und seither zahlreichen Reformen unterzogen 244 . Die GAP verfolgt grundsätzlich das Ziel, einen eigenständigen Agrarsektor in Europa aufrechtzuerhalten, d. h. in punkto Lebensmittelversorgung einen hohen Grad an Selbstversorgung bzw. Unabhängigkeit in der EU zu erhalten. 245 Gleichzeitig soll sie die ländlichen Regionen fördern und darüber hinaus auch umweltpolitischen Zielen, wie dem nachhaltigen Einsatz der natürlichen Ressourcen und der Bekämpfung des Klimawandels Rechnung tragen. Seit 1985, kurz vor Inkrafttreten des ersten mehrjährigen Haushaltsplans (Delors-Paket I für die Periode 1988–1992), sinkt der Anteil der Ausgaben für die Agrarpolitik an den Gesamtausgaben kontinuierlich. Dieser Abwärtstrend hält nach wie vor an. Über die Gemeinsame Agrarpolitik fließen in der gegenwärtigen Haushaltsperiode rund 420 Mrd EUR, wovon der Großteil (rund drei Viertel) als Subventionen für marktbezogene Maßnahmen und als Direktzahlungen an Landwirtinnen und Landwirte (erste Säule) gehen. 246 Knapp ein Viertel der GAP-Mittel steht für die zweite Säule zur Verfügung, die Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) – mit Kofinanzierungsnotwendigkeit der MS – umfasst.
In den letzten Jahrzehnten gab es einen Anstieg der Ausgaben für die Strukturpolitik, die vor allem den Kohäsions-, den Regional- und den Sozialfonds umfasst. Insbesondere die Struktur- und Kohäsionsfonds 247 zielen auf eine dauerhafte Verringerung der erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede zwischen den MS bzw. den Regionen sowie auf die Stärkung ihres Entwicklungspotenzials ab. So unterstützt der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) Regionen mit Entwicklungsrückstand und Strukturproblemen; er finanziert v.a. Investitionen zur Stärkung der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit und zur Schaffung von Arbeitsplätzen in kleinen und mittleren Unternehmen sowie Maßnahmen, die der Energieeffizienz, der Forschung und technologischen Entwicklung sowie dem Schutz der Umwelt dienen. Der Fokus des EFRE liegt damit auf Projekten, die für die Wettbewerbsfähigkeit von Regionen im Zuge der Globalisierung wichtig sind. Der Kohäsionsfonds unterstützt Vorhaben in den Bereichen Umwelt und transeuropäische Verkehrsnetze. Er kommt nur in MS mit einem Pro-Kopf-BIP von unter 90% des EU-Durchschnitts zum Tragen und beteiligt sich mit dem EFRE an mehrjährigen, dezentral verwalteten Investitionsprogrammen. Hauptbegünstigte der Mittel des Regional- und Kohäsionsfonds sind die entwicklungsschwächsten Regionen. Das sind vor allem die MS Mittel- und Osteuropas, auf die sich rund 70% der Fondsmittel konzentrieren, aber auch einige südliche Peripherieländer der WWU. Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist das wichtigste sozialpolitische Finanzierungsinstrument der EU und zielt auf die Unterstützung der Wiedereingliederung von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt. Gefördert werden Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie die soziale Integration. Die Strukturfonds wie auch der ELER folgen dem Kofinanzierungsprinzip, d. h. die MS müssen einen Anteil an der Finanzierung der Projekte übernehmen, der mit dem Einkommensniveau des MS bzw. der Region ansteigt.
Das starke Gewicht der Agrar- und Regionalpolitik war in den letzten Jahrzehnten stets umstritten. Die Erkenntnisse der ökonomischen Theorie des Föderalismus unterstützen eine europäische Finanzierung für jene Politikfelder, bei denen eine gesamteuropäische Verantwortung entweder Skalenerträge bzw. Kostenvorteile mit sich bringt oder bei denen grenzüberschreitende – positive oder negative – Externalitäten einer effizienten nationalen Bereitstellung entgegenstehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich die Präferenzen der MS bezüglich einzelner Politikfelder nur geringfügig unterscheiden. Dass aber die politischen Akteure in den MS in den Verhandlungen insbesondere die potenziellen Rückflüsse von EU-Budgetmitteln in ihre Länder vor Augen haben, entspricht wiederum der Common-Pool-Theorie. Diese besagt laut Heinemann (2018), dass ein von den MS kollektiv finanziertes gemeinschaftsweites Budget eher einen Anreiz für die Finanzierung zu vieler „lokaler/nationaler“ Aufgaben schafft. 248
In den letzten zwei Jahrzehnten nahm das Gewicht anderer Politikbereiche zu, was sich auch am gegenwärtig gültigen Finanzrahmen 2014–2020 zeigt. Dieser beinhaltet diverse Programme für Forschung, Entwicklung und Infrastruktur, die ein Fördervolumen von rund 142 Mrd EUR 249 umfassen und sich auf rund ein Fünftel des EU-Budgets belaufen. 250 Im Zuge der Halbzeitprüfung des gegenwärtigen mehrjährigen Finanzrahmens Mitte 2016 wurde den Themen Investitionsoffensive, Jugendarbeitslosigkeit und Migration mehr Bedeutung eingeräumt.
1.2 Rabatte bei EU-Beiträgen begrenzen Nettozahlungen der EU-Mitgliedstaaten mit hohem Einkommen
Finanziert wird der EU-Haushalt gemäß Art. 311 AEUV im Wesentlichen durch die sogenannten EU-Eigenmittel („own resources“), die aus von den MS für das EU-Budget eingehobenen Steuern (traditionelle Eigenmittel) sowie aus Mitgliedsbeiträgen (nationalen Beiträgen) bestehen. Die diesbezüglichen Bestimmungen zur Finanzierung sind im Eigenmittelbeschluss (EMB) festgelegt. Dieser verlangt zu seiner Verabschiedung Einstimmigkeit im Rat. Er tritt nach seiner Ratifizierung durch die MS in Kraft und gilt grundsätzlich unbefristet. 251 Aufgrund der unbefristeten Gültigkeit verfügt die EU über die erforderlichen Mittel, um den Jahreshaushalt zu finanzieren, ohne dass es eines vorangehenden Beschlusses der MS bedarf.
Grafik 2 veranschaulicht die Veränderung der Einnahmenhöhe (entsprechend den steigenden Ausgaben) sowie der Einnahmenstruktur des EU-Budgets seit 1976. Bis Anfang der 2000er-Jahre waren die sogenannten traditionellen Eigenmittel eine relativ große Einnahmenquelle. Diese umfassen Abgaben, die zwar von den MS eingehoben werden, 252 aber an die EU abgeführt werden. Der überwiegende Teil dieser Abgaben sind Zölle (derzeit kommt noch die Zuckerabgabe hinzu). Infolge der Handelsliberalisierungen schrumpfte allerdings ihre Bedeutung als Einnahmequelle für das EU-Budget. Daher wurden über die Jahrzehnte die sogenannten „nationalen Beiträge“ der MS, die aus deren jeweiligen Budgets gezahlt werden, zunehmend wichtiger.
Diese beinhalten seit 1979 die sogenannten Mehrwertsteuer-Eigenmittel, bei denen die MS einen festgelegten Prozentsatz (derzeit 0,3% für die meisten MS) einer fiktiven vereinheitlichten Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage ans EU-Budget zahlen müssen. Außerdem gibt es seit den späten 1980er-Jahren – anfangs nur als Ergänzung – auf Basis des jeweiligen Bruttonationaleinkommens abzuführende Zahlungen. Hierbei haben die MS einen gewissen Prozentsatz des BNE an die EU abzuführen, der so festgelegt wird, dass das EU-Budget laut Plan ausgeglichen ist. Auch aufgrund konzeptioneller Bedenken gegenüber der Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage (Messprobleme, höhere relative Belastung für einige einkommensschwächere MS) ist die Bedeutung der BNE-Eigenmittel als Finanzierungsquelle im Laufe der letzten drei Jahrzehnte stark gestiegen. Darüber hinaus werden etwaige Haushaltsüberschüsse aus Vorjahren in das nächste Finanzjahr übertragen und somit auch als Einnahme im EU-Budget dargestellt. Die an Bedeutung zunehmenden sonstigen Einnahmen umfassen unter anderem Geldstrafen der MS.
Das System der nationalen Beiträge bzw. Mitgliedsbeiträge ist aufgrund verschiedener Rabatte komplex. Deshalb gibt es erhebliche Unterschiede zwischen dem Verhältnis von Mitgliedsbeiträgen und BNE innerhalb der EU-MS (Grafik 3). Nicht nur das Vereinigte Königreich, sondern auch Dänemark, Deutschland, die Niederlande, Österreich und Schweden bekommen Rabatte, wobei insbesondere die Niederlande davon stark profitieren.
Ohne Rabatte wären die prozentuellen Beiträge des Bruttonationaleinkommens nahezu ident zwischen den MS (blaue Balken in Grafik 3) 253 . Es gibt drei verschiedene Rabatte:
- Rabatte auf die Mehrwertsteuereigenmittel für Deutschland, die Niederlande und Schweden (Satz von 0,15% anstatt von 0,3%; rosa Balken in Grafik 3) 254 ,
- Rabatt für das Vereinigte Königreich 255 (gelber Balken in Grafik 3; Deutschland, die Niederlande, Österreich und Schweden erhalten einen Rabatt bei der Aufteilung des UK-Rabatts auf die MS) sowie
-
Rabatte auf die BNE-Eigenmittel in Form von Pauschalbeträgen für Dänemark, die Niederlande, Österreich
256
und Schweden (grüner Balken in Grafik 3).
Grafik 3 zeigt die Höhe der nationalen Beiträge und der gewährten Rabatte in % des BNE von 2016 bis 2018. Ohne Rabatte hätten die Beiträge für alle MS etwa 0,7% des jeweiligen BNE betragen. Die MS, die keine Rabatte erhalten, zahlen in diesem Zeitraum etwa 0,8% des BNE, während die Niederlande und das Vereinigte Königreich weniger als 0,6% des BNE zahlen. Die anderen vier im Text beschriebenen Profiteure (DK, DE, AT, SE) von Rabatten liegen dazwischen.
1.3 EU-Budget sorgt trotz geringer Höhe für signifikante Umverteilung
Die vier Netto-Profiteure des komplexen Rabattsystems DE, NL, SE und UK (bei diesen liegt „Beitrag ohne Rabatte“ in Grafik 3 über den tatsächlich geleisteten „Nationalen Beiträgen“) sind MS mit sehr hohem BIP pro Kopf und vergleichsweise sehr geringen Rückflüssen aus dem EU-Budget; dies vor allem, weil sie deutlich weniger Agrarförderungen bekommen als beispielsweise Frankreich oder Österreich. Sie sind deshalb trotz ihrer reduzierten nationalen Beiträge im Nettozahler 257 -Ranking von 2014 bis 2018 auf den Plätzen 1, 2, 3 und 5; dazwischen liegt Österreich auf Platz 4 und danach Dänemark auf Platz 6 (Grafik 4).
Dank der Rabatte hat keiner der Nettozahler-Staaten einen Nettobeitrag von größer als 0,5% seines BNE zu leisten. Gleichzeitig haben aber einkommensschwächere EU-Mitgliedstaaten Nettozuflüsse von über 2% des BNE (einige sogar deutlich mehr). Diese starke Umverteilungswirkung entsteht vor allem dadurch, dass die Mittel aus den Strukturfonds größtenteils an die einkommensschwächeren MS gehen; beim Kohäsionsfonds geschieht dies definitionsgemäß, und auch beim Regionalfonds gehen die Mittel zu einem großen Teil an Regionen, die sich in einkommensschwächeren MS befinden. 258 Rückflüsse für einkommensstärkere MS gibt es vor allem in der Agrarpolitik; diese ist auch ein wichtiger Bestimmungsfaktor für die relative Höhe der Nettobeiträge der einkommensstärkeren MS. Beispielsweise bekommt Frankreich bei einem ähnlich hohen BNE pro Kopf wie das Vereinigte Königreich gar keinen Rabatt, ist aber dank höherer Rückflüsse aus der Agrarpolitik trotzdem ein etwas geringerer Nettozahler; ähnliches gilt auch bei einem Vergleich von Österreich mit den Niederlanden. Auch die diversen Programme für Forschung, Entwicklung und Infrastruktur, die auf der europäischen Ebene verwaltet werden, werden zu einem großen Teil von den einkommensstärkeren MS in Anspruch genommen.
2 Österreichs Verflechtungen mit dem EU-Budget
Seit dem EU-Beitritt 1995 war Österreich durchgehend Nettozahler ins EU-Budget (Grafik 5). Das Ausmaß der Nettozahlungen wurde jedoch durch diverse Rabatte auf die Beitragszahlungen leicht reduziert. Schon seit 2002 erhält Österreich einen Rabatt auf seinen Anteil bei der Aufteilung des UK-Rabatts. Von 2009 bis 2013 gab es zudem einen Rabatt auf die zu zahlenden Mehrwertsteuer-Eigenmittel (durch die sich Österreich jährlich ca. 0,1 Mrd EUR ersparte), von 2014 bis 2016 gab es als Kompensation für das Wegfallen des letztgenannten Rabatts kleinere Pauschalrabatte (von 30/20/10 Mio EUR).
2.1 Rückflüsse kommen größtenteils aus Agrartöpfen
Die mit Abstand höchsten Rückflüsse aus dem EU-Budget lukriert Österreich aus den Mitteln der Agrarpolitik, die in den letzten Jahren ca. 0,3% des BNE pro Jahr ausmachten. Entsprechend der in Kapitel 1 erläuterten abnehmenden Rolle der Agrarpolitik innerhalb des EU-Budgets stiegen auch die Rückflüsse für Österreich in diesem Bereich weniger als das BNE. Zum über die Zeit ebenfalls leicht sinkenden Anteil der Mittel aus Strukturfonds (Grafik 5) trug auch bei, dass Österreichs BIP pro Kopf sowohl durch die EU-Osterweiterungen als auch durch die vergleichsweise geringere Betroffenheit von der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise stärker gestiegen ist als jenes der gesamten EU. Beispielsweise beinhalten diese Mittel auch die Regionalförderungen an das Burgenland, das anfangs aufgrund seines niedrigen Einkommens pro Kopf Ziel-1-Gebiet war und nach der ersten EU-Osterweiterung zur Übergangsregion mit höherem Kofinanzierungsanteil wurde. Der steigende Anteil von Ausgaben außerhalb der klassischen Bereiche (Agrar- und Strukturfonds) des EU-Budgets macht sich auch für Österreich durch zunehmende sonstige Rückflüsse bemerkbar, die vor allem der Forschungsförderung im Rahmen des Programms Horizon 2020 oder Erasmus-Stipendien zugutekommen bzw. in die Finanzierung des grenzüberschreitenden Brenner-Basistunnel-Projekts fließen.
Von den Agrartransfers gingen um die 60% auf Direktzahlungen an die Landwirtschaft zurück, die ausschließlich aus dem EU-Budget finanziert werden (Betriebsprämien und Marktordnungsausgaben aus der ersten Säule der Agrarpolitik). Die restlichen ca. 40% entfallen auf die zweite Säule der Agrarpolitik, die ländliche Entwicklung (ELER). Für die Inanspruchnahme dieser Mittel ist – wie bei den Strukturfonds (Regionalfonds, Kohäsionsfonds, Sozialfonds) 259 – eine Kofinanzierung durch die MS verpflichtend, wobei sich das Ausmaß der Kofinanzierung vor allem durch das Einkommensniveau des jeweiligen Staates bzw. der jeweiligen Region relativ zum durchschnittlichen Einkommensniveau der Union bestimmt. Für den aus österreichischer Perspektive mit Abstand wichtigsten kofinanzierten EU-Fördertopf, den ELER, beträgt der Kofinanzierungsanteil für Österreich 50% (siehe auch Grafik 6).
2.2 Finanzielle Verflechtungen mit dem EU-Budget in Zahlungsbilanz und in Staatskonten
Die bisherige Darstellung in den Grafiken 1 bis 6 folgte der Betrachtungsweise des EU-Budgets. Im Gegensatz dazu zeigt Grafik 7 Österreichs Verflechtungen mit dem EU-Budget aus der Sicht von Zahlungsbilanz und Staatskonten.
Der nationale Beitrag Österreichs zum EU-Budget (Mehrwertsteuer- und BNE-Eigenmittel) ist Teil der Staatsausgaben und der an das Ausland gezahlten Sekundäreinkommen in der Leistungsbilanz. Grafik 7 zeigt die relativ hohe Volatilität dieser Komponente (graue Balken). So stieg z. B. das Verhältnis der EU-Beiträge zum BIP von 2017 auf 2018 um knapp 0,2 Prozentpunkte.
Die traditionellen Eigenmittel (Zölle, Zuckerabgaben) werden hingegen zwar vom Staat Österreich eingehoben, aber nicht als Einnahme des Staats erfasst (dunkelgrüne Balken). In der Zahlungsbilanz sind diese direkt an das Ausland gezahlte indirekte Steuern (Teil der Primäreinkommen). Für diese Statistik wird für Österreich auch noch ein sogenannter „Rotterdam-Zuschlag“ (hellgrüne Balken) hinzugerechnet, da ein Teil, der an den europäischen Häfen eingenommenen Importabgaben eigentlich für Importe Österreichs eingehoben wird (siehe OeNB, 2018). Sowohl die tatsächlichen als auch die imputierten indirekten Steuern an die EU sind Teil der Abgabenquote. 260 Im Gegensatz zur Darstellung im EU-Budget werden die traditionellen Eigenmittel in der Zahlungsbilanz brutto erfasst; die Einhebungsvergütungen sind Teil der Dienstleistungsexporte sowie der Staatseinnahmen.
Ähnlich zur Logik bei den indirekten Steuern wird im Agrarbereich der aus dem EU-Budget finanzierte Teil als direkter Transfer an die Landwirtschaft verbucht (größtenteils als Subvention und somit als Teil des Primäreinkommens in der Zahlungsbilanz), obwohl diese über die staatliche AMA verwaltet werden. Nur der von Bund und Ländern kofinanzierte Teil der ländlichen Entwicklung (und falls relevant, aus dem Fischereifonds) scheint als Staatsausgabe auf. 261 Die sonstigen Rückflüsse werden teilweise als Staatseinnahmen (u.a. die Investitionszuschüsse für den Brenner-Basis-Tunnel) und teilweise als Transfers an den privaten Sektor erfasst.
3 Ausblick auf den mehrjährigen Finanzrahmen 2021–2027: neue strategische Ziele und der Brexit
Die Verhandlungen über den nächsten MFR für die Periode 2021–2027 haben bereits im Jahr 2018 begonnen. Das zähe Ringen zwischen EK, Europäischem Parlament und insbesondere zwischen den MS betrifft einerseits die Festlegung der neuen verbindlichen Obergrenze der Verpflichtungs- 262 und Zahlungsermächtigungen und damit die Höhe der Eigenmittel und andererseits die relative Gewichtung der verschiedenen Politikfelder. Der neue MFR definiert „Binnenmarkt, Innovation und Digitales sowie Klimaschutz“ als oberste Prioritäten und sieht vor, dass allein für die Verwirklichung der Klimaziele mindestens 25% der Ausgaben verwendet werden sollen (Rat der EU, 2019, S. 7).
Die gegenwärtigen Verhandlungen zum neuen MFR sind aber auch vom Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU geprägt. Letzteres hat direkte Folgen für den EU-Haushalt, geht damit doch einerseits eine Verkleinerung des europäischen Binnenmarkts sowie ein niedrigeres BNE der EU einher. Andererseits beeinflusst der Austritt auch die Struktur der Ausgaben des neuen MFR, da das Vereinigte Königreich – ein starker Kritiker der GAP – nur vergleichsweise geringe Transferleistungen aus der Agrarpolitik bekam. Von noch größerer Bedeutung sind potenziell die Implikationen auf das System der Rabatte auf der Einnahmenseite. Das Vereinigte Königreich hatte in der Vergangenheit den größten Rabatt auf den an die EU zu zahlenden nationalen Beitrag erhalten. Ob durch den Austritt nun das gesamte Rabattsystem zugunsten der einkommensstärkeren MS in Frage gestellt wird oder das Rabattsystem auch künftig als Instrument zur Erreichung der Einstimmigkeit im Rat herangezogen wird, bleibt offen. Mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs verliert der EU-Haushalt auch einen Nettobeitrag im hohen einstelligen Milliardenbereich (dieser belief sich in den letzten Jahren auf durchschnittlich rund 7 Mrd EUR pro Jahr) 263 . Dies erzeugt gemeinsam mit der angestrebten Priorisierung der Bereiche Umwelt bzw. Klimaschutz, Forschung und Innovation, Außengrenzschutz der EU und der internationalen Friedenssicherungsinitiative einen zunehmenden Druck auf die traditionellen Ausgabenbereiche wie die Agrar- und die Regionalpolitik.
Zudem wird der künftige MFR von der durch COVID-19 ausgelösten Wirtschaftskrise geprägt sein. Die am 9. April 2020 beschlossenen Maßnahmen zur Krisenfinanzierung über die Europäische Investitionsbank, den Europäischen Stabilitätsmechanismus und die durch das EU-Budget garantierte Kreditfazilität „Temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency“ (SURE) betreffen allerdings vorerst primär Instrumente der erweiterten Finanzarchitektur, aber nicht jene des EU-Haushalts im engeren Sinn.
4 Schlussfolgerungen
Österreich war seit dem Beitritt durchgehend ein Nettozahler ins EU-Budget. Als einer der größten Nettozahler (in % des BNE) profitiert Österreich schon seit dem Finanzrahmen 2001–2007 von einem Rabatt auf seine Mitgliedsbeiträge. Gleichzeitig erhält Österreich tendenziell mehr Rückflüsse aus Mitteln der Agrarpolitik als andere Mitglieder mit hohem BNE pro Kopf, weshalb Letztere noch größere Nettozahlungen in % ihres BNE an das EU-Budget leisten. Die vorgesehenen Mittelumschichtungen zuungunsten der Regional- und Agrarförderungen bedeuten damit ceteris paribus eine Erhöhung des Nettobeitrags Österreichs. Andererseits ist der enge Fokus auf Beiträge und Mittelrückflüsse bzw. Nettobeitragsleistungen bei den Verhandlungen zu hinterfragen, gilt es doch, die Vorteile des Binnenmarkts ebenso in die Betrachtung miteinzubeziehen. Zudem gibt es auch positive Spillover-Effekte von den Zahlungen an einkommensschwächere MS auf die Nettozahler-Staaten. Dies gilt im Besonderen für Österreich und Deutschland, die hiervon aufgrund ihrer engen Handelsverflechtung mit den Kohäsionsländern am relativ stärksten profitieren dürften (siehe EK, 2017a sowie Naldini et al., 2019).
Literaturverzeichnis
Beer, C., C. A. Belabed, A. Breitenfellner, C. Ragacs und B. Weber. 2017. Österreich und die europäische Integration. In: Monetary Policy & the Economy Q1/17. Wien: OeNB. 86–125.
Bittschi, B., M.G. Kocher und K. Weyerstraß. 2018. Finanzierung der EU nach dem Brexit: Eine Analyse des Mehrjährigen Finanzrahmens 20212027. In: Wirtschaftspolitische Blätter 3/2018. 397–411.
Breuss, F. 2015. 20 Jahre EU-Mitgliedschaft Österreich, bisher großer Gewinner, muss seine Rolle neu definieren. ÖGfE Policy Brief 4/2015. Wien: Österreichische Gesellschaft für Europapolitik.
Breuss, F. 2016. A Prototype Model of European Integration: The Case of Austria. In: Bednar-Friedl, B. and Kleinart, J. (Hrsg). Dynamic Approaches to Global Economic Challenges. Festschrift in Honor of Karl Farmer. Springer Verlag. Heidelberg-New York-Dordrecht-London. 9–30.
Breuss, F. 2020. Makroökonomische Effekte der 25-jährigen EU-Mitgliedschaft Österreichs. In diesem Heft.
Budgetdienst. 2016. Zahlungsströme an bzw. von EU-Institutionen im Bundeshaushalt (Anfragebeantwortung und Kurzstudie). Wien: Parlament.
Bundesministerium für Finanzen. 2018. BMF-Bericht zum EU-Haushalt und seinen Auswirkungen auf österreichischen Bundeshaushalt. Stand: 8. Oktober.
Cipriani, G. 2014. Financing the EU Budget: Moving Forward or Backwards? Centre for European Policy Studies. Brüssel.
Darvas, Z., A. M. Collin, J. Mazza und C. Midoes. 2019. Effectiveness of cohesion policy: learning from the project characteristics that produce the best results. Studie im Auftrag des European Parliament‘s Committee on Budgetary Control. Brüssel.
Europäische Kommission. Finanzberichte zum EU-Budget. Brüssel.
Europäische Kommission. 2017. Reflexionspapier über die Zukunft der EU-Finanzen. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_de.pdf .
Europäische Kommission. 2017a. Meine Region, mein Europa, unsere Zukunft. Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den RAT, den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. COM(2017) 583 final. Brüssel. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=COM:2017:583:FIN&from=EN .
Europäische Kommission. 2018. Vorschlag für einen Beschluss des RATES über das Eigenmittelsystem der Europäischen Union. COM (2018) 325 final. Brüssel.
Europäisches Parlament. 2020a. Kurzdarstellungen zur Europäischen Union. Der Mehrjährige Finanzrahmen. Brüssel. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/29/mehrjahriger-finanzrahmen .
Europäisches Parlament. 2020b. Die Instrumente der GAP und ihre Reformen. Brüssel. Abrufbar unter http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/107/die-instrumente-der-gap-und-ihre-reformen .
Europäisches Parlament. 2020c. Die erste Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP): II – Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe. Brüssel. http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/109/die-erste-saule-der-gemeinsamen-agrarpolitik-gap-ii-direktzahlungen-an-inhaber-l .
Europäisches Parlament. 2020d. Die zweite Säule der GAP: Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums. Brüssel. http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/110/die-zweite-saule-der-gap-politik-zur-entwicklung-des-landlichen-raums .
Eurostat. 2020. Glossar: Bruttonationaleinkommen (BNE). Abrufbar unter https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Gross_national_income_(GNI)/de
Felbermayr, G., J. Gröschl und I. Heiland. 2018. Undoing Europe in a New Quantitative Trade Model. In: ifo Working Papers 250.
Heinemann, F. 2018. Mehrjähriger EU-Finanzrahmen: Die schwierige Transformation in Richtung europäischer Mehrwert. In: ifo Schnelldienst 12/2018. 3–6.
Köhler-Töglhofer, W., D. Prammer und L. Reiss. 2019. (How) has EMU affected fiscal policy in Austria? In: Monetary Policy & the Economy Q1–Q2/19. Wien: OeNB. 71–84.
Katterl, A. und W. Köhler-Töglhofer. 2005. The impact of EU-Accession on Austria’s Budget Policy. In: Monetary Policy & the Economy Q2/05. Wien: OeNB. 101–116.
Mion, G. and D. Ponattu. 2019. Estimating economic benefits of the Single Market for European countries and regions. Policy Paper. Bertelsmann Stiftung.
Naldini A., A. Daraio, G. Vella, E. Wolleb und R. Römisch. 2019. Research for REGI Committee – Externalities of Cohesion Policy. wiiw Research Report 437. Jänner.
Oberhofer, H. 2019. Die Handelseffekte von Österreichs EU-Mitgliedschaft und des Europäischen Binnenmarktes. In: WIFO Monatsberichte Vol. 92. 12/2019. 883–890.
OeNB. 2018. Zahlungsbilanz und Internationale Vermögensposition nach BPM6. Handbuch zu Definitionen, Quellen und Berechnungsmethoden. Wien: OeNB.
Rat der Europäischen Union. 2019. Mehrjähriger Finanzrahmen (MFR) 2021–2027: Verhandlungsbox mit Zahlen. 14518/1/19, REV 1. Brüssel. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14518-2019-REV-1/de/pdf .
239 Oesterreichische Nationalbank, Abteilung für volkswirtschaftliche Analysen, walpurga.koehler-toeglhofer@oenb.at, lukas.reiss@oenb.at. Die von uns in dieser Studie zum Ausdruck gebrachte Meinung gibt nicht notwendigerweise die Meinung der Oesterreichischen Nationalbank oder des Eurosystems wieder. Wir danken Maria Auböck, Fritz Breuss, Ernest Gnan und Robert Stehrer für hilfreiche Kommentare.
240 Beer et al. (2017), Mion und Ponattu (2019), Breuss (2015 und 2016), Felbermayer et al. (2018) sowie Oberhofer (2019).
241 Siehe Europäische Kommission (2018, S. 13). Der letzte Eigenmittelbeschluss wurde 2014 auf Basis von ESVG 95 beschlossen und hatte eine Eigenmittelobergrenze von 1,23% des BNE der EU festgelegt. Die Umstellung auf ESVG 2010 schlug sich in einem reduzierten Satz von 1,20% des BNE der EU fest (mit Beibehaltung des nominellen Betrags der der Union zur Verfügung gestellten Finanzmittel).
242 Konzeptionell entspricht diese Größe dem vormaligen Bruttosozialprodukt (Gross National Product). Nach Eurostat (2020) ist das BNE (Gross National Income) „die Summe der Einkommen der Gebietsansässigen einer Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum“ und entspricht somit dem BIP bereinigt um grenzüberschreitende Primäreinkommen. Für die meisten MS unterscheiden sich BNE und BIP um weniger als 3%. In Luxemburg (um mehr als 35%) und Irland (um mehr als 20%) liegt das BNE aber deutlich unter dem BIP; in den seit 2004 beigetretenen MS liegt das BNE auch tendenziell unter dem BIP (aber um jeweils weniger als 10%).
243 Die Obergrenze für Verpflichtungsermächtigungen ist höher als jene für Zahlungsermächtigungen, da nicht alle rechtlichen Verpflichtungen, die die EK eingeht, auch von Zahlungen im gleichen Jahr begleitet sind. Letzteres gilt insbesondere für Zahlungen im Rahmen der Struktur- und Regionalfonds, die sich mitunter über mehrere Jahre verteilen.
244 Ab 1992 beinhaltete das Agrarförderungssystem unbeschränkte Abnahmegarantien zu bestimmten Preisen. Diese wurden durch ein System ergänzender Einkommensbeihilfen ersetzt, die nach der grundlegenden Reform 2003 aus Betriebsprämien bestanden, um die Beihilfen von den Produktionsmengen zu entkoppeln. Zudem wurden sämtliche Maßnahmen der Angebotskontrolle abgeschafft, wie etwa im Jahr 2017, die bis dahin geltende Quotenregelung für Zucker. Die Milchquoten waren bereits 2015 abgeschafft worden.
245 Da der europäische Agrarsektor durch vglw. kleine Betriebsgrößen bzw. Familienbetriebe in oftmals benachteiligten Regionen charakterisiert ist, sind die Produktionskosten höher als in anderen Regionen der Welt, wodurch bei Wegfall von Importbarrieren und Zöllen für landwirtschaftliche Produkte eine Subventionierung als unabdingbar betrachtet wurde.
246 Siehe BMF, 2018, S. 11.
247 Letzterer wurde im Zuge der Reformierung der Strukturfonds mit dem MFR für die Periode 1993–1999 ins Leben gerufen. Die Schwerpunktsetzungen dieses MFR wurden im 1992 beschlossenen Vertrag von Maastricht mit Blick auf die Erweiterung der EU determiniert.
248 Für eine aktuelle Evaluierung der Effektivität der Kohäsionsfonds siehe Darvas et al. (2019).
249 Siehe BMF, 2018, S.11.
250 Hierunter fällt etwa „Horizon 2020“ zur Förderung von Spitzenforschung und Innovation, die Fazilität „Connecting Europe“ zur Förderung europaweiter Infrastrukturprojekte im Bereich Verkehr, Energie und Informations- und Kommunikationstechnologien, das Erasmus-Programm, das COSME-Programm, Galileo sowie Copernicus.
251 Jede Änderung des EMB bedarf der Einstimmigkeit im Rat nach Anhörung des EP sowie der Ratifizierung durch sämtliche Mitgliedstaaten der EU. Die letzte Änderung des EMB fand 2014 im Gleichklang mit dem neuen mehrjährigen Finanzrahmen statt.
252 Als Kompensation für die Einhebung erhalten die MS eine Vergütung, die derzeit 20% der eingehobenen Abgaben beträgt.
253 Kleine Unterschiede können sich durch den Umgang mit Revisionen der BNE-Daten sowie Differenzen im Verhältnis der fiktiven Bemessungsgrundlage für die Mehrwertsteuer-Eigenmittel im Vergleich zum BNE ergeben.
254 Der UK-Rabatt sowie die Rabatte auf die BNE-Eigenmittel werden im EU-Budget als Nullsummenspiele dargestellt, bei dem die anderen MS diese Rabatte für DK, NL, AT, SE und UK finanzieren. Für Grafik 2 werden – entgegen der Präsentation im EU-Budget – die Rabatte auf die Mehrwertsteuer-Eigenmittel ebenfalls so dargestellt.
255 Der UK-Rabatt wird (in etwa) so angesetzt, dass sich der Nettobeitrag des UK gegenüber einem Szenario ohne Rabatt um zwei Drittel reduziert (unter Herausrechnung bestimmter mit der EU-Erweiterung ab 2004 zusammenhängender Ausgaben).
256 Im MFR 2014–2020 betrug dieser Rabatt für Österreich 30 Mio EUR für 2014, 20 Mio EUR für 2015 und 10 Mio EUR für 2016. Aufgrund der geringen Höhe ist er in Grafik 2 nicht sichtbar.
257 Die Europäische Kommission berechnet die Nettobeiträge, in dem sie die Ausgaben des EU-Budgets (ohne Verwaltung) in den einzelnen MS den jeweiligen nationalen Beiträgen der MS gegenüberstellt. Damit die Summe dieser geschätzten Nettobeiträge Null ergibt, werden die nationalen Beiträge entsprechend skaliert (dieser kleine Skalierungseffekt wird in den Grafiken 4 und 5 ebenfalls gezeigt).
258 Die an die einkommensschwächeren MS geleiteten Kohäsionsfondsmittel wirken sich über makroökonomische Spillover- bzw. Rückkoppeleffekte (Zunahme des Außenhandels, etc.) aber auch positiv auf die – nicht den kohäsionspolitischen Zielsetzungen unterliegenden – MS bzw. auch auf Drittstaaten aus. Siehe hierzu Naldini et al. (2019).
259 ELER, der EMFF (Fischereifonds) und die Strukturfonds werden auch unter dem Namen „Europäische Struktur- und Investitionsfonds“ (ESI-Fonds) zusammengefasst.
260 Die Beiträge heimischer Finanzinstitutionen an den Single Resolution Funds (SRF) werden ebenfalls als indirekte Steuer an die EU-Institutionen erfasst, der SRF ist aber nicht Teil des EU-Budgets.
261 Im Bundesbudget werden hingegen alle Agrarsubventionen als Ausgaben erfasst, und die Zahlungen aus dem EU-Budget als Einnahme. Für eine ausführliche Erläuterung der Darstellung im administrativen Bundesbudget siehe Budgetdienst (2016).
262 Die Vorschläge von EK und MS liegen zwischen 1% und 1,11% des BNE der EU.
263 Hinzu kommen noch direkte Zahlungen an die EU für Ausgaben, die außerhalb des EU-Haushalts verwaltet und nicht durch Eigenmittel finanziert werden.
Wirtschaftspolitische Empfehlungen in der EU und deren Umsetzungsbilanz in Österreich
Maria Auböck, Doris Prammer 264
Wissenschaftliche Begutachtung: Karin Fischer, Bundesministerium für Finanzen
Die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Europäischen Union sind seit dem Jahr 1993 ein konstanter Parameter zur Koordinierung der Wirtschafts- und Haushaltspolitik der EU-Mitgliedstaaten. Aus ihnen werden wirtschaftspolitische Prioritäten für die einzelnen Mitgliedstaaten abgeleitet und in Form länderspezifischer Empfehlungen an jedes EU-Mitglied gerichtet. An Österreich werden vor allem Empfehlungen zur Senkung der Steuerlast auf Arbeit, zur Sicherstellung der langfristigen Tragfähigkeit des Pensionssystems, zur Verbesserung des Bildungssystems und der Anreizsysteme am Arbeitsmarkt sowie zur Erhöhung des Wettbewerbs (z. B. im Dienstleistungsbereich) gerichtet. Da die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen durch die EU-Mitgliedstaaten rechtlich nicht bindend ist, erfolgt deren Umsetzung oftmals nur in geringem Maße. Seit Beginn des Europäischen Semesters 2011 wurden in Österreich nur 5% (EU 9%) der Empfehlungen vollständig umgesetzt, während bei 9% noch keine Umsetzungsfortschritte gemacht wurden (EU: 5%). Generell hoch ist die Umsetzung im Finanzsektor, wo der Marktdruck stark auf das politische Handeln Einfluss nimmt. Ähnliches gilt auch bei hohen Leistungsbilanz- und Budgetdefiziten, wo der resultierende Druck am Finanzmarkt ein Treiber für Reformen ist.
JEL classification: H77, P16, F55
Keywords: Europäische Union, Wirtschaftspolitische Koordinierung, länderspezifische Empfehlungen, Strukturpolitik
Die bis in die Anfänge der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zurückreichende wirtschaftspolitische Koordination wurde im Jahr 1993 – zwei Jahre vor Österreichs EU-Beitritt – erstmals durch Empfehlungen über die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union unterstützt. Seit dem Jahr 1998 werden diesen Grundzügen länderspezifische Komponenten hinzugefügt, die länderspezifische Prioritäten aus den allgemeinen Grundzügen ableiten und direkte Empfehlungen an jedes EU-Mitglied richten. Die Umsetzung dieser Empfehlungen wird seit dem Jahr 2000 jährlich in einem Bericht der Europäischen Kommission bewertet. In der vorliegenden Studie werden die wirtschaftspolitische Koordinierung, die länderspezifischen Empfehlungen sowie deren Implementierung untersucht.
Kapitel 1 gibt einen Überblick über die historische Entwicklung der wirtschaftspolitischen Koordinierung. Kapitel 2 skizziert die verschiedenen Koordinierungsinstrumente vor dem Hintergrund der wirtschaftspolitischen Strategien. Kapitel 3 bewertet die Kohärenz und Effektivität der wirtschaftspolitischen Steuerung und der Grundzüge der Wirtschaftspolitik. Kapitel 4 diskutiert die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen in Österreich im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten. Dabei werden Umstände, die zu einer erhöhten Umsetzungswahrscheinlichkeit beitragen, besonders hervorgehoben. Der Artikel schließt mit einem Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und mögliche Konsequenzen für die Umsetzungsbilanz.
1 Genese – kurzer historischer Überblick
Die wirtschaftspolitische Koordination reicht bis in die Anfänge der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) zurück. Bereits in den späten 1950er-Jahren (1958) wurde der „beratende Währungsausschuss“ als Beratungs- und Koordinierungsorgan der Gemeinschaft eingesetzt. 265
In den 1960er-Jahren wurden die institutionellen Grundlagen für eine engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik weiterentwickelt. Die sechs Mitgliedstaaten der EWG verpflichteten sich zu einer mittelfristigen Wirtschaftsplanung (Strunden, 1968, 247) im Rahmen des mittelfristigen Ausschusses für Wirtschaftspolitik. Dieser ergänzte ab 1964 den Ausschuss für Konjunkturpolitik, den Ausschuss für Haushaltspolitik und den Ausschuss der Präsidenten der Zentralbanken. Mit diesem bescheidenen Instrumentarium wurde über drei Jahrzehnte die Wirtschaftspolitik einer immer größer werdenden Europäischen Gemeinschaft 266 abgestimmt.
Die eigentliche Herausforderung für die wirtschaftspolitische Koordination galt es im Zuge der Umsetzung der Wirtschafts- und Währungsunion ab den 1990er-Jahren zu bewältigen. Bereits im Werner-Bericht (1970) und später auch im Delors-Bericht (1989) wurden die inhaltlichen Ziele einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion skizziert und entsprechende Koordinierungsmechanismen ausgearbeitet (Werner, 1970,15ff.; Delors, 1989). Neben einer Synchronisierung der nationalen Budgetprozesse waren detaillierte wirtschaftspolitische Vorgaben („guidelines for the economic policy“) für die kommenden 12 Monate für jeden Mitgliedstaat vorgesehen, um wirtschaftliche Ungleichgewichte auszubalancieren, sodass ein tragfähiges Fundament für eine gemeinsame Währung geschaffen würde (Werner 1970, 16). Im Zuge der Umsetzung der Währungsunion erhielten diese Richtlinien in Form der wirtschaftspolitischen Leitlinien eine prominente Rolle. Die rechtliche Verankerung erfolgte im Vertrag von Maastricht (1992), welcher die Grundlagen und das Verfahren für die wirtschaftspolitische Abstimmung festlegte. Artikel 103 Abs. 1 (EUV) hält fest, dass die EU-Mitgliedstaaten ihre Wirtschaftspolitik als eine Angelegenheit von gemeinsamem Interesse betrachten und sie im Rat koordinieren. Seither sind die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft ein zentrales Instrument der wirtschaftspolitischen Koordinierung. Allerdings haben sie durch die Einführung des Europäischen Semesters, insbesondere wegen der dichteren Abfolge von Analyse und Monitoring, etwas an Bedeutung verloren.
Die wirtschaftspolitische Koordinierung der EU-Mitgliedstaaten war durch die tiefgreifenden Integrationsschritte in den 1990er-Jahren (Binnenmarkt und Einführung einer gemeinsamen Währung) notwendig geworden. Die wirtschaftlich stark unterschiedlichen Nationalstaaten waren nunmehr eng miteinander verbunden, allerdings standen die herkömmlichen Korrekturinstrumente (z. B. flexible Wechselkurse) nicht mehr zur Verfügung. Divergierende Preisniveaus der Mitgliedstaaten und unterschiedlich ausgeprägte Wettbewerbsfähigkeit sollten durch die enge Abstimmung der Wirtschaftspolitiken ausgeglichen werden. Um die Resilienz und Stabilität des Gesamtsystems zu erhöhen, wurde im Jahr 2011, nach der Wirtschafts- und Finanzkrise, die makroökonomische Überwachung als neues Element hinzugefügt. Dieses Instrument stellt makroökonomische Ungleichgewichte in den Fokus wirtschaftspolitischer Koordination, die vor der Krise primär auf stabile öffentliche Finanzen ausgerichtet war. 267
2 Von der wirtschaftspolitischen Kooperation zur umfassenden wirtschaftspolitischen Koordination
Die ersten Empfehlungen über die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der EU-Mitgliedstaaten und der Europäischen Union wurden 1993, zwei Jahre vor dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union am 1. Jänner 1995, verabschiedet (Europäische Kommission, 1993). Die Empfehlungen waren damals allgemein an die Gemeinschaft gerichtet und enthielten noch keine länderspezifischen Elemente. Fünf Jahre später, im Jahr 1998, wurden den Grundzügen der Wirtschaftspolitik erstmals länderspezifische und eurozonenspezifische Komponenten hinzugefügt (Europäische Kommission 1998, 12–13). Die an einzelne EU-Mitgliedstaaten gerichteten Empfehlungen leiten sich aus den allgemeinen Grundzügen ab und reflektieren nationale Prioritäten. Seit dem Jahr 2000 werden zudem begleitende Analysen und Umsetzungsberichte veröffentlicht (Europäische Kommission, 2000).
Die grundlegendsten Adaptierungen im Koordinierungsverfahren erfolgten in den 1990er-Jahren im Zuge der schrittweisen Verwirklichung der Währungsunion. Der Vertrag von Amsterdam (1997) enthielt erstmals die Förderung der Koordinierung der nationalen Beschäftigungspolitik (Artikel 3 und Artikel 125–130 EGV). Bei einem Sondergipfel im November 1997 in Luxemburg wurde ein Verfahren zur Koordinierung der nationalen Beschäftigungspolitiken beschlossen, welches ähnlich den Grundzügen der Wirtschaftspolitik an Beschäftigungspolitischen Leitlinien ausgerichtet war (Europäischer Rat, 1997). Dieses als „Luxemburg-Prozess“ bekannte Koordinierungsverfahren verlangte zudem die Abstimmung der Beschäftigungspolitischen Leitlinien (auf Basis eines jährlichen Berichts über die Beschäftigungslage) mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik, um ein Mindestmaß an Verzahnung der beiden Politikbereiche sicherzustellen. Im Juni 1998 wurde vom Europäischen Rat der sogenannte „Cardiff-Prozess“ ins Leben gerufen (Europäischer Rat, 1998), um die Wettbewerbsfähigkeit im Dienstleistungssektor sowie auf den Kapital- und Gütermärkten zu fördern. Ferner wurde im Jahr 1999 der Makroökonomische Dialog eingeführt, bekannt unter dem Namen „Köln-Prozess“ (Europäischer Rat, 1999). Neben der Koordinierung der Geld-, Budget-, und Strukturpolitik sollte in Zukunft auch die Lohnentwicklung im Rahmen eines Beschäftigungspaktes berücksichtigt werden. 268
Die Verabschiedung der Lissabon-Strategie im Jahr 2000 stellt eine weitere Intensivierung der wirtschaftspolitischen Koordinierung dar. Europa sollte innerhalb von zehn Jahren zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt“ werden (Europäischer Rat, 2000, §5). Ein neues Koordinierungsverfahren wurde hinzugefügt: Die Offene Methode der Koordinierung (OMK) verfolgte im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip einen dezentralen Ansatz. Auf der Grundlage von Leitlinien und Empfehlungen wurden nationale Reformpläne ausgearbeitet und Zielvorgaben definiert, deren Umsetzung anhand von Indikatoren, Benchmarks und statistischen Vergleichen in einem Peer-Review-Prozess überprüft wurden. Die Mitgliedstaaten sollten durch den Austausch von Erfahrungen über Reforminitiativen voneinander lernen, mit dem Ziel in allen nicht-vergemeinschafteten Politikbereichen eine größere Konvergenz zu erzielen (Europäischer Rat, 2000, §37). In der Praxis führte dies zu einem aufwendigen Berichtswesen ohne gemeinsamen Nenner.
Die dringend notwendige Strukturbereinigung erfolgte schließlich im Jahr 2005 mit der expliziten Verknüpfung der Beschäftigungspolitik (Artikel 128 EGV) mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik (Artikel 99 in Verbindung mit Artikel 98 EGV) (Europäischer Rat, 2005). Die Grundzüge der Wirtschaftspolitik werden seitdem mit den nach Artikel 128 EGV zu erstellenden Leitlinien für die Beschäftigungspolitik in den Integrierten Leitlinien zusammengefasst und gliedern sich in die drei Bereiche Makroökonomie, Mikroökonomie und Beschäftigungspolitik (Europäische Kommission, 2005).
Die Finanz- und Wirtschaftskrise mit Beginn im Jahr 2008 und ihre weitreichenden Folgen für die Verschuldung der öffentlichen Haushalte lieferte den nächsten Auslöser für umfassende Reformen der wirtschaftspolitischen Koordinierung. In einer Mitteilung der Europäischen Kommission vom Mai 2010 wurden weitere Maßnahmen zur Verstärkung der wirtschaftspolitischen Koordinierung und ein neues, auf zehn Jahre angelegtes Wirtschaftsprogramm – die Europa 2020-Strategie – vorgeschlagen (Europäische Kommission, 2010a). Ergänzend zur Europa 2020-Strategie wurde ein Gesetzespaket (Six-Pack) verabschiedet, das die rechtlichen Grundlagen für eine Verschärfung der fiskalpolitischen und makroökonomischen Überwachung verankerte. Das Six-Pack umfasst sechs Rechtsakte (Amtsblatt der Europäischen Kommission, 2011 a-f); vier davon reformierten den Stabilitäts- und Wachstumspakt, zwei verankerten ein Verfahren zur Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte. Mit diesem Rechtspaket wurde gleichzeitig die Grundlage für das Europäische Semester gelegt, welches erstmals im Jänner 2011 mit der Veröffentlichung des Jahreswachstumsberichts gestartet wurde. Im Vergleich zu vorangegangenen Koordinierungsprozessen erfolgte nunmehr die wirtschaftspolitische Koordinierung mittels zeitlich aufeinander abgestimmten Verfahrensschritten (Europäische Kommission 2010a). Eine nächste Verfeinerung erfolgte zwei Jahre später, 2013, mit dem sogenannten Two-Pack (Amtsblatt der Europäischen Kommission 2013, a-b). Die aktuelle EU-Kommission unter Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen setzt mit dem Europäischen Green Deal auf eine neue Wachstums- und Wirtschaftsstrategie, außerdem wurden weitere Anpassungen für das Europäische Semester in Aussicht gestellt (Europäische Kommission, 2019b).
3 Kohärenz und Effektivität der wirtschaftspolitischen Koordinierung
Die zentrale Rolle der Grundzüge bzw. später der Integrierten Leitlinien ist zwar bis heute unangetastet, allerdings wurde das Europäische Semester seit seinem Start im Jahr 2011 zum Synonym für wirtschaftspolitische Koordinierung. De facto kam es durch die aktuelle Ausgestaltung des Europäischen Semesters zu einem kontinuierlichen Bedeutungsverlust der Grundzüge der Wirtschaftspolitik.
Dennoch definieren die Grundzüge der Wirtschaftspolitik seit ihrem Bestehen 1993 den Rahmen für länderspezifische Empfehlungen an die EU-Mitgliedstaaten. Obwohl sie im Zeitverlauf entsprechend den jeweiligen politischen Rahmenbedingungen überarbeitet wurden – anfangs jährlich, später alle 3 Jahre bzw. bei Bedarf 269 – blieb die grundsätzliche Ausrichtung auf Wachstum und Beschäftigung stets erhalten. Dadurch war ein vergleichsweises hohes Maß an inhaltlicher Kohärenz und Kontinuität über die letzten Jahrzehnte europäischer Wirtschaftspolitik möglich. Makroökonomische Stabilität, tragfähige öffentliche Finanzen, Forschung & Entwicklung, Innovation, Strukturreformen zur Stärkung unternehmerfreundlicher Rahmenbedingungen, Stärkung des Binnenmarktes und des Wettbewerbs, die Schaffung von qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen, Bildung, Aus- und Weiterbildung, territorialer Zusammenhalt, nachhaltiges Wachstum und Umweltschutz definieren die wirtschaftspolitischen Ziele der Gemeinschaft.
Die eigentliche Herausforderung stellen die aus den Grundzügen der Wirtschaftspolitik abgeleiteten länderspezifischen Empfehlungen dar. Sie destillieren aus den allgemeinen Grundzügen Prioritäten für die EU-Mitgliedstaaten, die in Form von Reformempfehlungen – meist jährlich – an die EU-Mitgliedstaaten gerichtet werden. Im Zeitverlauf zeigt sich, dass aufgrund der verdichteten Analyseprozesse die länderspezifischen Empfehlungen zunehmend in einem Spannungsverhältnis zwischen Präzision im Sinne sehr detaillierter Politikmaßnahmen (z. B. Koppelung des Pensionsantrittsalters an die Lebenserwartung, Wortlaut der Empfehlung 2012–2016 (Europäische Kommission 2012–2016)) und der Vorgabe von eher allgemein gehaltenen Reformzielen stehen (z. B. Gewährleistung der Tragfähigkeit des Gesundheits- und Pensionssystems, Wortlaut der Empfehlung 2017 (Europäische Kommission, 2017)). Diese Diskontinuität bei den Reformempfehlungen, die sich vor allem im jährlich wechselnden Detaillierungsgrad zeigt, schadet der Kohärenz und konterkariert letztlich die Zielerreichung. Problematisch sind auch Empfehlungen, die sehr konkrete Vorstellungen von den zu ergreifenden politischen Maßnahmen vorgeben und damit in die Gestaltungsfreiheit und Souveränität der EU-Mitgliedstaaten eingreifen. Da die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen rechtlich nicht bindend ist, fällt die Umsetzung, insbesondere aber die Art und Weise der Umsetzung und die Gestaltung der politischen Maßnahme in den alleinigen Kompetenzbereich der EU-Mitgliedstaaten. Um dieses Defizit auszugleichen setzt die EK daher zusehends auf weitere, ergänzende Instrumente. Die sogenannten ex-ante Konditionalitäten, wie sie in der Strukturfondsverordnung VO 1303/2013 verankert waren und auch in der aktuellen Dachverordnung für die Periode 2021 bis 2027 270 vorgesehen sind, bieten einen Hebel für die Verknüpfung von finanziellen Mitteln mit der Einhaltung bzw. Umsetzung von eingegangenen Reformverpflichtungen. Denselben Ansatz verfolgt auch das neue Haushaltsinstrument für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit, das im zukünftigen mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027 für die EU-Mitgliedstaaten des Euroraums 271 vorgesehen ist: Demnach sollen länderspezifische Leitlinien für Reform- und Investitionsziele formuliert werden. Diese orientieren sich an den (erweiterten) jährlichen Empfehlungen an den Euroraum, aber auch an den jeweiligen länderspezifischen Empfehlungen. Die EU-Mitgliedstaaten können in der Folge Finanzhilfe für die Umsetzung von entsprechenden Reformprojekten erhalten.
4 Implementierung der länderspezifischen Empfehlungen: die Bewertung
Zusätzlich zu länderspezifischen Empfehlungen in der Budgetpolitik, die seit dem Jahr 1998 gegeben werden, wurden seit 1999 auch länderspezifische wirtschafts- und strukturpolitische Empfehlungen an die EU-Mitgliedstaaten gerichtet. Die Umsetzung dieser Empfehlungen wird seit dem Jahr 2000 von einem Bericht der Europäischen Kommission (EK) bewertet (Deroose et al., 2008). Diese Berichte qualifizierten detailliert den Implementierungsfortschritt im jeweiligen EU-Mitgliedstaat innerhalb der ersten 6 bis 9 Monate nach Veröffentlichung der Empfehlungen. Im Zuge der Verknüpfung der beschäftigungspolitischen Leitlinien mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik ab dem Jahr 2003 erfolgte eine Umstellung auf einen Dreijahreszyklus, wodurch der Fokus stärker auf die mittelfristige Zielerreichung gesetzt werden sollte (Deroose et al., 2008). 272 Die Mitgliedstaaten legten in der Folge die Schwerpunkte ihrer wirtschaftspolitischen Strategie in den nationalen Reformprogrammen seit 2005 selbst fest. In den spezifischen Empfehlungen an die EU-Mitgliedstaaten ergänzte die EK allenfalls noch – aus ihrer Sicht – vordringliche Schwerpunkte. Da die Schwerpunktsetzung in dieser Periode sehr allgemein erfolgte, fällt auch die Bewertung der Umsetzung in den 3-Jahresperioden 2003–2005, 2005–2008 und ab 2008 deutlich allgemeiner aus als in den vorangegangenen Koordinierungszyklen.
Seit dem Jahr 2011 werden länderspezifische Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semesters wieder jährlich auf Vorschlag der EK vom Rat verabschiedet und somit an die einzelnen EU- Mitgliedstaaten gerichtet. 273 Ebenso berichtet die EK im Rahmen der Länderberichte im Winter/Frühjahr jeden Jahres wieder detailliert über die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen. Die Bewertung der Zielerreichung der budgetären Empfehlungen wird – im Einklang mit dem Regelwerk zur Fiscal Governance – allerdings nicht in diesen Berichten vorgenommen. 274 Während in den Anfangsjahren nur eine Beurteilung pro länderspezifischer Empfehlung abgeben wurde, werden am aktuellen Rand eine Gesamtbeurteilung pro länderspezifischer Empfehlung sowie einzelne Bewertungen für Teilbereiche innerhalb der länderspezifischen Empfehlung abgegeben. In den ersten Jahren gab es allerdings eine deutlich höhere Anzahl an länderspezifischen Empfehlungen – de facto eine für jedes Themengebiet. Mittlerweile werden mehrere Themengebiete in einer länderspezifischen Empfehlung zusammengefasst, deren Umsetzung thematisch getrennt bewertet wird. Die über die Zeit sinkende Anzahl der länderspezifischen Empfehlungen lässt also nicht notwendigerweise auf erfolgreiche Umsetzungen schließen, sondern ist zum Großteil auf eine Zusammenfassung/Umgruppierung der einzelnen Empfehlungen zurückzuführen.
4.1 …für die EU
Seit der Einführung des Europäischen Semesters bewertet die EK die Implementierung anhand einer 5-stufigen qualitativen Skala (keine Fortschritte, begrenzte Fortschritte, einige Fortschritte, substanzielle Fortschritte und vollständige Umsetzung) sowohl für die länderspezifischen Empfehlungen des vorangegangenen Jahres als auch für die über den gesamten Zeitraum von 2011 bis 2018. 275 Die einzelnen Bewertungen wurden 2018 in über 30 verschiedenen Politikbereichen vorgenommen, die ihrerseits wieder in größere Kategorien zusammengefasst wurden (vergleiche Tabelle 1 für Österreich; Efstathiou et al., 2019 Annex B). Die linke Abbildung in Grafik 1 zeigt für das Jahr 2018 deutlich, dass 9 Monate nach der Veröffentlichung der Empfehlungen mehr als die Hälfte der Empfehlungen entweder gar nicht oder kaum umgesetzt wurden. Bei mehrjähriger Betrachtung zeigt sich, dass von allen länderspezifischen Empfehlungen, die seit Beginn des Europäischen Semesters ausgesprochen wurden, zumindest in 69% der Fälle „einiger Fortschritt“ (Addition der Kategorien einige Fortschritte, substanzielle Fortschritte und vollständige Umsetzung) in der Umsetzung konstatiert werden kann. Andererseits wurden 8 Jahre nach Beginn des Europäischen Semesters nur 9% der länderspezifischen Empfehlungen komplett umgesetzt, während 5% noch nicht einmal in Angriff genommen wurden (rechte Abbildung in Grafik 1).
Basierend auf den Bewertungen der EK berechnen Efstathiou et al. (2019) einen Implementierungsscore, der zeigt, dass die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen seit 2014 deutlich gesunken ist. Während Länder mit makroökonomischen Ungleichgewichten zu Beginn des Europäischen Semesters eine deutlich bessere Umsetzungsrate aufwiesen als Länder ohne Ungleichgewichte, verschlechterte sich deren Umsetzungsrate signifikant, sodass sich ab 2016 kaum mehr ein Unterschied bei der Implementierung der länderspezifischen Empfehlungen zu den Ländern ohne Ungleichgewichte ergibt. Besonders hohe durchschnittliche Umsetzungsquoten der länderspezifischen Empfehlungen wurden für das Vereinigte Königreich und Finnland erhoben, während Luxemburg und Ungarn besonders niedrige Umsetzungsquoten aufwiesen. Österreich befindet sich im unteren Drittel (Efstathiou et al., 2019). Darüber hinaus zeigen Efstathiou et al. (2019), dass von den EU-Mitgliedstaaten vor allem Empfehlungen im Bereich „Finanzsektor“ umgesetzt wurden, während die Umsetzung bei steuerpolitischen Empfehlungen in einem sehr geringen Maß stattfand. Mittels Regressionsanalyse stellen Efstathiou et al. (2019) fest, dass die Implementierungswahrscheinlichkeit vor allem vom Marktdruck beeinflusst wird: Bei hohen Fiskal- und Leistungsbilanzdefiziten steigt die Implementierungswahrscheinlichkeit; zu einem ähnlichen Effekt kommt es, wenn großer Druck vom Finanzmarkt ausgeht (eventueller Verlust des Finanzmarktzugangs). Keinen Effekt scheinen mögliche Sanktionen im Rahmen des Verfahrens bei makroökonomischen Ungleichgewichten (MIP) zu haben: Länder, die im verstärkten Monitoring der EK im Rahmen des MIP stehen, weisen keine erhöhte Implementierungswahrscheinlichkeit der länderspezifischen Empfehlungen auf (Efstathiou et al., 2019).
4.2 …für Österreich
Länderspezifische Empfehlungen der EK an Österreich wurden zu einem geringerem Maß umgesetzt als im Durchschnitt der EU-Mitgliedstaaten (vgl. Grafik 2 und Grafik 1): Knapp 50% der länderspezifischen Empfehlungen an Österreich seit 2011 wurden kaum bis gar nicht umgesetzt; nur 5% sind wurden vollständig umgesetzt. Keine der Empfehlungen des Jahres 2018 wies – gemäß der Ersteinschätzung der EK im Frühjahr 2019 – zumindest wesentliche Fortschritte bei der Umsetzung auf.
Tabelle 1 zeigt, dass auch in Österreich vor allem länderspezifische Empfehlungen im Bereich des Finanzsektors umgesetzt wurden: Diese betrafen vor allem die Abwicklung und Neuausrichtung des Bankensektors nach der Finanz- und Wirtschaftskrise. Im Jahr 2015 befand die EK die Restrukturierung des Bankensektors als weitreichend abgeschlossen und sprach keine weitere Empfehlung in diesem Bereich aus.
Gänzlich anders ist die Situation bei den Empfehlungen zur Senkung der Steuerlast auf Arbeit, zur Sicherstellung der langfristigen Tragfähigkeit des Pensionssystems, zur Verbesserung der Bildungsergebnisse benachteiligter Jugendlicher, zur Verbesserung der Anreizsysteme am Arbeitsmarkt und zur Erhöhung des Wettbewerbs u.a. im Dienstleistungsbereich. Empfehlungen in diesen Bereichen erhält Österreich bereits seit Beginn der länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen der Grundzüge der Wirtschaftspolitik kontinuierlich. Ebenfalls wird von der EK seit langem empfohlen, das fiskal-föderalistische System Österreichs zu reformieren. Seit Beginn des Europäischen Semesters wird gefordert, die legislativen und administrativen sowie die fiskalischen Zuständigkeitsbereiche zwischen Bund und Ländern zu rationalisieren und Doppelgleisigkeiten zu beseitigen. Bislang wurden diesbezüglich jedoch – trotz mehrerer Anläufe – keine bedeutenden politischen Reformfortschritte erzielt, abgesehen von kleineren Maßnahmen im Gesundheitsbereich, oder von ersten Schritten in Richtung aufgabenorientierte Finanzmittelverteilung z.B. im Bildungswesen. 276 Bei der Verbesserung der Nachhaltigkeit des Pensionssystems wurde nach der Pensionsreform 2003/2004 ein bedeutender Fortschritt konstatiert, sodass in den Folgejahren keine Empfehlung für weitere Reformmaßnahmen an Österreich erging. Tatsächlich trug die Pensionsreform 2003/2004 mit der Verlängerung des Durchrechnungszeitraums und der Senkung des Steigerungsbetrags deutlich zur Erhöhung der Finanzierbarkeit und damit zur Tragfähigkeit des Pensionssystems bei. Im Jahr 2011 empfahl die EK jedoch weitere Maßnahmen im Pensionsbereich, wie etwa eine Vorziehung der Angleichung des Frauenpensionsantrittsalters an das der Männer (länderspezifische Empfehlungen 2011–2015). Obwohl Österreich dieser Empfehlung nicht nachkam, scheint sie in den länderspezifischen Empfehlungen seit 2016 nicht mehr auf. 277 Generell wurde die Anzahl der länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semesters über die Jahre nicht nur niedriger, sondern die einzelnen Empfehlungen wurden auch kürzer und weniger präskriptiv. Im Jahr 2018 gab es lediglich die Forderung im Pensionsbereich das gesetzliche Pensionsantrittsalter zu erhöhen und Frühpensionierungen zu erschweren.
Die Änderungen im genauen Wortlaut von immer wiederkehrenden Empfehlungen der EK bereiten Probleme, die von der EK veröffentlichte Beurteilung der Umsetzung der Empfehlungen nachzuvollziehen. Insbesondere ist kaum nachvollziehbar, warum bestimmte Empfehlungen – ohne weiteren Kommentar oder Empfehlung – bei fehlender Umsetzung fallen gelassen werden. Ebenso wenig nachvollziehbar ist, wann eine Maßnahme als soweit ausreichend begutachtet wird, um als „substanzieller Fortschritt“ im Vergleich zu „einiger Fortschritt“ klassifiziert zu werden. Den Bewertungen der Umsetzung ist naturgemäß ein gewisser Ermessenspielraum inhärent. Dieser scheint von den, in den Beurteilungsprozess einbezogenen, Experten der EK sehr unterschiedlich genutzt zu werden. Dies wurde auch vom Europäischen Rechnungshof (2018) kritisch angemerkt. Eine fehlende Kohärenz in der Beurteilung über die Jahre sowie über die verschiedenen Länder resultiert eventuell in einer geringeren Identifikation mit den Bewertungen und könnte sich negativ auf die Umsetzungswilligkeit der EU-Mitgliedstaaten auswirken.
5 Schlussfolgerungen und Ausblick
Die enge wirtschaftliche Integration in der EU erfordert gemeinsame Regeln und jedenfalls eine wirtschaftspolitische Koordinierung, um negative Spillover-Effekte zu vermeiden und die Resilienz der EU bei negativen Schocks zu erhöhen. Wichtigstes Instrument der Koordinierung sind die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union, welche seit dem Jahr 1993 die wirtschaftspolitischen Prioritäten festlegen. An die einzelnen EU-Mitgliedstaaten gerichtete länderspezifische Empfehlungen übersetzen die allgemeinen Grundzüge der Wirtschaftspolitik auf die Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten, indem die spezifischen Problemfelder (und Lösungsvorschläge) in den einzelnen Mitgliedstaaten aufgezeigt werden. Im Zeitverlauf zeigt sich, dass die länderspezifischen Empfehlungen zunehmend in einem Spannungsverhältnis zwischen Präzision – im Sinne sehr detaillierter Politikmaßnahmen – und der Vorgabe von eher allgemein gehaltenen Reformvorgaben stehen. Ungeachtet ihres Detailgehalts werden die länderspezifischen Empfehlungen nur in einem sehr geringen Ausmaß vollzogen: Seit Beginn des Europäischen Semesters 2011 wurden in Österreich nur 5% (EU 9%) der Empfehlungen vollständig umgesetzt, während 9% noch nicht in Angriff genommen wurden (EU 5%).
Die Umsetzungsquote könnte künftig durch zwei Neuerungen im Rahmen des Europäischen Semesters beeinflusst werden: Zum einen durch die Implementierung des neuen Haushaltsinstruments für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit, das den Ländern des Euroraums finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung von Strukturreformen und Investitionen bietet. Dabei legt der Rat der Europäischen Union strategische Richtungsvorgaben für die Reform- und Investitionsprioritäten der europäischen Wirtschaftspolitik fest, aus welchen in der Folge Empfehlungen für länderspezifische Investitionsschwerpunkte abgeleitet werden. Die Umsetzung durch die EU-Mitgliedstaaten sollte durch die damit verknüpften finanziellen Anreize erhöht werden. Andererseits werden sich die neue Wirtschaftsstrategie der Europäischen Union, der Europäische Green Deal, aber auch die Maßnahmen zur Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie auf die länderspezifischen Empfehlungen auswirken. Da es sich beim Europäischen Green Deal um ein langfristiges Ziel handelt – Übergang zu einem umweltfreundlichen und klimaneutralen Kontinent bis zum Jahr 2050 – könnte eine eher langfristige Umlegung auf länderspezifische Empfehlungen dazu führen, dass die Reformanstrengungen weiterhin schwach bleiben.
Literaturverzeichnis
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. 1994. Empfehlung des Rates vom 22. Dezember 1993 über die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft. 97/7/EG. 9–12.
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. 1999. Empfehlung des Rates vom 12. Juli 1999 über die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft (1999/570/EG), L 217 vom 17. 8.1999. 34–61.
Amtsblatt der Europäischen Union. 2007. Empfehlung des Rates vom 27. März 2007 zu den 2007 aktualisierten Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft und zur Umsetzung der Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten (2007/209/EG). L 92/23.
Amtsblatt der Europäischen Union. 2010. Empfehlung des Rates vom 13. Juli 2010 über die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union (2010/410/EU), L 191 vom 23. Juli 2010. 28–34.
Amtsblatt der Europäischen Union. 2011a. Richtlinie 2011/85 des Rates vom 8. November 2011 über die Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten
Amtsblatt der Europäischen Union. 2011b. Verordnung (EU) Nr. 1173/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über die wirksame Durchsetzung der haushaltspolitischen Überwachung im Euro-Währungsgebiet.
Amtsblatt der Europäischen Union. 2011c. Verordnung (EU) Nr. 1174/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über Durchsetzungsmaßnahmen zur Korrektur übermäßiger makroökonomischer Gleichgewichte im Euro-Währungsgebiet.
Amtsblatt der Europäischen Union. 2011d. Verordnung (EU) Nr. 1175/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken.
Amtsblatt der Europäischen Union. 2011e. Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte.
Amtsblatt der Europäischen Union. 2011f. Verordnung (EU) Nr. 1177/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit.
Amtsblatt der Europäischen Union. 2013a. Verordnung (EG) Nr. 472/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 über den Ausbau der wirtschafts- und haushaltspolitischen Überwachung von Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet, die von gravierenden Schwierigkeiten in Bezug auf ihre finanzielle Stabilität betroffen oder bedroht sind.
Amtsblatt der Europäischen Union. 2013b. Verordnung (EG) Nr. 473/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 über gemeinsame Bestimmungen für die Überwachung und Bewertung der Übersichten über die Haushaltsplanung und für die Gewährleistung der Korrektur übermäßiger Defizite der Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet.
Amtsblatt der Europäischen Union. 2014. Empfehlung des Rates vom 8. Juli 2014 zum nationalen Reformprogramm Österreichs 2014 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Österreichs 2014. (2014/C 247/18).
Amtsblatt der Europäischen Union. 2018. Beschluss (EU) 2018/2215 des Rates vom 16. Juli 2018 zu Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten. L224 vom 5. September 2018. 4–9.
Amtsblatt der Europäischen Union. 2019. Empfehlung des Rates vom 9. Juli 2019 zum nationalen Reformprogramm Österreichs 2019 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Österreichs 2019. (2019/C 301/20).
Delors, J. 1989. Report on Economic and Monetary Union in the Community. Brüssel.
Deroose, S., Hodson, D. und J. Kuhlmann. 2008. The Broad Economic Policy Guidelines: Before and after the relaunch of the Lisbon strategy. In: JCMS: Journal of Common Market Studies 46(4). 827–848.
Efstathiou, K. und G. B. Wolff. 2018. Is the European Semester effective and useful? Bruegel Policy Contribution 09/2018.
Efstathiou, K. und G. B. Wolff. 2019. What drives national implementation of EU policy recommendations? Bruegel Working Paper 04/2019.
Europäische Kommission. 1993. Commission Recommendation on the broad guidelines of the economic policies of the Member States and of the Community. European Economy 55. 11–18.
Europäische Kommission. 1998. Broad Economic Policy Guidelines. European Economy 66. 7–19.
Europäische Kommission. 1999. Commission's Recommendation for the Broad Guidelines of the Economic Policies of the Member States and the Community. COM(99) 143 final.
Europäische Kommission. 2000a. Broad economic policy guidelines. European Economy 70/2000.
Europäische Kommission. 2000b. Bericht der Kommission an den Rat über die Umsetzung der Grundzüge der Wirtschaftspolitik. Brüssel. KOM(2000) 143 endg. vom 14. März 2000.
Europäische Kommission. 2002. Report on the implementation of the 2001 broad economic policy guidelines. European Economy 1/2002.
Europäische Kommission. 2005a. Integrierte Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung. Brüssel. KOM(2005) 141 endg. vom 12. April 2005.
Europäische Kommission. 2005b. Second report on the implementation of the 2003–2005 Broad Economic Policy Guidelines. European Economy 01/2005.
Europäische Kommission. 2007. Communication from the Commission to the spring European Council - Strategic Report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) - Keeping up the pace of change. COM/2007/0803 final.
Europäische Kommission. 2010a. Stärkung der wirtschaftspolitischen Koordinierung für Stabilität, Wachstum und Beschäftigung – Instrumente für bessere wirtschaftspolitische Steuerung der EU. Mitteilung der Europäischen Kommission, KOM(2010) 367 endg.
Europäische Kommission. 2010b. Specification on the implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes.
Europäische Kommission. 2011a. Jahreswachstumsbericht: Gesamtkonzept zur Krisenbewältigung nimmt weiter Gestalt an. Mitteilung der Kommission, KOM(2011) 11 endg. vom 12. Jänner 2011.
Europäische Kommission. 2011b. Commission Staff Working Paper. Assessment of the 2011 national reform programme and stability programme for Austria. SEC(2011)728 final.
Europäische Kommission. 2012. Commission Staff Working Paper. Assessment of the 2012 national reform programme and stability programme for Austria. SEC(2012)306 final.
Europäische Kommission. 2013. Commission Staff Working Paper. Assessment of the 2013 national reform programme and stability programme for Austria. SWD(2013)370 final.
Europäische Kommission. 2014. Commission Staff Working Paper. Assessment of the 2014 national reform programme and stability programme for Austria. SWD(2014)421 final.
Europäische Kommission. 2015. Commission Staff Working Paper. Country Report Austria 2015. SWD(2015)39 final.
Europäische Kommission. 2016. Commission Staff Working Document. Country Report Austria 2016. SWD(2016)88 final.
Europäische Kommission. 2017. Commission Staff Working Document. Country Report Austria 2017. SWD(2017)85 final.
Europäische Kommission. 2018. Commission Staff Working Document. Country Report Austria 2018. SWD(2018)218 final.
Europäische Kommission. 2019a. Commission Staff Working Document. Country Report Austria 2019. SWD(2019)1019 final.
Europäische Kommission. 2019b. Jährliche Strategie für nachhaltiges Wachstum 2020. Mitteilung der Kommission, KOM(2019) 650 final vom 17. Dezember 2019.
Europäische Kommission. 2019c. Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Rat, die EZB, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, den Ausschuss der Regionen und die Europäische Investitionsbank. Europäisches Semester 2019. Länderspezifische Empfehlungen. COM (2019) 500 final.
Europäisches Parlament. 2019. Implementation of the 2018 Country-Specific Recommendations. EGOV. PE 634.354. März .
Europäischer Rat. 1997. Schlussfolgerungen des Vorsitzes. Europäischer Rat 12./13. Dezember. Luxemburg.
Europäischer Rat. 1998. Schlussfolgerungen des Vorsitzes. Europäischer Rat Cardiff 15./16. Juni.
Europäischer Rat. 1999. Schlussfolgerungen des Vorsitzes. Europäischer Rat 3./4. Juni Köln.
Europäischer Rat. 2000. Schlussfolgerungen des Vorsitzes. Europäischer Rat 23./24. März Lissabon.
Europäischer Rat. 2005. Schlussfolgerungen des Vorsitzes zur Tagung des Europäischen Rates (Brüssel) vom 22./23. März.
Europäischer Rat. 2010. Tagung am 17. Juni 2010. Schlussfolgerungen.
Europäischer Rat. 2011. Schlussfolgerungen des Vorsitzes. Göteborg. 15./16. Juni.
Europäischer Rat. 2017. Europäische Säule sozialer Rechte. Proklamation und Unterzeichnung. Göteborg. 17. November 2017.
Europäischer Rechnungshof. 2018. Audit of the Macroeconomic Imbalances Procedure. Special Report 03/18.
Niechooj, T. 2004. Fünf Jahre Makroökonomischer Dialog. Was wurde aus den ursprünglichen Intentionen? WSI Diskussionspapier 123. Hans-Böckler-Stiftung.
Regierungsprogramm. 2020. Aus Verantwortung für Österreich. Regierungsprogramm 2020–2024. Wien.
Strunden, T. 1968. Die Beratung der Stabilisierungspolitik in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. In: Schneider, H. (Hrsg.). Grundsatzprobleme wirtschaftspolitischer Beratung das Beispiel der Stabilisierungspolitik. Berlin. 246–253.
Werner, P. 1970. Report to the Council and the Commission on the Realization by stages of Economic and Monetary Union in the Community.
264 Oesterreichische Nationalbank, Abteilung für volkswirtschaftliche Analysen, doris.prammer@oenb.at (Korrespondenzautorin); Bundeskanzleramt, maria.auboeck@bka.gv.at. Die von den Autorinnen in dieser Studie zum Ausdruck gebrachte Meinung gibt nicht notwendigerweise die Meinung des Bundeskanzleramts, der Oesterreichischen Nationalbank oder des Eurosystems wieder. Die Autorinnen danken Walpurga Köhler-Töglhofer (OeNB) und Karin Fischer (BMF) für ihre hilfreichen und wertvollen Kommentare und Anregungen.
265 cf. Art. 105 Abs. 2 EWG-Vertrag.
266 Gründungsmitglieder 1957 waren Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. 1973 traten Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich der EWG bei, 1981 folgte Griechenland und 1986 Spanien und Portugal. Der Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens erfolgte im Jahr 1995. Die nächste große Erweiterungsrunde war 2004, mit dem Beitritt von Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Zypern und Malta. 2007 folgten Rumänien und Bulgarien und zuletzt folgte im Jahr 2013 Kroatien.
267 Das Frühwarnsystem für übermäßige makroökonomische Ungleichgewichte sieht eine regelmäßige Bewertung des Risikos von Ungleichgewichten anhand eines Sets von ökonomischen Indikatoren vor.
268 Da es sich beim makroökonomischen Dialog um ein Gremium zum Informationsaustausch handelt, das keinen Bericht und keine Richtlinien erstellt, wird es als nicht geeignet erachtet in die europäische Wirtschaftspolitik einzugreifen (Niechoj, 2004).
269 Die Grundzüge der Wirtschaftspolitik wurden zuletzt 2015 überarbeitet.
270 In die Strukturfonds-Dachverordnung für die Programmperiode 2021–2027 wurden die ex-ante Konditionalitäten als sogenannte grundsätzliche Voraussetzungen „enabling conditions“ übernommen. Es werden Bedingungen an den Erhalt von Strukturfondsmittel geknüpft, die vom Vorhandensein einer regionalen Innovationsstrategie bis zur Einhaltung von Wettbewerbsregeln reichen können.
271 Dieser Ansatz geht auf das ursprünglich von Frankreich vorgeschlagene Konzept für ein Euroraumbudget zurück.
272 Allerdings wurden während dieser Dreijahreszyklen Updates vorgenommen, etwa 2004 und 2007.
273 An Länder, die sich in einem Anpassungsprogramm befinden, werden keine länderspezifischen Empfehlungen gerichtet.
274 Die Bewertung der Erreichung der Ziele des fiskalischen Regelwerks kann erst nach Vorliegen der Daten des vorangegangenen Jahres im April des darauffolgenden Jahres erfolgen, während die Länderberichte bereits im Februar veröffentlicht werden.
275 In den Umsetzungsberichten vor dem Europäischen Semester wurden weniger Abstufungen und andere Termini verwendet.
276 Konkrete Vorschläge für den Elementarbildungsbereich liegen bereits vor. Demzufolge sollen die Finanzmittel nicht wie bisher entsprechend dem Bevölkerungsschlüssel verteilt werden, sondern anhand bestimmter Kriterien, wie z. B. Zahl der Kinder, Öffnungszeiten, aber auch Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund. Das Regierungsprogramm 2020–2024 sieht vor, dass der Aufgabenorientierung im Finanzausgleich in Zukunft ein stärkeres Augenmerk zukommen soll; cf. Aus Verantwortung für Österreich. Regierungsprogramm 2020–2024, Wien 2020, 70.
277 Ob diese Forderung wegen ihrer Erfolglosigkeit oder aufgrund der mittlerweile ohnehin innerhalb der nächsten zehn Jahre bevorstehenden Angleichung des Pensionsantrittsalters ausgesetzt wurde, kann nicht beurteilt werden.
Prognose der OeNB vom Juni 2020 in englischer Sprache
COVID-19-induced recession: biggest economic policy challenge for Austria in the “Second Republic”
Economic outlook for Austria from 2020 to 2022 (June 2020)
Gerhard Fenz, Christian Ragacs, Martin Schneider and Klaus Vondra 278
Cutoff date: May 28, 2020
1 Summary
The lockdown measures adopted to contain the COVID-19 pandemic have sent economies worldwide into a deep recession. For the Austrian economy, the OeNB’s projections imply a decline by about 13½% in the first half of 2020, but a visible revival already in the second half of the year. In general, the projections are based on two key assumptions: first, that we are not going to see a second wave of infections in the fall of 2020, and second, that coronavirus drugs or vaccines will be available by mid-2021. Based on these assumptions, real GDP in Austria is expected to contract by 7.2% in 2020, but to recover some lost ground thereafter with growth rates of 4.9% in 2021 and 2.7% in 2022. This means that it will take until 2022 for real GDP to return to pre-pandemic levels. The unemployment rate (Eurostat definition) is projected to rise to 6.8% in 2020 before dropping to 5.3% in 2022. HICP inflation is expected to sink to 0.8% in 2020, remain at this level in 2021 and re-accelerate to 1.5% in 2022. The general government deficit (Maastricht definition) is forecast to rise to 8.9% of GDP in 2020, reflecting comprehensive temporary fiscal stimulus packages and automatic stabilizers, before shrinking markedly to 1.5% of GDP in 2022.
The measures taken all over the world to contain the spread of coronavirus severely harmed the economy in the first half of 2020, even grinding economic activity to a halt in many instances. Austria was no exception, having enforced stringent containment measures that led to a broad-based economic shutdown in mid-March. As a result, large numbers of the workforce and businesses suffered income, sales and job losses, which the government sought to cushion with a new short-time work scheme of unprecedented proportions. The first quarter of 2020 already saw a 2.5% decline in economic output against the previous quarter. For the second quarter, an even larger output loss (some –11%) is in the offing, even though the Austrian government started lifting lockdown measures in stages on April 13, 2020. The projections made for the remainder of 2020 are subject to a high degree of uncertainty as they were based on a number of assumptions of how the pandemic will evolve. This includes the assumption that we will continue to see new infections, but that the measures to prevent a broad-based resurgence will be effective. Hence, we expect stringent containment measures that prolong the demand- and supply-side shocks to be re-imposed only in cluster areas should the need arise. Another assumption is that coronavirus drugs or vaccines will be available by mid-2021, which will have a positive effect on economic sentiment. These key assumptions about the likely path of the economy are common to all national central bank forecasts feeding into the Eurosystem macroeconomic projections for the euro area. The assumptions about the evolution of the pandemic have also informed the outlook for the wider global economy.
In contrast to the financial and economic crisis of 2009, when the global economy excluding the euro area was inching along, GDP is expected to decline by 4% in this region in 2020. Thereafter, catch-up processes will fuel a strong recovery in 2021. Still, the plunge in global GDP is expected to pale in comparison with the setback in global trade, with the disruption of global production chains and border closures reinforcing spillover effects from weakening demand. Austria’s export markets are thus likely to shrink by as much as 12.7% in 2020, causing exports from Austria to plummet by 11.6%. Thereafter, exports are forecast to grow by 6.9% in 2021 and 4.7% in 2022. Sharp declines in 2020 are also expected for gross fixed capital formation (–6.7%) and private consumption (–5.8%). As investment is generally highly sensitive to the business cycle, this does not come as a big surprise. Consumption, however, used to have a stabilizing effect on the economy during “normal” crisis episodes, as households tended to dissave in such periods. Yet, the unprecedented lockdown measures proved to be a game changer. These measures highly limited or even prevented consumer spending, thus causing saving levels to rise considerably in the second quarter of 2020 even amid income losses. In 2021 and 2022, both gross fixed capital formation and private consumption are expected to provide new impetus for above-average growth rates, given catch-up effects and improved economic confidence.
| Economic activity | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Annual change in % (real) | ||||
| Gross domestic product | +1.5 | –7.2 | +4.9 | +2.7 |
| Private consumption | +1.3 | –5.8 | +6.1 | +2.6 |
| Government consumption | +0.7 | +1.2 | +1.6 | +0.8 |
| Gross fixed capital formation | +2.8 | –6.7 | +4.7 | +3.1 |
| Exports of goods and services | +2.7 | –11.6 | +6.9 | +4.7 |
| Imports of goods and services | +2.7 | –8.9 | +5.7 | +3.7 |
| % of nominal GDP | ||||
| Current account balance | +2.6 | +1.5 | +2.2 | +2.3 |
| Import-adjusted contributions to real GDP growth2 | Percentage points | |||
| Private consumption | +0.4 | –2.2 | +2.2 | +1.0 |
| Government consumption | +0.1 | +0.2 | +0.3 | +0.1 |
| Gross fixed capital formation | +0.4 | –0.8 | +0.5 | +0.4 |
| Domestic demand (excl. changes in inventories) | +0.9 | –2.8 | +3.0 | +1.5 |
| Exports | +0.7 | –3.7 | +1.9 | +1.3 |
| Changes in inventories (incl. statistical discrepancy) | –0.1 | –0.3 | –0.1 | –0.1 |
| Prices | Annual change in % | |||
| Harmonised Index of Consumer Prices | +1.5 | +0.8 | +0.8 | +1.5 |
| Private consumption expenditure deflator | +1.7 | +0.9 | +0.8 | +1.5 |
| GDP deflator | +1.7 | +1.3 | +0.1 | +1.4 |
| Unit labor costs (whole economy) | +2.5 | +4.4 | –1.3 | +0.9 |
| Compensation per employee (nominal) | +2.9 | –1.0 | +1.6 | +2.3 |
| Compensation per hour worked (nominal) | +2.9 | +3.6 | –0.4 | +1.2 |
| Import prices | +0.6 | –0.5 | +0.5 | +1.3 |
| Export prices | +0.4 | –0.8 | +0.6 | +1.6 |
| Terms of trade | –0.2 | –0.3 | +0.1 | +0.3 |
| Income and savings | ||||
| Real disposable household income | +2.2 | –0.4 | –0.4 | +2.4 |
| % of nominal disposable household income | ||||
| Saving ratio | 8.3 | 13.4 | 7.7 | 7.4 |
| Labor market | Annual change in % | |||
| Payroll employment | +1.4 | –2.2 | +2.2 | +1.5 |
| Hours worked (payroll employment) | +1.4 | –6.5 | +4.3 | +2.6 |
| % of labor supply | ||||
| Unemployment rate (Eurostat definition) | 4.5 | 6.8 | 5.8 | 5.3 |
| Public finances | % of nominal GDP | |||
| Budget balance | +0.7 | –8.9 | –3.9 | –1.5 |
| Government debt | 70.4 | 84.4 | 83.7 | 81.4 |
| Source: 2019: WIFO, Eurostat, Statistics Austria; 2020 to 2022: OeNB June 2020 outlook. | ||||
| 1 The outlook was drawn up on the basis of seasonally and working day-adjusted national accounts data (in line with Eurostat requirements; data available up to the flash estimate for Q1 20). The figures for 2019 differ from the data published by Statistics Austria, which are not seasonally adjusted. | ||||
| 2 The import-adjusted growth contributions were calculating by offsetting each final demand component with corresponding imports, which were obtained from input-output tables. | ||||
HICP inflation is forecast to drop to 0.8% in 2020, reflecting above all the global plunge in demand for crude oil, which is set to almost halve oil prices in 2020. Excluding the impact of food and energy, the drop in HICP inflation to 0.8% is above all driven by the demand shock engineered by the lockdown. In 2021, inflation is expected to remain around 0.8%, as the presumed bounce-back of energy prices is likely to be offset by continued weak demand. Thus, it will take until 2022 for inflation to return to a level of 1.5%.
The comprehensive containment measures enforced between mid-March and mid-April caused the number of registered unemployed persons to soar from about 310,000 to more than 530,000. Were it not for the new short-time work scheme that was put in place, these figures would have climbed even higher. Nonetheless, unemployment (Eurostat definition) will go up to a comparatively high rate of 6.8% in 2020, before dropping below the 6% mark again in 2021 and 2022, when the economy is set to recover notably.
Constituting the largest economic policy challenge in decades, the COVID-19-related recession has prompted a substantial response from monetary, fiscal and labor market policymakers to support aggregate income and production capacity and to help cushion the fallout from the pandemic. The fiscal measures adopted by the Austrian government to contain the economic setback imply that the fiscal balance will reverse to a deficit of –8.9% of GDP in 2020, following two years with budget surpluses. The measures which the OeNB factored into its forecast as having an impact on the budget balance add up to an effect of more than 5% of GDP. The gradual lifting of such measures and the cyclical recovery from 2021 are going to lead to a marked improvement of the deficit, reducing it to –3.9% in 2021. In 2022, the budget deficit will drop to 1.5% of GDP and hence well below the 3% benchmark for the Maastricht deficit. In this context, the debt ratio is forecast to rise to 84.4% of GDP (+14 percentage points) in 2020, the second-highest level since Austria joined the EU, before starting to go down again in 2021 as output growth rebounds. The “general escape clause” activated by the European Commission suspends the adjustments Member States have to make to meet their fiscal targets under the EU’s fiscal rules. Even if the fiscal rules were to re-apply rather soon, Austria is unlikely to run into problems. From 2022 onward, Austria ought to be in a position to again meet the nominal Maastricht objectives, namely a reduction of the deficit ratio to below 3% and a sufficient reduction of the debt ratio.
Given the uncertainty about the evolution of the pandemic and the fallout from the containment response, all euro area central banks added, to the baseline for their respective countries, two alternative scenarios agreed within the Eurosystem. In a mild scenario assuming a more rapid and more successful worldwide containment of the virus than anticipated in the baseline scenario, Austria’s GDP is forecast to shrink by 4.6% in 2020 and virtually return to the level projected for end-2022 in the OeNB’s December 2019 economic outlook. In contrast, a severe scenario, with a (weaker) resurgence of infections in Austria in the fall of 2020, implies a setback of GDP by 9.2% in 2020 and a shortfall of some 7% from the December 2019 projection for 2022.
2 General and COVID-19-related assumptions
This forecast for the Austrian economy is the OeNB’s contribution to the June 2020 Eurosystem staff macroeconomic projections for the euro area. The forecast horizon ranges from the first quarter of 2020 to the fourth quarter of 2022. The cutoff date for all assumptions on the performance of the global economy, interest rates, exchange rates and crude oil prices was May 19, 2020. To prepare these projections, the OeNB used its macroeconomic quarterly model with national accounts data provided by the Austrian Institute of Economic Research (WIFO), as adjusted for seasonal and working-day effects in line with Eurostat requirements. 279 The values used up to and including 2019 may differ from the data published by Statistics Austria, which are not seasonally adjusted. Detailed national accounts data are based on the flash estimate for the first quarter of 2020.
In view of the COVID-19 pandemic, the Eurosystem adopted a number of common assumptions regarding the spread of the coronavirus disease, its containment and the availability of drugs and/or vaccines. These assumptions are common to the national forecasts produced by all euro area central banks and they also relate to the forecasts for the economies of non-euro area trading partners. Specifically, the baseline assumes initial success in containing infections in the second quarter of 2020, with infections resurging in clusters over the coming quarters, which necessitates renewed but only regional containment measures. In other words, the expectation is that we will not see a second wave requiring another strict nationwide lockdown until drugs and/or vaccines become available, which is assumed to happen by mid-2021.
In response to the COVID-19 pandemic, more or less severe lockdown policies were imposed virtually across the globe, with the euro area countries moving into lockdown in March. By the end of May, all euro area countries had eased the severe lockdowns or announced plans for a gradual further easing. Therefore, this forecast contains country-specific estimates on the economic fallout from the lockdown measures rather than a common assumption on the length and intensity of the lockdown. The lockdown drove GDP down to very low levels, in many countries above all during the second quarter, but once the economy was gradually brought back to life, strong catch-up effects set in. These effects are going to become evident in the data for the third quarter in most countries. 280 Nevertheless, some ongoing containment measures will continue to keep uncertainty at elevated levels and constrain economic activity until such time when drugs and/or vaccines become available. This implies that the real economic output of the euro area trading partners will remain below the levels anticipated in the Eurosystem’s macroeconomic projections of December 2019. Likewise, potential output growth is unlikely to bounce back in full until the end of the forecast horizon for a number of reasons, as firms invest less, write off more capital investments immediately rather than spread the write-offs over time, or even go out of business.
The other external assumptions underlying the forecast are as follows: On account of the global economic crisis, demand for Austrian exports will drop by 12.7% in 2020 according to the Eurosystem’s projections. Short-term interest rates are based on market expectations for the three-month EURIBOR, which market participants expect to remain negative throughout all three forecasting years. Long-term interest rates, which reflect market expectations for ten-year Austrian government bonds, are expected to rise from –0.15% in the first quarter of 2020 to +0.28% in the fourth quarter of 2022. The exchange rate of the euro vis-à-vis the U.S. dollar is assumed to remain constant at USD/EUR 1.08. This projected path of crude oil prices is based on futures prices, which are going to trend upward slightly following a major demand-driven setback in the first half of 2020. The price of a barrel of Brent crude oil is expected to decrease from USD 64.0 in 2019 to just USD 36.0 on average in 2020, before bouncing back to USD 40.7 in 2022. The prices of nonenergy commodities are also assumed to move in line with futures prices.
| Gross domestic product | Actual figures | June 2020 | Revisions since Dec. 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Annual change in % (real) | |||||||
| World excluding the euro area | +3.0 | –4.0 | +6.0 | +3.9 | –7.1 | +2.7 | +0.5 |
| U.S.A. | +2.3 | –6.4 | +3.6 | +2.1 | –8.4 | +1.8 | +0.4 |
| Japan | +0.7 | –5.5 | +2.5 | +1.1 | –5.7 | +1.9 | +0.6 |
| Asia excluding Japan | +5.3 | –1.6 | +8.4 | +5.5 | –6.6 | +3.2 | +0.2 |
| Latin America | –0.4 | –6.5 | +4.0 | +3.1 | –7.8 | +2.0 | +0.7 |
| United Kingdom | +1.4 | –8.5 | +4.3 | +1.8 | –9.5 | +3.3 | +0.8 |
| CESEE EU Member States1 | +3.8 | –5.2 | +4.5 | +3.4 | –8.6 | +1.2 | +0.2 |
| Switzerland | +0.9 | –6.5 | +4.0 | +1.7 | –7.7 | +2.3 | –0.2 |
| Euro area2 | +1.2 | –8.7 | +5.2 | +3.3 | –9.5 | +3.9 | +1.9 |
| World trade (imports of goods and services) | |||||||
| World | +0.7 | –12.7 | +7.9 | +4.5 | –14.1 | +5.3 | +1.6 |
| World excluding the euro area | –0.3 | –12.9 | +8.0 | +4.3 | –13.7 | +5.6 | +1.6 |
| Growth of euro area export markets (real) | +0.9 | –15.1 | +7.8 | +4.2 | –16.1 | +5.5 | +1.6 |
| Growth of Austrian export markets (real) | +1.7 | –12.7 | +6.8 | +4.7 | –14.6 | +4.1 | +1.8 |
| Prices | absolut | ||||||
| Oil price in USD/barrel (Brent) | 64.0 | 36.0 | 37.2 | 40.7 | –23.6 | –20.2 | –16.1 |
| Three-month interest rate in % | –0.4 | –0.4 | –0.4 | –0.4 | +0.0 | +0.0 | –0.1 |
| Long-term interest rate in % | 0.10 | –0.10 | 0.10 | 0.20 | –0.10 | 0.10 | –0.10 |
| USD/EUR exchange rate | 1.12 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | –0.01 | –0.02 | –0.02 |
| Nominal effective exchange rate of the euro (euro area index) | 116.7 | 118.3 | 118.8 | 118.8 | +2.4 | +2.9 | +2.9 |
| Source: Eurosystem. | |||||||
| 1 Bulgaria, Croatia, Czechia, Hungary, Poland and Romania. | |||||||
| 2 2019: Eurostat; 2020 to 2022: Results of the Eurosystem’s June 2020 projections. | |||||||
3 Spread of COVID-19 sends the global economy into a recession
In early 2020, news of a highly contagious disease later termed COVID-19 (coronavirus disease 2019) spread from the Wuhan metropolitan area in China’s Hubei province. The novel coronavirus is associated with respiratory illness, as were two earlier coronavirus diseases, the severe acute respiratory syndrome SARS 2002 (which hit above all China and other Asian countries) and the Middle East respiratory syndrome MERS 2012 (which hit above all Saudi-Arabia). The World Health Organization declared the COVID-19 outbreak a public health emergency of international concern, to ensure an immediate and concerted international response aimed at containing the spread of the virus. China implemented heavy restrictions, which affected about 80% of the domestic economy and 90% of China’s export industry. Even before that, the outlook for China’s growth had been revised downward to below 6% for 2020 in view of its trade tensions with the United States and economic restructuring. Now, the Chinese economy is expected to stagnate in 2020, given the sharp setback in the first quarter brought on by COVID-19. The outlook for 2021 is, however, a rapid re-acceleration of GDP growth to 9%.
All containment measures notwithstanding, the virus spread beyond China, first to other Asian countries and then to Europe, where Italy reported a surge in infections in late February, thus turning Europe into the second hot spot of the crisis. The northernmost provinces of Italy, above all Lombardy and Venetia, were hit hardest by the pandemic. Italy followed China’s lead on coronavirus containment, which sent the Italian economy into a major downturn already in the first quarter of 2020. With the rest of Europe following suit only with a lag, coronavirus was quick to spread across the European continent. The measures subsequently adopted in March were instrumental in keeping infections from spiraling out of control, preventing healthcare infrastructures from being overburdened and mitigating the fatal effects of the virus. Alongside Italy, the United Kingdom, Spain and France were Europe’s worst-hit countries. Several weeks of lockdown and economic shutdown virtually across Europe crushed GDP in all economies, with the losses being particularly significant in the second quarter of 2020.
Much like in the United Kingdom, public authorities in the United States, where COVID-19 infections flared up with a lag of one month, were hesitant to take drastic containment measures. The United States thus ended up turning into the third hot spot of the COVID-19 pandemic. The United States is expected to suffer a 6.4% decline in GDP in 2020, before seeing GDP growth returning to 3.6% in 2021. By mid-May, the pandemic had also started to sweep across large emerging economies, such as Brazil, Russia and India, which implies that these countries are also going to see a sharp decline in GDP in the second quarter of 2020.
In sum, the containment measures adopted worldwide engineered a global recession. The June 2020 outlook for the Austrian economy is based on the assumption that the global economy excluding the euro area will shrink by 4% in 2020 – compared with very moderate growth (0.2%) during the 2009 global financial and economic crisis. The recession of 2020 is hitting advanced and emerging economies alike, with the advanced economies taking a bigger blow to their GDP, as in 2009. The setback in global trade is expected to even exceed the plunge in GDP, as the disruption of global production chains and border closures have triggered a negative supply shock, which will reinforce spillover effects from weakening demand. Moreover, global trade tends to be more sensitive to the business cycle, and to downturns in particular, than domestic demand.
In the euro area, the pandemic has taken the biggest toll on the large economies of Italy, Spain and France in human and economic terms. The euro area economy as a whole is expected to shrink by 8.7% in 2020 – but the economic fallout in Europe and beyond would have been even larger in the absence of comprehensive government action to prevent lasting damage to livelihoods and productivity with stabilizing fiscal and economic policy measures, including measures to contain adverse labor market effects. In the euro area and in other currency areas, monetary policymakers adopted extensive measures to curb negative effects on financing conditions, and thus on aggregate demand, to harness inflation and to safeguard financial stability.
4 Austria falls into a deep recession in 2020
4.1 Coronavirus lockdown in 2020 followed by two catch-up processes
The measures adopted to contain COVID-19 not only changed the way we live and work, but also dealt a blow to economic activity that has been unprecedented in more recent economic history. In contrast to earlier recessions, we now see supply shocks converging with demand shocks, as the shutdown of services, plants and businesses and ensuing output reductions and supply chain disruptions, travel restrictions, border closures and quarantine rules reduce supply (while falling oil prices generate positive GDP effects) and as shrinking consumer and export demand, including the plunge in tourism exports, etc. hit demand. Both economic and consumer sentiment, as measured with the European Commission’s Economic Sentiment Indicator, deteriorated even further in April after an initial marked setback in March and recovered only marginally in May. It remains to be seen whether the pandemic will change economic agents’ behavior in a lasting way. Even so, recent behavioral changes such as more precautionary saving among households or investment restraint among businesses were expected to have an impact at least in the short term for the purpose of the OeNB’s June 2020 economic outlook.
The synchronicity of the shocks sent the economy into a particularly sharp tailspin, with sharply contracting oil prices remaining the only pillar of support, yet in the context of a demand shock. Thus, economic activity in Austria is expected to decline by 11.1% in the second quarter of 2020 from the first quarter, which had already witnessed a 2.5% slowdown. From an inflation perspective, the shocks are not mutually reinforcing: while the demand shock damps down inflation, the disruption of production chains exerts upward pressure on prices. On balance, the effects of reduced demand dominate the equation.
With an engineered lockdown resulting in a synchronous decline in supply and demand, it is too early for a conclusive assessment of the resulting impact on production capacity and hence on the output gap and the ensuing price pressures. Likewise, uncertainty abounds with regard to the extent to which contracting sales, liquidity shortages and debt servicing problems will cause firms to go out of business, and what this will mean for the future availability of goods and services. As is evident from the analysis in box 2, the spectrum of corporate risk and vulnerabilities is large and differs a lot across industries.
Uncertainty also extends to the impact the COVID-19 crisis may have on financial markets and financing conditions. After all, the crisis sent stock prices tumbling across the globe, drove up risk premiums on bond markets and caused asset prices to become more volatile. Negative wealth effects on households stemming, for instance, from crumbling stock and bond prices adversely affect consumption.
The Austrian government took swift and sweeping action to contain the pandemic on first signs that the coronavirus disease had spread to Austria. Initial measures included the cancellation of events and, from March 16, 2020, the shutdown of most retail outlets and of the hospitality industry. Together with movement restrictions including quarantine rules, these measures were instrumental in reducing the case reproduction number to below 1 fairly rapidly. 281 The restrictions have been eased gradually since April 13. The economic fallout from coronavirus has been cushioned by a series of COVID-19-related fiscal policy measures and further monetary policy accommodation provided by the Eurosystem.
The short-term and sentiment indicators shown in chart 2 highlight the unusual slump in economic activity and the lockdown-driven surge in unemployment.
The measures adopted to contain the COVID-19 pandemic immediately sent Austria into the deepest recession in Austria’s more recent economic history. Within a mere two weeks, the OeNB’s weekly GDP indicator 282 registered a decline by more than one-quarter compared with the same period one year earlier. Measured in terms of the demand components of GDP, the level of economic activity in Austria in the last week of March 2020 was 27% below the corresponding 2019 figure. This abrupt setback was driven at roughly equal rates by domestic demand and exports. What is particularly striking is the sharp drop in private consumption expenditure, because this component of GDP tends to be rather insensitive to the business cycle. However, this time was different as the shutdown measures slashed consumer demand for goods and personal services. The restrictions on what households could spend money on, in combination with fiscal support measures cushioning income losses, caused the saving ratio to increase.
The OeNB’s weekly GDP indicator
For timely COVID-19 impact estimates, the OeNB now produces a weekly GDP indicator based on a set of economic indicators that are compiled on a daily or weekly basis. These indicators are derived from a broad range of sources, including truck mileage data (ASFINAG, Austria’s highway operator), payments data (several payment services providers), labor market data (AMS, Public Employment Service Austria) and electric power consumption (e-control, Austrian Power Grid). These short-term economic indicators are used to calculate an activity indicator reflecting the development of real GDP on a weekly basis. The demand-side GDP components are estimated using “bridge equations,” i.e. forecasting equations linking up variables based on mixed frequencies.
Household consumption expenditures are estimated based on domestic payment card transactions data and the amounts of cash flowing back to the OeNB. Truck mileage data are used as a gauge for export performance, in line with the practice for calculating the OeNB’s export indicator. Tourism exports are estimated based on credit card payments made by nonresidents in Austria. Changes in construction investment are estimated using the daily reports of registered unemployment in the construction industry. In the absence of current daily data on investment other than construction investment, all other investment is assumed to track the weighted average of the other demand components. Public consumption and changes in inventories are assumed to develop at a stable rate. Given that all demand components mentioned are adjusted for the contribution of imports on the basis of input-output tables, the sum total of these demand components is equivalent to overall GDP. Other daily economic indicators which are not used directly for estimation serve to conduct plausibility checks on the estimates. This includes data on electricity consumption, mobility behavior, take-up of short-time work and financial market indicators.
Following a flash recession in the second half of March, the downturn in economic activity started to flatten more and more in mid-April as the lockdown measures were lifted gradually. From mid-May, the recovery accelerated visibly. As most stores re-opened, personal consumer spending picked up as well. The GDP gap against the corresponding measure of 2019 narrowed to about 11%, after having been more than twice as high at the height of the lockdown. Yet, despite some post-lockdown spending catch-up of households, weekly data show private consumption to continue to be about 7% below the levels measured in 2019.
Private consumption remained at these lower levels also in weeks 20 and 21. While the catch-up effects seem to have weakened, the re-opening of restaurants prevented the gap in consumption expenditure from widening again. The gradual recovery of non-tourism exports and of construction investment continued but was also leveling off. Tourism exports, meanwhile, remained virtually nil given travel restrictions. On balance, the level of economic activity remained 10% below the corresponding 2019 figure in week 21. The significant recovery of the economy observed in early May strengthened in the course of the month.
During the lockdown, the output losses against the same weeks of 2019 ran to as much as EUR 2 billion, continuing to total almost EUR 1 billion in week 21 despite the marked recovery. From March 16 to May 24, 2020, the output losses added up to nearly EUR 14 billion, which corresponds to some 4% of overall economic output measured in 2019 (EUR 375 billion).
| Loss per week in 2020 | Cumulated loss in 2020 | ||
|---|---|---|---|
| % of same week in 2019 | EUR billion against 2019 | ||
| Week 12 | (Mar. 16-22) | –19.9 | –1.4 |
| Week 13 | (Mar. 23-29) | –26.7 | –3.3 |
| Week 14 | (Mar. 30-Apr. 5) | –25.8 | –5.2 |
| Week 15 | (Apr. 6-12) | –25.0 | –7.0 |
| Week 16 | (Apr. 13-19) | –21.7 | –8.6 |
| Week 17 | (Apr. 20-26) | –20.9 | –10.1 |
| Week 18 | (Apr. 27-May 3) | –18.4 | –11.4 |
| Week 19 | (May 4-10) | –11.0 | –12.2 |
| Week 20 | (May 11-17) | –11.2 | –13.0 |
| Week 21 | (May 18-24) | –10.0 | –13.7 |
| Source: OeNB. | |||
The weekly assessments derived from the OeNB’s weekly GDP indicator were used to establish the short-term forecasts of GDP growth and GDP demand components on which the OeNB’s June 2020 economic outlook is based. Following a contraction of GDP in the first quarter of 2020 by 2.5% against the final quarter of 2019 as evident from national accounts data, GDP is expected to plunge by 11.1% against the first quarter in the second quarter, given projections of massive contractions for private consumption (–10.2%), investment (–12%) and exports (–17.2%). 283 As things are reverting to normal and with the recovery starting from very low levels of activity, GDP growth is forecast to bounce back to 6.3% in the third quarter on the back of catch-up effects, to be followed by above-average, yet leveling off, growth rates in the subsequent quarters.
This forecast is based on the assumption that coronavirus drugs and/or vaccines will have become available by mid-2021 (section 2), which will thus constitute a positive shock to economic sentiment and fuel the growth momentum in the second half of 2021 and in early 2022.
All in all, the OeNB projects annual GDP growth to drop to –7.2% in 2020, recover to +4.9% in 2021 and revert to +2.7% in 2022. In other words, both the contraction in 2020 and the revival in 2021 are projected to exceed the recession and recovery we saw in 2009 and 2010. While the economy will come back strong in 2021 and 2022, we are not going to see a return to pre-pandemic GDP levels before 2022.
How the lockdown hit corporate finances in Austria – a sectoral analysis 284
Coronavirus turned out to hit both the demand side and the supply side of the economy. Firms have been coping with this crisis more or less well, depending on how sound their finances were at the start of the crisis. For the purpose of the OeNB’s June 2020 outlook, indicators for four different areas were used to capture the exposure and vulnerability of individual industries. First, we used the decline in demand and the plausibility of catch-up processes to capture the demand side. Second, we used the increase in unemployment to reflect labor market developments. Third, we used the share of enforced shutdowns, employee intensity, the share of nonresident labor and the degree of dependency on imported intermediate goods to display the supply side. Fourth, we used two solvency indicators (equity capital ratio and probability of default) and two liquidity ratios (net short-term liquidity position and undrawn credit lines) to capture the financing side. All results were calculated at NACE 2-digit levels for 64 different industries for the period from March 9 to April 12, i.e. for the period during which severe lockdown policies applied in Austria. The results for the 20 hardest-hit industries are summarized in the following table.
The hospitality sector recorded the heaviest toll by far, with an estimated decline in demand by 80%. Travel agencies and travel operators suffered a drastic blow from supply constraints and saw their sales evaporate almost completely (–88%). Other services, including hair styling salons, beauty salons, laundries, pedicure services, saunas, tanning salons and pools, are characterized by a high degree of face-to-face contact with clients and were therefore heavily affected from the shutdowns. The employee intensity of such establishments is very high, thus constituting another supply-side constraint. In terms of solvency and liquidity, these undertakings more or less tie in with the overall average.
4.2 Austrian exports contract sharply due to global economic setback
Real exports from Austria started to weaken already in 2019, dropping to 2.7% annual growth following a 5.6% increase in 2018. This contraction reflects the economic weakening of Austria’s number one trading partner, Germany, as well as spillover effects on global trade from the trade tensions between the U.S.A. and China. The strong cyclical downturn in Asia and Italy following the outbreak of the COVID-19 pandemic started to have adverse effects on Austrian exports in the first quarter of 2020. With aggregate demand for Austrian exports dropping by 3.8% against the final quarter of 2019, Austrian exports shrank by 1.8% as evident from national accounts data. For the second quarter, a number of leading indicators signal a much sharper drop in exports. For instance, truck mileage dropped off by 9.5% quarter on quarter, and, according to the European Commission, incoming export orders contracted almost twice as much as during the 2009 crisis.
Total exports from Austria are expected to contract by 11.6% in real terms in 2020. The revival of trading partner economies anticipated for next year will drive demand for Austrian exports back up by 6.9% in 2021. With Austria’s key external markets normalizing during the next two years, domestic export growth is projected to reach 4.7% in real terms in 2022. Over the forecast horizon, changes in price competitiveness are unlikely to affect Austrian exports in a major way. The market shares of Austrian exports are expected to inch up in 2020 and to remain constant in 2021 and 2022. The current account surplus is forecast to decline to 1.5% of GDP in 2020 (2019: 2.6%) but is set to improve in 2021 and 2022. 285
The setback in real exports in 2020 is roughly in line with the setback in 2009, but the recovery in 2021 and 2022 will be weaker than in 2010 and 2011.
Even without the lockdown measures imposed by the Austrian government, the OeNB’s December 2019 outlook would have been up for a major revision, as global external conditions weakened sharply in recent months, which is a game changer given the central relevance of exports for the domestic economy. This becomes evident from the information provided on the reasons for the revision in table 4.
Compared with the OeNB’s December 2019 outlook, the projections for GDP growth for 2020 were revised downward by 8.3 percentage points, which is without precedent in more recent economic history. According to OeNB simulations, as much as 4.0 percentage points thereof are attributable to the setback in demand for Austrian exports triggered by the assumptions of much weaker external conditions. Specifically, these simulations reflect the anticipated changes in nominal-effective exchange rates, oil prices and demand for Austrian exports. With losses stemming from the euro’s nominal-effective appreciation (–0.14 percentage points) offsetting gains from lower oil prices (+0.27 percentage points) and with the impact of interest rate changes remaining limited, the 4.0 percentage point drop in Austrian GDP (compared with December 2019) is solely driven by the drop in demand for domestic exports due to the decline of GDP of Austria’s trading partners. The OeNB’s December 2019 outlook was based on the assumption of 1.1% growth in 2020 for the Austrian economy. This means that the change in external assumptions alone would have implied negative GDP growth of about –3% in 2020. Additional revisions to the outlook can be pinpointed to information on actual data outcomes that came in after the December projections. 286
| Exports | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Annual change in % | ||||
| Competitor prices on Austria’s export markets | +1.7 | –1.6 | +0.7 | +1.9 |
| Export deflator | +0.4 | –0.8 | +0.6 | +1.6 |
| Changes in price competitiveness | +1.2 | –0.8 | +0.1 | +0.3 |
| Import demand on Austria’s export markets (real) | +1.7 | –12.7 | +6.8 | +4.7 |
| Austrian exports of goods and services (real) | +2.7 | –11.6 | +6.9 | +4.7 |
| Austrian market share | +0.9 | +1.1 | +0.1 | +0.0 |
| Imports | Annual change in % | |||
| International competitor prices on the Austrian market | +1.3 | –0.7 | +0.8 | +1.6 |
| Import deflator | +0.6 | –0.5 | +0.5 | +1.3 |
| Austrian imports of goods and services (real) | +2.7 | –8.9 | +5.7 | +3.7 |
| Terms of Trade | –0.2 | –0.3 | +0.1 | +0.3 |
| Percentage points of real GDP | ||||
| Contribution of net exports to GDP growth | +0.1 | –1.9 | +0.8 | +0.7 |
| % of nominal GDP | ||||
| Export ratio | 55.7 | 52.0 | 53.2 | 54.3 |
| Import ratio | 52.0 | 50.1 | 50.7 | 51.1 |
| Source: 2019: WIFO, Eurosystem; 2020 bis 2022: OeNB June 2020 outlook. | ||||
| GDP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | ||
| Annual change in % | ||||
| June 2020 outlook | –7.2 | +4.9 | +2.7 | |
| December 2019 outlook | +1.1 | +1.5 | +1.6 | |
| Difference | –8.3 | +3.4 | +1.1 | |
| Caused by: | Percentage points | |||
| External assumptions | –4.0 | +1.7 | +0.9 | |
| New data1 | –3.0 | x | x | |
| of which: | Revision of historical data up to Q3 19 | –0.2 | x | x |
| Forecast errors for Q4 19 and Q1 20 | –2.9 | x | x | |
| Other changes2 | –1.4 | +1.7 | +0.2 | |
| Source: OeNB June 2020 and December 2019 outlook. Note: Due to rounding, the sum of growth contributions subject to individual revisions may differ from the total revision. | ||||
| 1 “New data” refer to data on GDP and/or inflation that have become available since the publication of the preceding OeNB outlook. | ||||
| 2 Different assumptions about trends in domestic variables such as wages, government consumption, effects of tax measures, other changes in assessments and model changes. | ||||
4.3 Growth of private consumption shrinks almost as fast as business investment growth
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Annual change in % | ||||
| Payroll employment | +1.4 | –2.2 | +2.2 | +1.5 |
| Wages and salaries per employee | +2.9 | –1.0 | +1.6 | +2.3 |
| Compensation of employees | +4.3 | –3.1 | +3.8 | +3.8 |
| Investment income | +1.7 | –18.2 | –8.1 | +13.9 |
| Self-employment income and operating surpluses (net) | +4.9 | –5.9 | +1.0 | +6.2 |
| Contribution to household disposable income growth | Percentage points | |||
| Compensation of employees | +3.7 | –2.7 | +3.2 | +3.3 |
| Investment income | +0.2 | –2.0 | –0.7 | +1.1 |
| Self-employment income and operating surpluses (net) | +0.8 | –1.0 | +0.2 | +1.0 |
| Net transfers less direct taxes1 | –0.8 | +6.3 | –2.2 | –1.5 |
| Annual change in % | ||||
| Disposable household income (nominal) | +3.9 | +0.4 | +0.5 | +3.9 |
| Consumption deflator | +1.7 | +0.9 | +0.8 | +1.5 |
| Disposable household income (real) | +2.2 | –0.4 | –0.4 | +2.4 |
| Private consumption (real) | +1.3 | –5.8 | +6.1 | +2.6 |
| % of household disposable income growth | ||||
| Saving ratio | 8.3 | 13.4 | 7.7 | 7.4 |
| % of nominal GDP | ||||
| Consumption ratio | 51.6 | 52.2 | 53.1 | 53.1 |
| Source: 2019: WIFO, Statistics Austria; 2020 to 2022: OeNB June 2020 outlook. | ||||
| 1 Negative values indicate an increase in (negative) net transfers less direct taxes; positive values indicate a decrease. | ||||
In textbook economics, private consumption has a stabilizing impact on the business cycle in times of crisis, as has been the case in Austria during previous crisis episodes and cyclical setbacks. In contrast, business investment, and investment in equipment in particular, is highly sensitive to the cycle. If we look at what happened during the 2009 crisis, we see that growth of private consumption remained broadly stable whereas gross fixed capital formation contracted by 7.2% and investment in equipment plunged by 10.5%. In the consumption behavior of households, fixed costs are no small part of the equation, thus severely limiting the room for maneuver when income drops off. Basically, only demand for durable consumer goods is more sensitive to the business cycle. In the aggregate, income losses are offset by dissaving, thus making consumer demand a stabilizing factor in the business cycle. In contrast, gross capital formation in general and investment in equipment in particular are driven by financing conditions but even more so by the outlook for profit. Profit, however, is highly sensitive to the business cycle, and largely procyclical to be precise.
2019 was a good income year for Austrian households. The unemployment rate stood at 4.5%; compensation of employees increased by 4.3% in nominal terms, driven among other things by higher tax relief for families with children; and self-employment income and investment income benefited from economic conditions. Inflation totaled 1.5%, thus remaining at below-average levels in a long-term comparison. Wage income per employee increased by as much as 1.3% in real terms. In sum, these developments caused real disposable household income to rise by 2.2%, which is the strongest increase since 2007.
All this changed with the COVID-19 pandemic in 2020. The recession hit all types of incomes to an extent that is unprecedented in more recent economic history. This is true for capital income (–18.2%) as well as for self-employment income including operating surpluses generated by businesses (–5.9%). The impact of lower capital income on aggregate consumer demand should be below average, however, as the marginal propensity to consume is much lower for income generated through investment than for employee compensation. To some extent, employee compensation in 2020 continues to benefit from collective wage agreements reached in 2019. Yet, the economic downturn triggered a significant decrease of employment and an unprecedented increase of unemployment and caused the wage drift to become clearly negative (table 8). Despite high budgetary support for short-time work schemes (box 4), which qualifies as subsidies to businesses under national accounts rules and thus add to compensation of employees rather than to transfers to households, the OeNB expects nominal compensation of employees to shrink by 3.1%. Net government transfers beyond spending on short-time work schemes (transfers less taxes) and the low inflation rate (consumption deflator: 0.9%) are projected to have a stabilizing impact on household income. In sum, nominal and real disposable household income is expected to more or less stagnate in 2020 and 2021 (between +0.5% and –0.4%) and to rise again in 2022 amid the economic recovery.
At the same time, consumer behavior is characterized by two additional unprecedented factors in 2020: First, the lockdown measures severely limited consumer spending (“forced saving”). Second, negative sentiment effects fueled by sharply increased unemployment levels and uncertainty about economic conditions increased the propensity to save as the crisis progressed (precautionary saving). As a result of these two effects, the saving ratio jumps from 8.3% in 2019 to 13.4% in 2020. The forecast for 2021 and 2022 is driven by the assumed positive shock resulting from the availability of coronavirus drugs and/or vaccines, which is expected to improve economic sentiment, thus leading to a normalization of saving behavior and a drop in the saving ratio.
On balance, the OeNB forecasts real consumption to contract by about 6% in 2020, or by almost as much as economic output. When we compare this situation with the 2009 crisis, we find that the decline of real disposable household income measured in 2009 roughly matches the decline projected for 2020, but that this decline was accompanied by a significant drop of the saving ratio at the time, as a result of which real private consumption continued to grow by 0.9% in 2009. In 2021 and 2022, private consumption is expected to see catch-up processes leading to above-average growth rates (6.1% and 2.6%, respectively).
Fiscal outlook for 2020 to 2022 287
Amid the COVID-19 pandemic, the budget surplus achieved in 2019 is set to melt away in 2020, which heralds deficits for years to come. Following general government budget surpluses of 0.2% and 0.7% of GDP in 2018 and 2019, the coronavirus-related cyclical downturn and the fiscal measures adopted temporarily by the government to prevent lasting damage to the economy are going to generate a deficit of 8.9% of GDP in 2020. Once these measures have been lifted and the economy recovers next year, the deficit should improve substantially and drop to 3.9% in 2021. In 2022, the budget deficit should decline to 1.5% of GDP and hence well below the 3% benchmark for the Maastricht deficit.
The fiscal measures announced so far by the Austrian government to cushion the pandemic fallout add up to some EUR 50 billion (or 13.3% of GDP). Most of the measures are aimed at safeguarding the production potential: liquidity-strengthening measures, transfers and subsidies for short-time work are meant to keep businesses running, save jobs and compensate for crisis-related drop-offs in income. Another goal of the measures is to ensure that production and economic activity can be resumed smoothly following the exit from the containment measures.
All in all, EUR 12 billion have been appropriated for the new short-term work scheme, EUR 10 billion for deferrals for tax liabilities and EUR 28 billion for the COVID-19 Crisis Management Fund. The EUR 28 billion-strong COVID-19 Crisis Management Fund (5th COVID Act) covers resources allocated to the original COVID-19 fund (EUR 4 billion), emergency aid for the hardest-hit industries and firms (EUR 15 billion; also referred to as coronavirus relief fund) and other guarantees (EUR 9 billion). As part of the coronavirus relief fund, up to EUR 8 billion will be granted as subsidies to help firms with major coronavirus-related liquidity constraints to cover their fixed costs. The remainder of the coronavirus relief fund (EUR 7 billion) has been earmarked for guarantees (covering up to 100% of emergency loans). The budgetary impact of these measures is very heterogeneous. Loans and guarantees are going to have an impact on the budget balance (i.e. will increase spending) only if loans become nonperforming or guarantees are called. Deferrals for tax liabilities and/or social security contributions do not feed through in full to the general government balance for 2020 according to the ESA 2010 accounting rules.
The OeNB’s June 2020 outlook is based on the assumption that the government measures are going to impact the budget for 2020 by an amount that slightly exceeds 5% of GDP. Specifically, the COVID-19 fund (which also includes the hardship fund for micro businesses, self-employed individuals and professionals) is expected to be exhausted in full. Likewise, the resources set aside for subsidies to help firms cover their fixed costs are expected to be used up in full. Since subsidy requests may be made until the end of August 2021, part of the budgetary effect will not materialize until 2021. The take-up of deferral options for tax and advance tax liabilities and of the funds earmarked for financing short-time work is linked to the expectations about the recovery of the economy. The OeNB’s fiscal outlook is based on the assumption that the exit from the deferrals for tax liabilities will not be complete until 2022 and that the COVID-19-related short-time work program will after six months be replaced by the former, less generous program. This means that the COVID-19 measures will increase the budget deficit by close to 1.5% in 2021 and by 0.1% of GDP in 2022 (with most of the impact in 2022 related to tax relief and support measures for restaurants). As the OeNB’s fiscal forecast is Austria’s contribution to the Eurosystem staff macroeconomic projections for the euro area, it covers only measures that have already been adopted by parliament or by the government or that have at least been adequately specified, which is in line with ESCB requirements. This is why this forecast includes neither potential future stimulus packages nor the income tax reform that has been announced in the media but without the provision of adequate details. Furthermore, the potential cost of state guarantees has not been quantified for the purpose of this forecast.
Apart from discretionary measures, it is above all automatic stabilizers that drive the budget balance. In Austria, automatic stabilizers have a comparatively strong effect, driven by support granted in lieu of unemployment benefits and wage and income tax progressivity. With regard to the budget balance for 2020, some 3% of the deterioration are due to the automatic stabilizers. As the economy is expected to bounce back strongly in 2021 and 2022, the working of these stabilizers is going to automatically improve the exceptionally high budget deficit of 2020.
The surge in the debt ratio to 84.4% of GDP (+14 percentage points) drives up Austria’s debt ratio to the second-highest level since its EU accession. 288 This increase reflects the very high primary deficit clocked up in 2020 (about 7.5% of GDP) but also the decline in GDP, which reduces the nominator of the GDP ratio. The debt ratio will revert to its declining trend already in 2021, above all on account of clearly positive GDP growth, while the negative primary balance continues to drive up the debt ratio, if at a lower rate.
The general escape clause activated by the European Commission suspends the adjustments Member States have to make to meet their fiscal targets under the EU’s fiscal rules. Even if the EU’s fiscal rules were to re-apply rather soon, Austria is unlikely to run into problems. Austria ought to be in a position to again meet at least the nominal Maastricht objectives, namely a reduction of the deficit ratio to below 3% and a sufficient reduction of debt ratio, from 2022 onward.
In recent years, business investment was a key pillar of the economy, as the most recent investment cycle was exceptionally long and strong by historical standards. In 2019, investment growth had decreased against 2018, but still totaled as much as 2.8% and continued to be broad based. Construction investment, which is considerably less sensitive to the business cycle than other forms of investment, made a significant contribution to the growth of gross fixed capital formation.
The lockdown caused corporate profits and industrial production to take a plunge. Capacity utilization dropped from 84.8% in January 2020 to 73.9% in April 2020. Furthermore, the supply of intermediate goods was constrained due to disruptions in international production chains and the supply of labor was reduced temporarily on account of border closures. This caused investment projects to be reviewed, canceled or rescheduled.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Annual change in % | ||||
| Total gross fixed capital formation (real) | +2.8 | –6.7 | +4.7 | +3.1 |
| of which: | ||||
| Investment in plant and equipment | +2.6 | –14.5 | +8.8 | +3.5 |
| Housing investment | +3.9 | –2.6 | +2.3 | +3.6 |
| Nonhousing investment and other investment | +1.7 | –3.4 | +3.3 | +3.1 |
| Investment in research and development | +3.4 | –1.6 | +2.5 | +2.4 |
| Public sector investment | –1.6 | –1.7 | +3.2 | +3.1 |
| Private investment | +3.4 | –7.4 | +4.9 | +3.2 |
| Contribution to the growth of real gross fixed capital formation | Percentage points | |||
| Investment in plant and equipment | +0.9 | –5.0 | +2.8 | +1.1 |
| Housing investment | +0.7 | –0.5 | +0.4 | +0.7 |
| Nonhousing investment and other investment | +0.5 | –0.9 | +0.9 | +0.8 |
| Investment in research and development | +0.7 | –0.3 | +0.5 | +0.5 |
| Public sector investment | –0.2 | –0.2 | +0.4 | +0.4 |
| Private investment | +3.0 | –6.5 | +4.3 | +2.8 |
| Contribution to real GDP growth | ||||
| Total gross fixed capital formation | +0.7 | –1.6 | +1.1 | +0.8 |
| Changes in inventories | +0.1 | –0.9 | –0.6 | –0.3 |
| % of nominal GDP | ||||
| Investment ratio | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.4 |
| Source: 2019: WIFO; 2020 to 2022: OeNB June 2020 outlook. | ||||
Unlike in the case of private consumption, the lockdown-engineered sharp downturn in corporate investment demand in some industries can be reverted fairly rapidly, above all in the construction sector, unless supply-side restrictions were to kick in, i.e. prevent nonresident workers from resuming their jobs in Austria due to border closures. Investment activity is expected to be fueled by catch-up effects in the second half of 2020. In sum, investment is projected to decline by 6.7% in 2020 as a whole, which roughly matches the drop in gross fixed capital formation registered in 2009.
As global trade is expected to recover in 2021, with the promise of newly improving industrial sales prospects, investment in equipment stands to rebound considerably in 2021. On top of that, persistently favorable financing conditions should support investment activity, and catch-up effects ought to spill over to 2021 as well. Additional stimulus will come from the assumed positive supply shock (availability of coronavirus drugs or vaccines) and its uplifting impact on business sentiment in 2021 and 2022. Last but not least, construction investment is a lot less sensitive to the business cycle than investment in equipment. Hence, construction investment remains a pillar of growth throughout the forecast horizon.
As the downturn in GDP growth in 2020 is also driven by private consumption and exports, the investment ratio is going to remain unchanged at about 24% in 2020 compared with 2019, and the same holds true for 2021 and2022.
4.4 Unemployment hits record high despite new short-time work scheme
Before the COVID-19 outbreak, labor market conditions in Austria were highly favorable by international standards, with the number of payroll employees having grown by an annual 1.7% on average since 2016. Unlike in the past, these increases did not go hand in hand with weaker growth of total hours worked. Instead, at a growth rate of 1.7%, the average number of hours worked grew in sync with the number of payroll employees. Over the past years, Austria’s unemployment rate declined steadily, reaching 4.5% in 2019, the lowest level since 2008.
However, in March 2020, the crisis brought about by the COVID-19 pandemic led to a massive surge in unemployment. Within a mere two and a half weeks, the number of registered unemployed persons jumped from 310,000 to 522,000 and stood at 534,000 in mid-April. Since mid-April, when lockdown measures started to be eased, unemployment figures have declined slightly. This development is in line with the results obtained by the OeNB’s weekly GDP indicator, which points to a moderate narrowing of the GDP gap (see section 4.1). Increases in unemployment were especially pronounced in sectors directly affected by national containment measures, such as the hospitality industry, administrative and support services, wholesale and retail trade as well as employee leasing, which is highly procyclical. While unemployment in construction likewise rose strongly at the onset of the pandemic, it has meanwhile returned to below pre-pandemic levels. Yet, against the previous year, unemployment increased markedly also in construction, which is a sector with strong seasonal fluctuations. The number of persons participating in training programs offered by the Public Employment Service Austria (AMS), i.e. persons not deemed to be unemployed, decreased, coming to about 55,000 in mid-April. At the height of the labor market crisis, the number of vacancies declined by some 25,000, with the decline having decelerated significantly since April, however.
One labor market policy measure that has proven crucial for current labor market developments is short-time work, which is aimed at maintaining employment levels in times of crisis (see box 4). The number of employees on short-time work is in all sectors higher than that of jobless persons, which has picked up due to containment measures. This is particularly evident in the manufacturing industry, wholesale and retail trade as well as construction. Yet in the hospitality industry, take-up of short-time working arrangements has more or less matched the increase in unemployment. In total, applications for short-time work arrangements were filed for more than 1.3 million employees. Assuming that these employees saw their working hours cut by 70% on average (which most likely constitutes an upper limit), implicit unemployment due to short-time work would come to about 938,000 full-time equivalents. Adding up this figure with the above-mentioned numbers of registered unemployed persons and persons in training brings the total number of jobless persons at the peak of the crisis to around 1.5 million, which corresponds to 37% of payroll employees or 33% of overall employment in 2019.
For the full year 2020, the OeNB expects the total number of employees to drop by 2.2%, which does not reveal the true extent of the crisis, however. The number of hours worked is forecast to decrease by 6.5% in 2020, due to short-time working arrangements coupled with underutilized production capacity and the associated reduction in overtime. Both in 2021 and 2022, the number of hours worked will grow at above-average rates on the back of anticipated catch-up processes.
Assessing the role of short-time work in tackling the labor market crisis 289
In Austria, short-time working arrangements have long proven an effective tool to curb unemployment in times of crisis. Instead of having to lay off parts of their staff, such arrangements allow firms experiencing “temporary economic difficulties” 290 to reduce employees’ working hours evenly and equitably. Firms thus pay salary for reduced working hours only; in addition, employees are compensated for part of their loss in earnings due to the temporary cut in work time by the Public Employment Service Austria (AMS). During the financial and economic crisis in 2009, short-time work was effective in retaining employment, with an average 26,000 covered workers throughout the year (see left-hand panel of chart B4). It thus helped prevent a surge in unemployment.
Pre-pandemic short-time working arrangements provided for an income replacement rate of 55% of previous net earnings, with firms being able to apply for a cut in working hours of up to 50%. This “old” short-time work program, which was mainly used by large manufacturing companies, was found to be inadequate to address the severe labor market crisis sparked by the lockdown in mid-March. Therefore, the Austrian government, in cooperation with the social partners, decided to launch a new short-time work program. 291 According to the new scheme, short-time working subsidies are granted for a period of three months, which may be extended by another three months. Work time may be cut by as much as 90%, and income replacement rates were revised upward markedly. Subsidies may now amount to 80%, 85% or 90% of employees’ previous net earnings depending on their salary. The new scheme became attractive also for smaller firms operating in any sector, with applications being processed in an unbureaucratic fashion and subsidies being disbursed more quickly. Current data show that a great number of firms applied for short-time work – for more than 1.3 million employees to be precise (see middle panel of chart B4). Applications were particularly high in the manufacturing industry, followed by wholesale and retail trade, construction and the hospitality industry.
There is a lack of meaningful data on the actual uptake of short-time work as applications may also be filed retroactively. Moreover, the average reduction in working hours by around 70%, as indicated by the applications, appears to be high. In view of these findings, we based the OeNB’s economic outlook on the following assumptions: Considering the lessons learned from the 2009 recession (see left-hand panel of chart B4), we assume that actual uptake of short-time work falls about 35% short of what is suggested by the applications filed. In addition, we expect the number of covered workers to decrease notably by September 2020. We also assume that the new short-time work scheme implemented in the context of COVID-19 will expire after six months, and that working hours will have been cut by an average 50%. As a result, the OeNB expects the number of employees on short-time work to average 214,000 (107,000 full-time equivalent positions) in 2020, and related budgetary costs or expenditures to amount to an estimated EUR 5.5 billion. Under ESA 2010 rules, disbursed short-time work subsidies are recorded as part of employee compensation. Without short-time work subsidies, aggregate compensation of employees would decline even more strongly in 2020 as is evident from the right-hand panel of chart B4.
Labor supply growth has dropped only marginally in recent years, fueled by migration, the rising labor force participation rate specifically of older workers, and the procyclical response of the labor market supply (idle labor capacity). In 2020, labor supply growth is projected to slow to a mere 0.1%, given this year’s slump in economic activity and the procyclicality of labor market supply. At 1.0% in 2021 and 0.8% in 2022, labor supply is expected to increase at a slightly slower pace than in the pre-pandemic period.
Austria’s unemployment rate (Eurostat definition) decreased steadily from a peak of 6.0% in 2016 to 4.5% in 2019. For 2020, the OeNB forecasts a crisis-induced increase to 6.8%, which means that unemployment will be significantly higher than in the crisis year 2009 and subsequent years. Despite the anticipated economic recovery, the unemployment rate will dip only slightly, to 5.8% in 2021, and edge down to 5.3% in 2022, thus roughly reaching levels last observed in 2009.
| Gross wages and salaries1 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Annual change in % | ||||
| In nominal terms | +4.3 | –3.1 | +3.8 | +3.8 |
| Consumption deflator | +1.7 | +0.9 | +0.8 | +1.5 |
| In real terms | +2.7 | –3.9 | +3.0 | +2.3 |
| Collectively agreed wages and salaries1 | +3.1 | +2.1 | +0.8 | +1.9 |
| Wage share | –0.1 | –3.1 | +0.8 | +0.4 |
| Compensation per employee | ||||
| Gross2 compensation (nominal) | +2.9 | –1.0 | +1.6 | +2.3 |
| Gross compensation (real) | +1.3 | –1.8 | +0.8 | +0.8 |
| Net3 compensation (real) | +0.8 | –1.7 | +0.5 | +0.5 |
| Compensation per hour worked | ||||
| Gross compensation (nominal) | +2.9 | +3.6 | –0.4 | +1.2 |
| Gross compensation (real) | +1.2 | +2.8 | –1.2 | –0.3 |
| % of nominal GDP | ||||
| Wage share | 48.4 | 50.0 | 49.4 | 49.2 |
| Source: 2019: WIFO, Statistics Austria; 2020 to 2022: OeNB June 2020 outlook. | ||||
| 1 Overall economy.. | ||||
| 2 Including employers’ social security contributions. | ||||
| 3 After tax and social security contributions. | ||||
4.5 Energy prices and COVID-19 crisis damp down inflation 292
Based on the OeNB’s most recent inflation forecast, we expect HICP inflation to stand at 0.8% in both 2020 and 2021, before increasing to 1.5% in 2022.
Inflation developments observed in the course of 2020 signal a rapid decline until the end of the year, which will be succeeded by a moderate, yet continuous, rise. Until early 2021, the OeNB expects the HICP’s energy component to damp inflation. The massive pandemic-induced setback in demand will particularly impact on core inflation, i.e. services and nonenergy industrial goods. In the second quarter of 2021, energy price effects driven by the exceptionally sharp drop in crude oil prices from March 2020 onward will bottom out, and downward effects on inflation brought about by the COVID-19 pandemic will ease gradually. Until the close of 2022 or the end of the forecast horizon, HICP inflation is projected to climb to 1.6%, and will thus remain below its long-term average of 1.9%. This is primarily attributable to the still negative output gap. Even though capacity utilization is set to steadily increase, it is unlikely that production factors will be used to their full capacity by end-2022.
Setbacks in demand resulting from COVID-19 containment measures affect above all services and nonenergy industrial goods. As a result, core inflation, as measured by the HICP excluding energy and food, is projected to drop from 1.4% in 2020 to 0.6% in 2021, before re-accelerating to 1.3% in 2022. Core inflation will thus trail HICP inflation in 2021 and 2022.
Core inflation components and energy inflation are set to decline
Plummeting oil prices observed since March 2020 reached a recent low at the end of April and are now expected to follow a moderate upward trend. The recovery in oil prices is likely to have been fueled by OPEC+ agreeing to a cut in oil output by approximately 10 million barrels of oil a day through May and June 2020. 293 Nevertheless, energy inflation is projected to remain visibly negative until early 2021, climbing into positive territory only thereafter. In 2020, the HICP’s energy component will depress inflation by around ½ percentage point. The assumption of lower crude oil prices is expected to put downward pressures on fuel prices in particular, which account for around 46% of the HICP’s energy component. Increases in electricity and gas prices that were implemented in 2019 are projected to weigh on the annual inflation rate in 2020, barring a further increase in electricity and gas prices. In 2021 and 2022, energy price inflation will have returned to positive territory.
Nonenergy industrial goods inflation is forecast to average out at 0.7% for the full year 2020. In 2021, it is projected to drop to 0.1% due to a massive slump in demand caused by the COVID-19-induced recession. This demand shock affects almost all subcomponents of nonenergy industrial goods, with heavy discounts being expected on clothing and footwear in particular, which make up some 23% of nonenergy industrial goods. Also, in view of the increased uncertainty and the sharp increase in unemployment, consumers are likely to postpone purchases of durable consumer goods such as vehicles or furniture, which will weigh on inflation in these product groups. On the other hand, COVID-19-related measures may lead to major disruptions in domestic and global value chains, which may result in certain products being in short supply. As a consequence, industries affected by constraints on production may see their prices go up. This possibility poses an upside risk to inflation.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Annual change in % | ||||
| Harmonised Index of Consumer Prices | +1.5 | +0.8 | +0.8 | +1.5 |
| HICP energy | +0.7 | –6.9 | +0.4 | +2.3 |
| HICP excluding energy | +1.7 | +1.4 | +0.6 | +1.3 |
| Private consumption expenditure deflator | +1.7 | +0.9 | +0.8 | +1.5 |
| Investment deflator | +2.1 | +0.8 | +0.6 | +1.3 |
| Import deflator | +0.6 | –0.5 | +0.5 | +1.3 |
| Export deflator | +0.4 | –0.8 | +0.6 | +1.6 |
| Terms of trade | –0.2 | –0.3 | +0.1 | +0.3 |
| GDP deflator at factor cost | +1.8 | +1.1 | –0.2 | +1.4 |
| Collective wage and salary settlements | +3.1 | +2.1 | +0.8 | +1.9 |
| Compensation per employee | +2.9 | –1.0 | +1.6 | +2.3 |
| Compensation per hour worked | +2.9 | +3.6 | –0.4 | +1.2 |
| Labor productivity per employee | +0.4 | –5.1 | +2.9 | +1.4 |
| Labor productivity per hour worked | +0.4 | –0.7 | +1.0 | +0.4 |
| Unit labor costs | +2.5 | +4.4 | –1.3 | +0.9 |
| Profit margins1 | –0.8 | –3.3 | +1.0 | +0.5 |
| Source: 2019: WIFO, Statistics Austria; 2020 to 2022: OeNB June 2020 outlook. | ||||
| 1 GDP deflator divided by unit labor costs. | ||||
The OeNB expects services inflation to decrease from 1.8% in 2020 to 0.8% in 2021, again mainly due to the COVID-19-induced setback in demand affecting roughly 70% of services. It may take quite some time for demand levels to recover, particularly as regards demand for air transport services, package holidays and hospitality services. Moreover, the safety measures implemented to contain the spread of COVID-19, including physical distancing and hygiene requirements, are expected to partly drive up costs. Given the above-mentioned slump in demand, however, these costs will probably not be passed on to consumers, or at least not fully.
Inflation of food prices, including alcohol and tobacco, has been on the rise recently, albeit from low levels. This is mainly attributable to increases in agricultural commodity prices, which have resulted in upward pressures on imported food prices. Food price inflation is expected to come to 2.0% in 2020, and to increase thereafter to 2.3% in 2021, before dipping back to 2.0% in 2022. Tobacco tax hikes announced for the fall of 2020 and the spring of 2021 and 2022 will cause food price inflation to edge up by 0.2 percentage points each in 2021 and 2022. In 2020, food price inflation will remain in a basis point range, as the hikes in taxes on tobacco will only start in October 2020. 294
Inflation measurement in times of COVID-19
Mandatory business closures implemented to contain the COVID-19 pandemic have had a significant impact on inflation measurement. As numerous shops were closed, it was no longer possible to collect many of the prices usually recorded in stores across Austria. Moreover, due to safety concerns, data on prices were, for the most part, not gathered on site in April 2020. Instead, prices were collected using other sources of information, such as telephone surveys and online data – e.g. for clothing, footwear, sporting goods and furniture – as well as scanner data – e.g. for food products and drugstore goods.
Since prices are usually recorded in the first half of the month, Austrian inflation rate compilations for March 2020 were hardly affected by collection challenges. However, this was no longer the case for inflation measurements in April, which were heavily compromised by the above-mentioned difficulties. According to Eurostat, 31% of prices as measured by their weight in the HICP basket were not, or only partly, available when compiling the Austrian HICP for April. This percentage roughly corresponded to the euro area average. It proved particularly difficult to collect prices for package holidays (100% unavailable), new vehicles (100%), the hospitality industry (92.7%) and recreational and cultural services (89%). In line with agreements at the European level, Statistics Austria therefore carried forward prices from the previous month, particularly for goods that are not subject to strong price fluctuations such as new vehicles. Alternatively, prices subject to strong seasonal variation, e.g. package holiday prices, were carried forward according to their seasonal patterns from the previous year. In case not all prices of an aggregate are unavailable, the missing prices may be replaced with available subindices 295
The quality of price statistics is not only impaired by difficulties in price collection but also by shifts in consumption patterns. During the lockdown, consumption seems to have shifted toward food products and health services, away from recreational and cultural services and the services offered by the hospitality industry as well as fuels, which seem to have been consumed to a much lesser extent than suggested by their weight in the official HICP basket. The HICP is compiled on the basis of constant consumption weights within a given calendar year. If consumption patterns change temporarily owing to a sharp economic contraction, these adjustments will not be reflected in the HICP. The COVID-19-related economic developments therefore pose significant challenges for inflation analysts.
5 Assessing the risks to the OeNB’s June outlook: alternative scenarios point to a drop in GDP ranging from –5% to –9% in 2020
The present economic outlook is subject to a high degree of uncertainty surrounding the further spread of COVID-19, the need for and effectiveness of containment measures and the availability of drugs and/or vaccines. To better capture the broad range of possible economic effects caused by the COVID-19 pandemic, each euro area national central bank was tasked with calculating two additional scenarios – given a mild or a severe economic downturn – for the June 2020 Eurosystem staff macroeconomic projections for the euro area. 296 Like the economic outlook, both scenarios are based on a set of commonly agreed assumptions for all euro area countries and their respective external environment. Each national central bank in the euro area took it upon itself to incorporate these assumptions into the corresponding scenario.
Assumptions
The assumptions underlying the two additional scenarios differ from those underlying the economic outlook with respect to epidemiological developments, the economic fallout from the lockdown, the timeline for easing lockdown restrictions, expected GDP levels by the end of the forecast horizon and effects on long-term production capacity (potential output). In the mild scenario, which assumes a relatively lower GDP contraction, rapid advances in medical treatments succeed in containing the spread of COVID-19 after lockdown measures were eased, thus enabling a relatively swift return to normal economic activity. The mild scenario as implemented by the OeNB does not include any additional assumptions specific to Austria. By contrast, in the severe scenario, which projects a relatively stronger GDP contraction, the adopted measures have only limited success in containing the spread of the virus, which necessitates renewed and more stringent lockdown measures. This depresses economic activity in a more pronounced and sustained way. The OeNB’s severe scenario is moreover based on the assumption that there will be a second wave of infections in the fall of 2020, which will be contained more swiftly, however, as a result of lessons learned during the first peak of infections and where lockdown measures will be imposed only locally. We thus assume that the second lockdown will remain in place for only three weeks before being gradually lifted over another three weeks. Benefiting from local containment, the economic impact of each three-week period is forecast to be only half the size of that observed during the first wave of infections. Moreover, we expect the second flare-up to only emerge in Austria, which means that demand for Austrian exports remains unchanged. At the same time, however, the resurgence of infections again leads to supply-side constraints, causing exports from Austria to stagnate over this period.
Comparing economic outlook results and scenario results
The upper panel of chart 12 presents a stylized view, for the OeNB’s forecast as well as the mild and severe scenarios, of the direct economic fallout, i.e. GDP losses, caused by the COVID-19 pandemic over time. Until mid-May 2020, all three forecasts show the same impact. In line with the underlying assumptions, direct negative effects on economic activity triggered by the second wave of infections are considerably smaller than those brought about by the lockdown in spring, thanks to “learning effects” observed for Austria.
The lower panel of chart 12 shows the paths of real GDP projections according to the OeNB’s June 2020 outlook, its December 2019 outlook and the two alternative scenarios. In the mild scenario, Austria’s GDP as estimated using quarterly data is forecast to return to the level projected for 2022 in the OeNB’s December 2019 outlook. Yet even in the mild scenario, it is only in early 2021 that economic activity will bounce back to its pre-pandemic level. According to the OeNB’s June 2020 outlook, GDP will fall a good 4% short of the level forecast for end-2022 in the OeNB’s December 2019 outlook, returning to the level recorded before the pandemic only in the same year. In the severe scenario, stricter containment measures imply a permanent loss in economic output, with GDP remaining well below pre-pandemic levels even toward the end of 2022. Like the first wave of infections in spring 2020, the second spike is also expected to trigger simultaneous supply and demand shocks. Related effects will only emerge in Austria, however, and will, in the fourth quarter of 2020, lead to a renewed 2.5% drop in GDP quarter on quarter. Strong declines are then also projected for private consumption (–5.1%) and gross fixed capital formation (–6.1%). Compared with the OeNB’s June outlook, GDP growth projections for 2020 were revised downward by another 2 percentage points in the severe scenario, resulting in an overall plunge of –9.2%. At a 3.5% growth rate, the recovery of the Austrian economy will be substantially weaker in 2021 than anticipated in the present outlook (4.9%).
Potential output
According to the OeNB’s economic outlook and its alternative scenarios, potential output growth is forecast to slow considerably in 2020 compared with 2019 growth levels. While potential output is projected to re-accelerate in 2021 in the mild scenario, it is expected to lose further momentum according to the OeNB’s June outlook. It even turns slightly negative in the severe scenario. In 2022, potential output growth is projected to recover, albeit at a varying pace depending on the forecast, and will catch up with the growth levels anticipated in the OeNB’s December 2019 outlook only in the mild scenario.
Inflation forecast
According to the alternative scenarios, the annual inflation rate will range between 1.1% and 0.7% in 2020, 1.2% and 0.2% in 2021, as well as 1.7% and 1.3% in 2022. At 1.9% in the fourth quarter of 2022, HICP inflation is expected to revert to its long-term trend in the mild scenario only. This is due to the output gap being closed, or turning positive, at the end of the forecast horizon under the mild scenario. By contrast, in both the severe scenario and the OeNB’s June outlook, production factors are expected to remain underutilized over the entire forecast horizon. Moreover, the forecasts differ with respect to the timing and the extent of inflation bottoming out. In the severe scenario, inflation is expected to reach its lowest level in the first quarter of 2021, i.e. later than anticipated in the mild scenario and the OeNB’s June outlook, which project inflation to bottom out in the fourth quarter of 2020. Moreover, the severe scenario projects inflation to turn negative in the first quarter of 2021, with the Austrian economy experiencing a deflation of 0.7%. At 0.3% and 0.1%, respectively, the mild scenario and the OeNB’s June outlook project inflation to remain positive throughout the entire forecasting horizon.
Fiscal forecast
The fiscal forecasts under the alternative scenarios differ from the OeNB’s regular fiscal outlook in two aspects: First, different cyclical developments will result in different budget balances due to the impact of automatic stabilizers. Second, the take-up of the fiscal stimulus package is assumed to vary depending on the scenario used, as different cyclical developments require different support measures. If we assume lower (higher) spending e.g. on short-time work schemes or fixed cost subsidies than projected in the June 2020 outlook, we arrive at utilization rates of discretionary fiscal measures in the amount of 3.5% of GDP (7.0% of GDP) in the mild (severe) scenario.
What both scenarios have in common is that they point to a high budget deficit in 2020 (mild scenario: –6.0% of GDP; severe scenario: –11.5% of GDP), followed by a gradual recovery. While the mild scenario expects Austria to achieve a balanced budget in nominal terms in 2022, this achievement is not in the cards in the severe scenario, which projects Austria’s deficit to remain above the reference value of 3% of GDP also in 2022. Finally, debt ratio dynamics indicated by the mild scenario deviate significantly from those assumed in the severe scenario: following a rapid increase in 2020, the debt ratio is forecast to go down again notably in 2021 in the mild scenario. According to the severe scenario, it will take until 2022 for the debt ratio to stabilize, which is attributable to sustained large primary deficits.
| Economic activity | December 2019 outlook | Scenario mild | June 2020 outlook | Scenario severe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Annual change in % | |||||||||||||
| Gross domestic product | +1.5 | +1.1 | +1.5 | +1.6 | –4.6 | +6.4 | +2.7 | –7.2 | +4.9 | +2.7 | –9.2 | +3.5 | +3.4 |
| Private consumption | +1.3 | +1.3 | +1.3 | +1.4 | –4.8 | +6.2 | +2.8 | –5.8 | +6.1 | +2.6 | –8.3 | +3.3 | +3.6 |
| Gross fixed capital formation | +2.8 | +1.0 | +1.3 | +1.5 | –4.7 | +4.6 | +3.5 | –6.7 | +4.7 | +3.1 | –9.8 | –1.9 | +3.2 |
| Exports | +2.7 | +1.7 | +2.8 | +2.9 | –6.1 | +8.5 | +3.7 | –11.6 | +6.9 | +4.7 | –12.5 | +5.6 | +4.5 |
| Potential output | +1.5 | +1.6 | +1.6 | +1.5 | +0.8 | +1.0 | +1.6 | +0.6 | +0.2 | +1.0 | +0.2 | –0.1 | +0.8 |
| Labor market | |||||||||||||
| Payroll employment | +1.4 | +0.9 | +0.9 | +1.0 | –1.5 | +2.6 | +1.4 | –2.2 | +2.2 | +1.5 | –2.7 | +1.5 | +1.6 |
| Hours worked | +1.4 | +0.7 | +1.0 | +1.1 | –4.1 | +4.3 | +2.3 | –6.5 | +4.3 | +2.6 | –8.2 | +3.0 | +2.9 |
| Unemployment rate | +4.5 | +4.7 | +4.8 | +4.7 | +6.3 | +5.1 | +4.7 | +6.8 | +5.8 | +5.3 | +7.3 | +6.6 | +5.9 |
| Prices | |||||||||||||
| Harmonised Index of Consumer Prices | +1.5 | +1.4 | +1.5 | +1.6 | +1.1 | +1.2 | +1.7 | +0.8 | +0.8 | +1.5 | +0.7 | +0.2 | +1.3 |
| HICP excluding energy and food | +1.7 | +1.7 | +1.5 | +1.7 | +1.6 | +0.9 | +1.6 | +1.4 | +0.6 | +1.3 | +1.1 | –0.3 | +1.0 |
| Unit labor costs (whole economy) | +2.5 | +1.7 | +1.2 | +1.5 | +3.7 | –1.5 | +1.3 | +4.4 | –1.3 | +0.9 | +5.6 | –1.2 | +0.1 |
| Compensation per employee | +2.9 | +2.1 | +2.1 | +2.3 | +0.5 | +2.4 | +2.7 | –1.0 | +1.6 | +2.3 | –1.4 | +1.0 | +2.0 |
| Compensation per hour worked | +2.9 | +2.3 | +2.0 | +2.2 | +3.2 | +0.7 | +1.8 | +3.6 | –0.4 | +1.2 | +4.6 | –0.5 | +0.6 |
| Public finances | % of nominal GDP | ||||||||||||
| Budget balance | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | –6.0 | –1.7 | 0.0 | –8.9 | –3.9 | –1.5 | –11.5 | –6.6 | –3.3 |
| Government debt | 70.4 | 68.2 | 66.0 | 63.4 | 78.8 | 74.8 | 71.4 | 84.4 | 83.7 | 81.4 | 88.9 | 93.5 | 92.2 |
| Source: OeNB. | |||||||||||||
| Economic activity | Actual figures | June 2020 | Revisions since December 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Annual change in % (real) | |||||||
| Gross domestic product | +1.5 | –7.2 | +4.9 | +2.7 | –8.3 | +3.4 | +1.1 |
| Private consumption | +1.3 | –5.8 | +6.1 | +2.6 | –7.1 | +4.8 | +1.2 |
| Government consumption | +0.7 | +1.2 | +1.6 | +0.8 | –0.3 | +0.6 | –0.2 |
| Gross fixed capital formation | +2.8 | –6.7 | +4.7 | +3.1 | –7.8 | +3.4 | +1.6 |
| Exports of goods and services | +2.7 | –11.6 | +6.9 | +4.7 | –12.9 | +4.1 | +1.8 |
| Imports of goods and services | +2.7 | –8.9 | +5.7 | +3.7 | –10.3 | +3.3 | +1.2 |
| % of nominal GDP | |||||||
| Current account balance | +2.6 | +1.5 | +2.2 | +2.3 | –0.9 | –0.3 | –0.6 |
| Import-adjusted contribution to real GDP growth1 | Percentage Points | ||||||
| Private consumption | +0.4 | –2.2 | +2.2 | +1.0 | –2.6 | +1.8 | +0.5 |
| Public consumption | +0.1 | +0.2 | +0.3 | +0.1 | +0.0 | +0.1 | –0.1 |
| Gross fixed capital formation | +0.4 | –0.8 | +0.5 | +0.4 | –1.0 | +0.3 | +0.2 |
| Domestic demand (excl. changes in inventories) | +0.9 | –2.8 | +3.0 | +1.5 | –3.6 | +2.3 | +0.6 |
| Exports | +0.7 | –3.7 | +1.9 | +1.3 | –4.0 | +1.2 | +0.5 |
| Changes in inventories (inkl. statistical discrepancy) | –0.1 | –0.3 | –0.1 | –0.1 | –0.2 | –0.1 | –0.1 |
| Prices | Annual change in % | ||||||
| Harmonised Index of Consumer Prices | +1.5 | +0.8 | +0.8 | +1.5 | –0.6 | –0.7 | –0.1 |
| Private consumption expenditure deflator of | +1.7 | +0.9 | +0.8 | +1.5 | –0.6 | –0.7 | –0.1 |
| GDP deflator | +1.7 | +1.3 | +0.1 | +1.4 | –0.2 | –1.4 | –0.3 |
| Unit labor costs (whole economy) | +2.5 | +4.4 | –1.3 | +0.9 | +2.7 | –2.5 | –0.6 |
| Compensation per employee (nominal) | +2.9 | –1.0 | +1.6 | +2.3 | –3.1 | –0.5 | +0.0 |
| Compensation per hour worked (nominal) | +2.9 | +3.6 | –0.4 | +1.2 | +1.4 | –2.4 | –1.0 |
| Import prices | +0.6 | –0.5 | +0.5 | +1.3 | –1.7 | –1.3 | –0.4 |
| Export prices | +0.4 | –0.8 | +0.6 | +1.6 | –2.0 | –1.2 | –0.2 |
| Terms of trade | –0.2 | –0.3 | +0.1 | +0.3 | –0.2 | +0.1 | +0.2 |
| Income and savings | |||||||
| Real disposable household income | +2.2 | –0.4 | –0.4 | +2.4 | –2.0 | –1.7 | +1.1 |
| % of nominal disposable household income | |||||||
| Savings ratio | 8.3 | 13.4 | 7.7 | 7.4 | +5.6 | –0.1 | –0.3 |
| Labor market | Annual change in % | ||||||
| Payroll employment | +1.4 | –2.2 | +2.2 | +1.5 | –3.1 | +1.3 | +0.5 |
| Hours worked (payroll employment) | +1.4 | –6.5 | +4.3 | +2.6 | –7.2 | +3.3 | +1.5 |
| % of labor supply | |||||||
| Unemployment rate (Eurostat definition) | 4.5 | 6.8 | 5.8 | 5.3 | +2.1 | +1.0 | +0.6 |
| Public finances | % of nominal GDP | ||||||
| Budget balance (Maastricht definition) | +0.7 | –8.9 | –3.9 | –1.5 | –9.1 | –4.1 | –2.1 |
| Government debt | 70.4 | 84.4 | 83.7 | 81.4 | +16.2 | +17.7 | +18.0 |
| Source: 2019 (actual figures): WIFO, Statistics Austria, OeNB; OeNB June 2020 and December 2019 outlook. | |||||||
| 1 The import-adjusted growth contributions were calculating by offsetting all final demand component with the corresponding imports, which were obtained from input-output tables. | |||||||
Annex: detailed result tables
| Chained volume data (reference year = 2015) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| EUR million | Annual change in % | |||||||
| Private consumption | 191,601 | 180,498 | 191,482 | 196,544 | +1.3 | –5.8 | +6.1 | +2.6 |
| Government consumption | 71,075 | 71,934 | 73,089 | 73,638 | +0.7 | +1.2 | +1.6 | +0.8 |
| Gross fixed capital formation | 90,139 | 84,068 | 87,996 | 90,767 | +2.8 | –6.7 | +4.7 | +3.1 |
| of which: Investment in plant and equipment | 31,184 | 26,654 | 29,011 | 30,015 | +2.6 | –14.5 | +8.8 | +3.5 |
| Housing investment | 16,770 | 16,335 | 16,707 | 17,302 | +3.9 | –2.6 | +2.3 | +3.6 |
| Nonhousing investment and other investment | 23,416 | 22,612 | 23,349 | 24,066 | +1.7 | –3.4 | +3.3 | +3.1 |
| Changes in inventories (incl. statistical discrepancy) | 4,890 | 1,553 | –345 | –1,300 | x | x | x | x |
| Domestic demand | 357,705 | 338,053 | 352,221 | 359,648 | 1.5 | –5.5 | 4.2 | 2.1 |
| Exports of goods and services | 215,312 | 190,416 | 203,565 | 213,118 | +2.7 | –11.6 | +6.9 | +4.7 |
| Imports of goods and services | 198,305 | 180,671 | 190,922 | 197,917 | +2.7 | –8.9 | +5.7 | +3.7 |
| Net exports | 17,008 | 9,745 | 12,643 | 15,201 | x | x | x | x |
| Gross domestic product | 374,713 | 347,798 | 364,864 | 374,849 | +1.5 | –7.2 | +4.9 | +2.7 |
| Source: 2019: Eurostat; 2020 to 2022: OeNB June 2020 outlook. | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 = 100 | Annual change in % | |||||||
| Private consumption | 107,3 | 108,3 | 109,2 | 110,8 | +1,7 | +0,9 | +0,8 | +1,5 |
| Government consumption | 108,0 | 112,0 | 110,3 | 111,2 | +2,4 | +3,6 | –1,5 | +0,8 |
| Gross fixed capital formation | 107,3 | 108,2 | 108,9 | 110,3 | +2,1 | +0,8 | +0,6 | +1,3 |
| Domestic demand (excl. changes in inventories) | 107,5 | 109,0 | 109,3 | 110,7 | +1,9 | +1,5 | +0,3 | +1,3 |
| Exports of goods and services | 103,1 | 102,2 | 102,8 | 104,5 | +0,4 | –0,8 | +0,6 | +1,6 |
| Imports of goods and services | 104,4 | 103,9 | 104,5 | 105,8 | +0,6 | –0,5 | +0,5 | +1,3 |
| Terms of trade | 98,7 | 98,4 | 98,4 | 98,7 | –0,2 | –0,3 | +0,1 | +0,3 |
| Gross domestic product | 106,4 | 107,7 | 107,8 | 109,4 | +1,7 | +1,3 | +0,1 | +1,4 |
| Source: 2019: Eurostat; 2020 to 2022: OeNB June 2020 outlook. | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR million | Annual change in % | |||||||
| Private consumption | 205,671 | 195,425 | 209,080 | 217,760 | +2.9 | –5.0 | +7.0 | +4.2 |
| Government consumption | 76,788 | 80,549 | 80,636 | 81,879 | +3.1 | +4.9 | +0.1 | +1.5 |
| Gross fixed capital formation | 96,730 | 90,949 | 95,787 | 100,081 | +4.9 | –6.0 | +5.3 | +4.5 |
| Changes in inventory (incl. statistical discrepancy) | 4,534 | 639 | –1,904 | –2,998 | x | x | x | x |
| Domestic demand | 383,724 | 367,563 | 383,598 | 396,722 | +3.4 | –4.2 | +4.4 | +3.4 |
| Exports of goods and services | 221,939 | 194,774 | 209,333 | 222,620 | +3.1 | –12.2 | +7.5 | +6.3 |
| Imports of goods and services | 207,104 | 187,797 | 199,445 | 209,413 | +3.3 | –9.3 | +6.2 | +5.0 |
| Net exports | 14,835 | 6,978 | 9,888 | 13,207 | x | x | x | x |
| Gross domestic product | 398,559 | 374,541 | 393,486 | 409,929 | +3.3 | –6.0 | +5.1 | +4.2 |
| Source: 2019: Eurostat; 2020 to 2022: OeNB June 2020 outlook. | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thousands | Annual change in % | |||||||
| Total employment | 4,540.5 | 4,439.1 | 4,527.9 | 4,589.3 | +1.1 | –2.2 | +2.0 | +1.4 |
| of which: private sector | 3,788.5 | 3,684.6 | 3,772.7 | 3,833.4 | +1.4 | –2.7 | +2.4 | +1.6 |
| Payroll employment (national accounts definition) | 4,000.1 | 3,914.1 | 4,001.0 | 4,060.2 | +1.4 | –2.2 | +2.2 | +1.5 |
| % of labor supply | ||||||||
| Unemployment rate (Eurostat definition) | 4.5 | 6.8 | 5.8 | 5.3 | x | x | x | x |
| EUR per real output unit x 100 | ||||||||
| Unit labor costs (whole economy)1 | 58.5 | 61.0 | 60.3 | 60.8 | +2.5 | +4.4 | –1.3 | +0.9 |
| EUR thousand per employee | ||||||||
| Labor productivity (whole economy)2 | 82.5 | 78.3 | 80.6 | 81.7 | +0.4 | –5.1 | +2.9 | +1.4 |
| EUR thousand | ||||||||
| Compensation per employee (real)3 | 45.0 | 44.1 | 44.5 | 44.8 | +1.2 | –1.8 | +0.8 | +0.8 |
| EUR thousand at current prices | ||||||||
| Compensation per employee (gross) | 48.3 | 47.8 | 48.6 | 49.7 | +2.9 | –1.0 | +1.6 | +2.3 |
| EUR million at current prices | ||||||||
| Total compensation of employees (gross) | 193,071 | 187,141 | 194,343 | 201,734 | +4.3 | –3.1 | +3.8 | +3.8 |
| Source: 2019: OeNB; 2020 to 2022: OeNB June 2020 outlook. | ||||||||
| 1 Gross wages and salaries divided by real GDP. | ||||||||
| 2 Real GDP divided by total employment. | ||||||||
| 3 Gross wages and salaries per employee divided by private consumption expenditure deflator. | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR million | % of nominal GDP | |||||||
| Balance of trade | 14,160.0 | 8,640.9 | 11,679.7 | 12,858.9 | 3.6 | 2.3 | 3.0 | 3.1 |
| Balance of goods | 3,784.0 | –489.2 | 1,357.5 | 2,697.1 | 0.9 | –0.1 | 0.3 | 0.7 |
| Balance of services | 10,376.0 | 9,130.1 | 10,322.3 | 10,161.9 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 |
| Balance of primary income | –199.0 | –296.1 | –303.3 | –303.3 | 0.0 | –0.1 | –0.1 | –0.1 |
| Balance of secondary income | –3,502.0 | –2,672.7 | –2,907.1 | –3,041.8 | –0.9 | –0.7 | –0.7 | –0.7 |
| Current account balance | 10,459.0 | 5,672.0 | 8,469.3 | 9,513.8 | 2.6 | 1.5 | 2.2 | 2.3 |
| Source: 2019: OeNB; 2020 to 2022: OeNB June 2020 outlook. | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||
| Prices, wages, costs | Annual change in % | ||||||||||||||
| HICP | +0.8 | +0.8 | +1.5 | +2.0 | +1.1 | +0.3 | +0.1 | +0.2 | +0.7 | +1.2 | +1.3 | +1.2 | +1.4 | +1.6 | +1.6 |
| HICP excl. energy | +1.4 | +0.6 | +1.3 | +2.2 | +1.8 | +0.9 | +0.6 | +0.3 | +0.2 | +0.9 | +1.0 | +0.9 | +1.2 | +1.5 | +1.4 |
| Private consumption expenditure deflator | +0.9 | +0.8 | +1.5 | +1.7 | +1.3 | +0.5 | +0.1 | +0.0 | +0.4 | +1.3 | +1.7 | +1.7 | +1.5 | +1.4 | +1.3 |
| Gross fixed capital formation deflator | +0.8 | +0.6 | +1.3 | +1.6 | +1.1 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | +0.9 | +1.2 | +1.3 | +1.3 | +1.3 | +1.2 |
| GDP deflator | +1.3 | +0.1 | +1.4 | +1.5 | +2.3 | +0.8 | +0.4 | +0.0 | –0.9 | +0.5 | +0.9 | +1.3 | +1.5 | +1.4 | +1.4 |
| Unit labor costs | +4.4 | –1.3 | +0.9 | +4.4 | +6.1 | +4.2 | +2.8 | +0.6 | –2.0 | –1.7 | –1.9 | –1.3 | –0.3 | +1.7 | +3.7 |
| Compensation per employee (nominal) | –1.0 | +1.6 | +2.3 | +1.5 | –4.2 | –0.9 | –0.3 | +0.4 | +5.4 | +1.1 | –0.2 | +0.2 | +1.5 | +3.1 | +4.4 |
| Productivity | –5.1 | +2.9 | +1.4 | –2.8 | –9.7 | –4.9 | –3.0 | –0.2 | +7.6 | +2.8 | +1.7 | +1.5 | +1.8 | +1.4 | +0.7 |
| Compensation per employee (real) | –1.8 | +0.8 | +0.8 | –0.1 | –5.4 | –1.4 | –0.3 | +0.4 | +5.0 | –0.3 | –1.9 | –1.5 | +0.0 | +1.7 | +3.0 |
| Import deflator | –0.5 | +0.5 | +1.3 | +0.0 | –0.8 | –0.4 | –0.6 | –0.4 | +0.5 | +0.8 | +1.1 | +1.2 | +1.2 | +1.3 | +1.4 |
| Export deflator | –0.8 | +0.6 | +1.6 | +0.5 | –1.5 | –1.3 | –1.0 | –1.4 | +0.7 | +1.4 | +1.5 | +1.6 | +1.6 | +1.6 | +1.6 |
| Terms of trade | –0.3 | +0.1 | +0.3 | +0.6 | –0.6 | –0.8 | –0.4 | –0.9 | +0.2 | +0.6 | +0.4 | +0.4 | +0.4 | +0.2 | +0.2 |
| Economic activity | Annual and/or quarterly changes in % (real) | ||||||||||||||
| GDP | –7.2 | +4.9 | +2.7 | –2.5 | –11.1 | +6.3 | +2.6 | +1.5 | +0.7 | +1.0 | +1.0 | +0.7 | +0.5 | +0.4 | +0.2 |
| Private consumption | –5.8 | +6.1 | +2.6 | –3.1 | –10.2 | +8.5 | +3.0 | +1.5 | +0.5 | +0.7 | +0.8 | +0.7 | +0.6 | +0.5 | +0.4 |
| Public consumption | +1.2 | +1.6 | +0.8 | +0.6 | –0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.5 | +0.6 | +0.5 | +0.3 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| Gross fixed capital formation | –6.7 | +4.7 | +3.1 | –0.9 | –12.0 | +5.3 | +3.7 | +1.7 | +0.4 | +0.8 | +0.9 | +0.8 | +0.8 | +0.7 | +0.7 |
| Exports | –11.6 | +6.9 | +4.7 | –1.8 | –17.2 | +6.4 | +3.7 | +3.0 | +2.2 | +1.8 | +1.3 | +1.0 | +0.9 | +0.7 | +0.6 |
| Imports | –8.9 | +5.7 | +3.7 | –2.3 | –12.6 | +7.0 | +3.5 | +1.8 | +0.8 | +0.9 | +1.0 | +0.9 | +0.9 | +0.9 | +0.9 |
| Contribution to real GDP growth in percentage points | |||||||||||||||
| Domestic demand | –4.4 | +4.6 | +2.3 | –1.7 | –8.2 | +5.7 | +2.5 | +1.3 | +0.5 | +0.7 | +0.7 | +0.6 | +0.5 | +0.4 | +0.4 |
| Net exports | –1.9 | +0.8 | +0.7 | +0.2 | –3.3 | –0.2 | +0.1 | +0.7 | +0.8 | +0.6 | +0.2 | +0.1 | +0.0 | –0.1 | –0.1 |
| Changes in inventories | –0.9 | –0.5 | –0.3 | –1.0 | +0.4 | +0.8 | +0.0 | –0.4 | –0.6 | –0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| Labor market | % of labor supply | ||||||||||||||
| Unemployment rate (Eurostat definition) | 6.8 | 5.8 | 5.3 | 4.6 | 8.5 | 7.4 | 6.7 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.0 |
| Annual and/or quarterly changes in % | |||||||||||||||
| Total employment | –2.2 | +2.0 | +1.4 | –0.2 | –4.1 | +1.1 | +0.9 | +1.0 | +0.7 | +0.5 | +0.3 | +0.3 | +0.2 | +0.3 | +0.3 |
| of which: private sector | –2.7 | +2.4 | +1.6 | –0.3 | –5.0 | +1.3 | +1.1 | +1.2 | +0.8 | +0.6 | +0.4 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.4 |
| Payroll employment | –2.2 | +2.2 | +1.5 | –0.4 | –3.9 | +1.2 | +1.0 | +1.0 | +0.7 | +0.6 | +0.4 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.3 |
| Additional variables | Annual and/or quarterly changes in % (real) | ||||||||||||||
| Disposable household income | –0.4 | –0.4 | +2.4 | –1.2 | –4.5 | +4.3 | +0.5 | –0.5 | –1.0 | –0.9 | +0.1 | +1.2 | +1.3 | +1.1 | +1.1 |
| % of real GDP | |||||||||||||||
| Output gap | –7.5 | –3.2 | –1.5 | –2.8 | –13.6 | –8.1 | –5.7 | –4.2 | –3.6 | –2.8 | –2.1 | –1.7 | –1.4 | –1.3 | –1.5 |
| Source: OeNB June 2020 outlook. Quarterly values based on seasonally and working day-adjusted data. | |||||||||||||||
| OeNB | WIFO | IMF | European Commission | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2020 | April 2020 | April 2020 | May 2020 | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
| Main results | Annual change in % | ||||||||
| GDP (real) | –7.2 | +4.9 | +2.7 | –5.2 | +3.5 | –7.0 | +4.5 | –5.5 | +5.0 |
| Private consumption (real) | –5.8 | +6.1 | +2.6 | –2.9 | +3.1 | x | x | –4.8 | +4.9 |
| Government consumption (real) | +1.2 | +1.6 | +0.8 | +5.3 | –1.0 | x | x | +3.0 | +0.1 |
| Gross fixed capital formation (real) | –6.7 | +4.7 | +3.1 | –8.7 | +4.5 | x | x | –9.5 | +6.9 |
| Exports (real) | –11.6 | +6.9 | +4.7 | –12.0 | +8.8 | x | x | –12.5 | +10.3 |
| Imports (real) | –8.9 | +5.7 | +3.7 | –9.7 | +6.9 | x | x | –10.8 | +9.0 |
| GDP per employee1 | –5.1 | +2.9 | +1.4 | –3.6 | +2.4 | x | x | –4.2 | +3.6 |
| BIP deflator | +1.3 | –0.1 | +1.3 | +1.2 | +0.6 | x | x | +1.2 | +1.1 |
| CPI | x | x | x | +0.9 | +1.3 | x | x | x | x |
| HICP | +0.8 | +0.8 | +1.5 | x | x | +0.4 | +1.7 | +1.1 | +1.5 |
| Unit labor costs | +4.4 | –1.3 | +0.9 | +2.3 | +2.4 | x | x | +5.1 | –2.3 |
| Payroll employment | –2.2 | +2.2 | +1.5 | –1.7 | +1.4 | x | x | –1.4 | +1.4 |
| % of labor supply | |||||||||
| Unemployment rate (Eurostat definition) | 6.8 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.8 | 4.9 |
| % of nominal GDP | |||||||||
| Current account balance | 1.5 | 2.2 | 2.3 | x | x | 1.9 | 2.0 | 0.9 | 1.6 |
| Budget balance (Maastricht definition) | –8.9 | –3.9 | –1.5 | –7.4 | –3.3 | –7.1 | –1.6 | –6.1 | –1.9 |
| External assumptions | |||||||||
| Oil price in USD/Barrel (Brent) | 36.0 | 37.2 | 40.7 | 40.0 | 45.0 | 35.6 | 37.9 | 38.4 | 40.2 |
| Short-term interest rate in % | –0.4 | –0.4 | –0.4 | x | x | –0.4 | –0.4 | –0.3 | –0.4 |
| USD/EUR exchange rate | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 1.10 |
| Annual change in % | |||||||||
| Euro area GDP (real) | –8.7 | +5.2 | +3.3 | –6.1 | +2.9 | –7.5 | +4.7 | –7.7 | +6.3 |
| U.S. GDP (real) | –6.4 | +3.6 | +2.1 | –5.2 | +5.1 | –5.9 | +4.7 | –6.5 | +4.9 |
| World GDP (real) | –4.5 | +6.0 | +3.8 | x | x | –3.0 | +5.8 | –3.5 | +5.2 |
| World trade | –12.7 | +7.9 | +4.5 | x | x | –11.0 | +8.4 | –11.0 | +7.5 |
| Source: OeNB, WIFO, IHS, OECD, IMF, European Commission. | |||||||||
| 1 WIFO: GPD per hour worked. | |||||||||
278 Oesterreichische Nationalbank, Economic Analysis Division, gerhard.fenz@oenb.at, christian.ragacs@oenb.at, martin.schneider@oenb.at, klaus.vondra@oenb.at. With contributions from Friedrich Fritzer, Ernst Glatzer, Ernest Gnan, Walpurga Köhler-Töglhofer, Doris Prammer, Beate Resch, Doris Ritzberger-Grünwald and Alfred Stiglbauer.
279 Until the December 2019 forecast, the seasonally and working day-adjusted national accounts data feeding into the OeNB economic outlook were estimated on the basis of trend-cycle decomposition. This approach served to adjust the time series for its idiosyncratic component, thus smoothing the time series over time. Since this time series is no longer computed by WIFO, the OeNB now uses national accounts data adjusted for seasonal and working-day effects in line with Eurostat requirements. This time series includes the idiosyncratic component, which means that the individual GDP components and GDP appear to be more volatile.
280 The restart of the economy is concentrated above all on the manufacturing industry and the providers of certain services, whereas the hospitality industry (i.e. providers of accommodation and food services) and the arts, entertainment and recreation sector are going to be affected for comparatively longer periods.
281 For official epidemiological data for Austria, see the dashboard provided by the Ministry for Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection at www.sozialministerium.at/en.html.
282 The OeNB’s GDP indicator is published weekly on the OeNB’s website. See below for an updated report on the results of the OeNB’s weekly GDP indicator as published on May 28, 2020.
283 See the annex for the quarterly forecasts.
284 Schneider, M. and W. Waschiczek. 2020. Konjunktur Aktuell – Berichte und Analysen zur wirtschaftlichen Lage – special issue April 2020 (available in German at www.oenb.at/Publikationen/Volkswirtschaft/konjunktur-aktuell.html).
285 See the table in the annex for details on current account developments.
286 The break in the data series resulting from the new method for seasonal adjustments does not allow for a meaningful interpretation of these results for the time being.
287 Author: Doris Prammer, Oesterreichische Nationalbank, Economic Analysis Division, doris.prammer@oenb.at.
288 Austria’s debt ratio peaked at 84.9% of GDP in 2015. This is the highest rate during the period (starting in 1995) for which meaningful comparisons of the debt ratio can be made.
289 Author: Alfred Stiglbauer, Oesterreichische Nationalbank, Economic Analysis Division, alfred.stiglbauer@oenb.at.
290 Federal guideline on short-time working subsidies/qualification subsidies and training cost subsidies of May 1, 2016.
291 Federal guideline on short-time working subsidies effective from March 1, 2020.
292 Author: Friedrich Fritzer, Oesterreichische Nationalbank, Economic Analysis Division, friedrich.fritzer@oenb.at.
293 On April 12, 2020, OPEC+ (OPEC members including important non-OPEC crude oil suppliers such as Russia) pulled off a historic deal to cut global oil output.
294 The 2019 tax reform package envisages gradual tobacco tax hikes in the years from 2020 to 2022.
295 See the methodological notes published by Statistics Austria at www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/preise/verbraucherpreisindex_vpi_hvpi/index.html (available in German only).
296 Owing to space constraints, we can only list the most important assumptions agreed by the Eurosystem.
| Designation | NACE code | Demand | Labor market | Supply | Financing/solvency | Financing/liquidity | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drop in demand in % | Potential catch-up effects | Rise in unemployment(% of employment) | Share attributable to shutdown | Staff intensity (employees per EUR million value added) | Share of nonresident labor (%) | Share of imported intermediate goods in gross manufacturing output | Equity capital ratio (inverted) | Probability of loan default (%) | Short-term net liquidity position (inverted) | Unused share of gross manufacturing output (%; inverted) | Overall score (0-1) | ||
| Accommodation, food service activities | I | 80 | 0 | 25.9 | 1.00 | 12.9 | 55.0 | 7.1 | 15.8 | 3.2 | 2.1 | 2.8 | 1.00 |
| Travel agencies, tour operators | N79 | 88 | 0 | 4.7 | 1.00 | 25.7 | 16.4 | 41.3 | 18.1 | 1.0 | 30.0 | 2.6 | 0.87 |
| Other services n.e.c. | S96 | 74 | 13 | 17.3 | 0.88 | 15.5 | 29.6 | 4.4 | 29.5 | 1.4 | 20.9 | 4.2 | 0.83 |
| Air transport | H51 | 90 | 10 | 0.6 | 1.00 | 10.8 | 24.7 | 29.0 | 22.4 | 1.6 | 27.4 | 0.4 | 0.81 |
| Sports activities, recreation activities | R93 | 80 | 0 | 11.2 | 1.00 | 9.4 | 30.0 | 6.9 | 24.3 | 2.4 | 12.2 | 2.2 | 0.81 |
| Manufacture of furniture, other manufacturing | C31-C32 | 81 | 50 | 1.1 | 0.00 | 13.9 | 16.8 | 38.8 | 32.3 | 0.8 | 17.5 | 3.7 | 0.74 |
| Arts, entertainment activities | R90-R92 | 82 | 0 | 1.6 | 1.00 | 8.6 | 25.1 | 5.9 | 44.8 | 0.6 | 30.2 | 4.0 | 0.67 |
| Manufacture of motor vehicles | C29 | 66 | 50 | 0.7 | 0.00 | 9.1 | 19.7 | 55.8 | 35.9 | 0.8 | 8.7 | 2.4 | 0.65 |
| Manufacture of textile products, apparel, leather | C13-C15 | 70 | 50 | 0.7 | 0.00 | 14.9 | 31.2 | 41.1 | 34.0 | 2.6 | 19.7 | 4.7 | 0.65 |
| Retail trade | G47 | 51 | 25 | 4.0 | 0.85 | 20.7 | 21.8 | 6.4 | 24.6 | 1.8 | 10.1 | 6.1 | 0.58 |
| Printing and reproduction | C18 | 57 | 50 | 2.0 | 0.00 | 11.0 | 15.5 | 34.0 | 23.3 | 1.7 | 11.8 | 3.1 | 0.58 |
| Manufacture of coke and refined petroleum products | C19 | 38 | 50 | 0.9 | 0.00 | 1.5 | 13.8 | 98.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5.1 | 0.54 |
| Land transport | H49 | 45 | 20 | 11.1 | 0.00 | 12.2 | 31.6 | 6.9 | 27.3 | 1.2 | -0.2 | 3.5 | 0.54 |
| Employment activities | N78 | 46 | 13 | 15.0 | 0.00 | 20.2 | 45.0 | 1.4 | 24.5 | 1.0 | 68.9 | 1.7 | 0.52 |
| Manufacture of other transport equipment | C30 | 54 | 50 | 0.7 | 0.00 | 10.5 | 20.1 | 22.3 | 31.6 | 0.6 | 15.3 | 9.4 | 0.51 |
| Repair/installation of machinery | C33 | 45 | 50 | 1.6 | 0.00 | 9.9 | 14.6 | 24.0 | 29.5 | 1.2 | 9.7 | 1.5 | 0.49 |
| Administrative/support service activities | N | 30 | 20 | 10.0 | 0.75 | 14.0 | 45.2 | 8.1 | 28.3 | 0.7 | 30.1 | 4.9 | 0.49 |
| Trade | G | 44 | 25 | 3.4 | 0.75 | 13.8 | 20.1 | 11.3 | 28.0 | 1.2 | 21.1 | 8.8 | 0.48 |
| Sale/repair of motor vehicles | G45 | 42 | 25 | 3.7 | 0.75 | 13.5 | 16.5 | 16.6 | 24.0 | 1.9 | 8.2 | 9.2 | 0.47 |
| Construction | F | 37 | 25 | 11.5 | 0.25 | 10.7 | 30.1 | 11.0 | 24.7 | 1.6 | 11.1 | 10.3 | 0.47 |
| Source: OeNB. | |||||||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Annual change in % | ||||
| Total employment (heads) | +1.1 | –2.2 | +2.0 | +1.4 |
| Payroll employment | +1.4 | –2.2 | +2.2 | +1.5 |
| of which: public sector employees | +0.0 | +0.3 | +0.1 | +0.1 |
| Self-employment | –0.7 | –2.9 | +0.4 | +0.4 |
| Total hours worked | +1.1 | –6.5 | +3.9 | +2.4 |
| Payroll employment | +1.4 | –6.5 | +4.3 | +2.6 |
| Self-employment | –0.5 | –7.0 | +2.0 | +1.2 |
| Labor supply | +0.7 | +0.1 | +1.0 | +0.8 |
| Unemployed | –7.1 | +51.8 | –13.7 | –8.5 |
| % of labor supply | ||||
| Unemployment rate (Eurostat definition) | 4.5 | 6.8 | 5.8 | 5.3 |
| Source: 2019: WIFO, Statistics Austria; 2020 to 2022: OeNB June 2020 outlook. | ||||